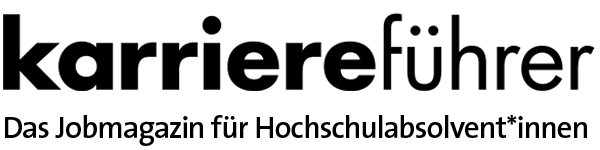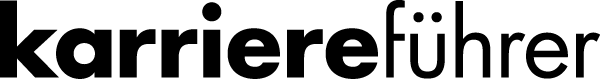Mandanten benötigen exzellente Strafverteidiger, die ohne Wenn und Aber für sie eintreten. Zu ihnen zählen heute immer häufiger Unternehmen, die Beratung beim Thema Compliance oder im Steuerstrafrecht benötigen. Für Strafrechtler mit dem richtigen Schwerpunkt bieten sich somit hervorragende Chancen. Von André Boße
Rechtsanwalt Sascha Böttner mag es, wenn er auf Veranstaltungen oder bei privaten Anlässen auf seinen Beruf als Strafverteidiger angesprochen wird. Selbst komplizierten und moralischen Fragen stellt sich der in Hamburg niedergelassene promovierte Jurist gerne. Wie er sich denn zum Beispiel fühle, wenn er einen mutmaßlichen Gewaltverbrecher zu verteidigen habe. „Aus diesen Fragen resultieren in der Regel interessante Gespräche, die – wenn es gut läuft – beim Gesprächspartner mit einer anderen Sichtweise auf die strafrechtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts enden“, sagt Böttner, der von der Rechtsanwaltskammer Hamburg zum Fachanwalt für Strafrecht ernannt wurde – eine geschützte Auszeichnung, die Rechtsanwälten verliehen wird, die genügend theoretische und praktische Erfahrungen im Bereich des Strafrechts gesammelt haben.
„Strafrecht bedeutet Leben“
Der Absolvent der Uni Hamburg wird in solchen Gesprächen häufig mit den gängigen Klischees konfrontiert. Eines stimme schon, sagt er: „Man hat es als Anwalt für Strafrecht tatsächlich oft weniger mit komplizierter Rechtsmaterie als vielmehr mit interessanten Sachverhalten, Menschen und Konstellationen zu tun.“ Dadurch, dass man im Strafrecht in zahlreichen Verfahren mit menschlichen Ausnahmesituationen konfrontiert sei, gewinne man „konzentrierte Lebenserfahrung im Zeitraffer“, wie Böttner sagt. Ein anderer Vorbehalt gegen seinen Beruf trifft seiner Meinung nach jedoch überhaupt nicht zu: Nein, als anrüchig würde er den Bereich der Strafverteidigung keinesfalls bezeichnen. Im Gegenteil: „Eine nach den Regeln der Kunst und insbesondere den geltenden Gesetzen erfolgende Strafverteidigung ist eine äußerst ehrbare Tätigkeit.“ Der Hamburger Rechtsanwalt benennt das Strafrecht als das Instrument, an dem sich ein Rechtsstaat messen lassen müsse. „Für die am Strafverfahren unmittelbar beteiligten Juristen bildet sowohl das Strafrecht als auch die Strafprozessordnung mit allen ihren Rechten und Verfahrensformen eine der höchsten Errungenschaften des modernen Rechtsstaats.“
Kein Wunder, dass Böttner keinen Moment zögert, wenn er die Frage beantworten soll, ob er jungen Juristen den Schritt in eine Karriere im Strafrecht empfehlen kann. „Strafrecht bedeutet Leben“, fasst er die vielen interessanten und spannenden Facetten des Rechtsbereichs zusammen. Und, nicht unwichtig für Nachwuchskräfte: Man kann auch davon leben. Zwar sei im Strafrecht der Wettbewerbsdruck gestiegen, da immer mehr Anwälte auf den Markt drängen. Doch Böttner gibt ambitionierten Nachwuchsjuristen mit auf den Weg, dass es immer Möglichkeiten gibt, sich von der Konkurrenz abzuheben. „Strafrecht ist nicht jedermanns Sache“, sagt er. Wer daher als Spitzenjurist schnell gute Erfahrungen sammelt, sei gut im Geschäft.
Zwei Etappenziele zum Erfolg
Doch wie gelingt der Einstieg? Oliver Wallasch betreibt zusammen mit seinem Kollegen Michael Koch die Kanzlei Wallasch & Koch in Frankfurt am Main. Zuletzt gingen einige seiner Fälle durch die Presse: 2009 verteidigte Wallasch einen mutmaßlichen somalischen Piraten, der von einer deutschen Fregatte festgesetzt und dann nach Kenia gebracht wurde – seitdem trägt Wallasch in den Medien die Bezeichnung „Piraten-Anwalt“. Bekannt wurde der gebürtige Bergisch- Gladbacher zudem durch Mandanten wie der Ex-„No-Angels“-Sängerin Nadja Benaissa oder den kanadischen Tierschutzaktivisten Paul Watson, der wegen seiner Proteste gegen die Haijagd vor der Küste Costa Ricas angeklagt ist und dabei prominenten öffentlichen Beistand durch Pamela Anderson erfährt. „Aus meiner Sicht müssen sich Jura-Absolventen von dem Gedanken verabschieden, dass man sich mit einem Schild an der Tür als Rechtsanwalt niederlässt und Strafsachen quasi nebenbei ohne echte Spezialisierung bearbeitet“, sagt Wallasch – und weist auf die zwei wichtigsten Meilensteine in der Laufbahn eines erfolgreichen Strafverteidigers hin: „Der Weg zu einer erfolgreichen Karriere kann meiner Meinung nach nur über die Spezialisierung führen und den Willen, den Fachanwalt für Strafrecht zu erwerben.“
Um dieses Etappenziel zu erreichen, sind besondere Talente und Fähigkeiten gefordert. Fundiertes Fachwissen zum Beispiel, dazu insbesondere Kenntnisse der Strafprozessordnung, weil, so Wallasch, „eine exzellente Verteidigung in der Hauptverhandlung immer auch spontanes Eingreifen des Verteidigers erfordert“. In solchen Situationen gilt es, schnell und geschickt zum Wohle des Mandanten die Möglichkeiten zu nutzen, die die Strafprozessordnung vorsieht. Doch die eigentliche Verhandlung ist nicht alles. Schon weit vorher muss der Strafverteidiger das Talent mitbringen, auf die Menschen, die seinen rechtlichen Beistand benötigen, zuzugehen und ihre Lage zu erkennen. „Die Mandanten, die mit einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren konfrontiert sind, befinden sich allesamt in einer Ausnahmesituation“, sagt Wallasch. Hinzu komme, dass sie sich dem Machtapparat von Polizei, Justiz und – bei prominenten Mandanten – den Medien ausgesetzt fühlen. Für den Strafverteidiger komme es daher darauf an, drei Einflussbereiche in Balance zu halten: Da ist erstens der Strafanspruch des Staates, zweitens die Gewährleistung der Rechte von Beschuldigten und drittens der Anspruch aller Beteiligten, das Verfahren fair zu gestalten. „Dieses Austarieren hat man an der Universität im Laufe des Studiums höchstwahrscheinlich nicht gelernt“, sagt Wallasch. Da hilft nur eins: Lernen in der Praxis – mit dem Problem, dass das Motto „Learning by Doing“ in Strafsachen für den Mandanten erhebliche negative Konsequenzen haben kann.
Literaturtipps für Strafrechtler
Ob in der Literatur oder im Fernsehen: Es gibt eine Menge fiktiver Stoffe, die gnadenlos an der Realität des Alltags eines Strafrechtlers vorbeizielen. Besser wird es natürlich, wenn ein Strafverteidiger selbst ein Buch schreibt. Ferdinand von Schirach ist seit 1994 im Strafrecht tätig, das Motto seiner Kanzlei stammt von Max Alsberg, einem der wichtigsten Strafverteidiger der Weimarer Republik: Die Aufgabe des Strafverteidigers sei es, „den hochgemuten, voreiligen Griff nach der Wahrheit zu hemmen“. Wie schwer das manchmal ist, zeigt von Schirach in seinen zwei Story-Sammlungen, für die er tatsächliche Fälle literarisch aufbereitet hat. „Verbrechen“ (2009) und „Schuld“ (2010) sind beides: ein literarisches Vergnügen und zugleich ein Praxisseminar.
Verbrechen. Piper 2009, ISBN 978-3 492 05362 4. 17,95 Euro
Schuld. Piper 2010, ISBN 978-3 492 05422 5. 17,95 Euro
Gute Aussichten im Compliance
Daher schlägt im Strafrecht die Stunde der topqualifizierten Spezialisten. Für Dr. Ines Kilian, die eine Kanzlei für Strafrecht in Dresden führt, hat vor allem die Ausweitung des Kern- und Nebenstrafrechtes dazu geführt, dass ein Fokus auf bestimmte Bereiche sinnvoller denn je ist. Eine chancenreiche Spezialisierung ist zum Beispiel die Orientierung auf das Wirtschaftsstrafrecht, dessen Bedeutung und Reichweite in den vergangen Jahren deutlich gestiegen ist. Das Führen eines Unternehmens sowie die Teilhabe am Wirtschaftsleben sind heute „strafrechtlich riskanter denn je“, sagt Kilian. Was Unternehmer vor große Herausforderungen stellt, bietet Strafrechtlern neue Karrierewege. „Der Beratungsbedarf von Unternehmen und Banken im Strafrecht steigt“, sagt die Fachanwältin. Auch habe die präventive Compliance-Beratung von Unternehmen in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Kilian: „Bei einer frühzeitigen Spezialisierung auf Strafrecht mit Kenntnissen im Wirtschafts- und Steuerrecht bestehen daher gute Berufsaussichten in den Compliance-Abteilungen von Großunternehmen.“
Nicht zuletzt durch diese Entwicklung hat sich im Markt der Strafverteidigung eine Dreiteilung gefestigt: Da sind zum einen die Allgemeinanwälte, die gelegentlich Strafdelikte bearbeiten. Zweitens die Strafverteidiger, die ohne weitergehende Spezialisierung ausschließlich in Strafsachen tätig sind. In diesen beiden Gruppen ist der Wettbewerb besonders hoch, der Markt dicht. Deutlich mehr Raum bietet sich den Mitgliedern der dritten Gruppe: den Spezialisten, die einen bestimmten Deliktsbereich abdecken und in Bereichen, bei denen andere sich erst noch schlau machen müssen, von ihrer Expertise und ihren Erfahrungen profitieren. Wer hier auf das richtige Thema setzt, hat am Markt besonders gute Chancen. „Daher haben sich vor allen in den Ballungsräumen auf Strafrecht spezialisierte Großkanzleien herausgebildet, deren Schwerpunkt im Unternehmensstrafrecht liegt“, hat Ines Kilian beobachtet, die als Referentin der Deutschen Anwalt Akademie an der juristischen Ausbildung zum Fachanwalt für Strafrecht beteiligt ist.
Neu ist, dass sich die Strafrechtspezialisten in diesen Gebieten nicht mehr als Einzelkämpfer verstehen: „Unerlässlich sind gut funktionierende Netzwerke mit anderen Disziplinen wie Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern“, sagt die Dresdnerin. Um hier kooperieren zu können, müssen Strafverteidiger nicht nur Teamfähigkeit mitbringen, sondern auch ein ökonomisches Know-how . „Viele Strafrechtskanzleien setzen heute bei der Neueinstellung auf Wirtschafts- und Finanzmarktkenntnisse“, so Kilian. Ein Strafverteidiger, der seinen Beruf modern interpretiert, versteht sich also nicht mehr als „Mann für alle Fälle“, wie man ihn in Fernsehserien wie „Liebling Kreuzberg“ erlebte. Erfolg haben heute spezialisierte Experten, die zu kooperieren verstehen.
Was ein Strafverteidiger mitbringen muss
- Top-Qualifikation in Strafverfahrens- und materiellem Strafrecht
- Soziale Kompetenz, rhetorisches Geschick, sicheres Auftreten
- Durchsetzungs- und Einfühlungsvermögen
- Beharrlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Frustrationstoleranz
- Talent für Büroorganisation und Aktenführung
- Fundierte BWL-Kenntnisse
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift
- IT-Kenntnisse zur digitalen Bearbeitung von Akten (PDF mit Adobe Acrobat und dtSearch)
Quelle: Dozenten der Deutschen Anwalt Akademie
www.anwaltakademie.de