Das Bauwesen steht vor einem grundlegenden Wandel: Um die Erderwärmung zu stoppen, muss die Branche neue Stoffe und innovative Gebäudetypen entwickeln. Das Ziel: null Emissionen, bauen im Einklang mit der Natur und Materialrecycling vor Ort. Gefragt sind Bauingenieure, die mutig weiterdenken und sich als Nachhaltigkeitsmanager verstehen. Gelingt das, ergeben sich für den Bau ganz neue Geschäftsfelder. Ein Essay von André Boße
Spricht man über die großen Klimasünder, verweisen die meisten zunächst auf die Mobilität und die Industrie. Autos, Flugzeuge, Fabriken – in der Tat gibt es in diesen Sektoren eine Menge zu tun. Doch auch das Bauen und das Wohnen belasten das Klima, ein Beispiel ist die Herstellung des Baustoffes Zement: Laut einer Berechnung des britischen Think Tanks Chatham House verursachen die vier Milliarden Tonnen Zement, die global jährlich produziert werden, rund acht Prozent des weltweiten Ausstoßes von CO2.
Doch auch bereits genutzte Bauwerke sind für einen beträchtlichen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Eine Berechnung des Umweltbundesamts über den Energieverbrauch und die CO2-Ausstöße privater Haushalte zeigt, dass der Bereich „Wohnen“ den größten Anteil beim Energieverbrauch und bei den Treibhausgas-Emissionen hat. „Dies ist vor allem durch das Heizen der Wohnungen mit fossilen Brennstoffen wie Heizöl und Erdgas bedingt“, so das Umweltbundesamt. Wobei sich die Bilanz verbessert: Im Vergleich zum Jahr 2000 benötigt der Bereich „Wohnen“ 12,7 Prozent weniger Energie, kein anderer Sektor hat seinen Bedarf so sehr verringert.
Bündnis fordert eine Bauwende
Doch das ist erst der Anfang. Immer mehr Bauexperten fordern ein noch stärkeres Umdenken, um das Bauen und Wohnen in Sachen Klimaschutz einen großen Schritt nach vorne zu bringen. Das „Bündnis Bauwende“ zum Beispiel hat es sich zur Aufgabe gemacht, Impulsgeber für Klimaschutz und Ressourcenschonung am Bau zu sein. Es fordert, die politischen Rahmenbedingungen für das Bauen so zu verändern, dass klimaschützendes und ressourcenschonendes Bauen zum Normalfall werden. „Aus unserem Verständnis von Nachhaltigkeit heraus wollen wir für Klimaschutz und Ressourcenschonung am Bau sorgen, in Einklang mit den Bedürfnissen der Menschen und das zu vertretbaren Kosten“, heißt es in der Selbstbeschreibung des Bündnisses.
Ökologische Wohnraumoffensive
Wohnraum ist knapp, entsprechend viel soll neu gebaut werden. Für die „Kommission Nachhaltiges Bauen“ (KNBa), die das Umweltbundesamt berät, bietet sich damit die „einmalige Chance, klimaschonendes Bauen und zukunftssicheren Städtebau in der Breite zu verankern sowie über angepasste KfW-Förderprogramme die im Gebäudesektor versäumten Maßnahmen zum Klimaschutz nachzuholen“. Wichtig sei, dass kompakte, gemischtgenutzte Stadtquartiere zum Standard werden – „sie bieten eine höhere Wohnqualität und sind zudem deutlich günstiger zu Fuß, per Fahrrad oder durch den öffentlichen Nahverkehr erschließbar als großflächig zersiedelte Gebiete.“ Auch müsse mit öffentlichen Geldern gefördertes Bauen im Einklang mit den internationalen Klimaschutz-Vereinbarungen stehen: „Nur klimaschonende Gebäude mit hoher gestalterischer und Aufenthalts-Qualität garantieren auf Dauer attraktiven Wohnraum“, so Dr. Burkhard Schulze Darup, stellvertretender Vorsitzender der KNBa.
Dabei versteht es die drei Teilaspekte der Nachhaltigkeit – also Ökologie, Soziales und Wirtschaft – als drei Teile eines Bauwerks: „Die Ökologie ist das Fundament, das Soziale der Baukörper und die Ökonomie das Dach. Ein Gebäude ist nur brauchbar, wenn alle drei Elemente taugen. Aber ein Fehler im Fundament kann nicht durch ein besseres Dach ausgeglichen werden.“ Hieraus ergibt sich eine neue Hierarchie der Teilaspekte: „Denn in einer Welt, die aus den Fugen gerät, hilft es nicht, wenn Häuser besonders wirtschaftlich sind.“ Die Ökologie – also das Fundament – wird damit zum bestimmenden Faktor. Die Bauwende, die das Bündnis fordert, stellt damit durchaus einen Paradigmenwechsel dar. Gefragt sind also Bauingenieure, die sich als Nachhaltigkeitsmanager verstehen, die also sinnbildlich jeden Stein umdrehen, um zu hinterfragen: Gibt es Alternativen?
Forderung nach der dreifachen Null
Aber wie weit kommt man damit in der Praxis? Werner Sobek zählt zu Deutschlands renommiertesten Vertretern einer neuen und nachhaltigen Baukultur. Zu den Bauwerken des studierten Bauingenieurs und Architekten zählen das Sony Center in Berlin oder der Post Tower in Bonn. Die von ihm entwickelten Wohnhäuser betrachtet er als Versuchsanordnungen und Experimentierfelder, um innovative Technologien zu testen. In diesem Zusammenhang entstand auch Sobeks Nachhaltigkeitskonzept „Triple Zero“, das definiert, welche Anforderungen ein Gebäude in energetischer und materieller Hinsicht erfüllen sollte, um wirklich nachhaltig zu sein.
Dabei müsse ein Gebäude drei Null-Kriterien erfüllen: „Zero Energy Building“ steht für einen Gebrauch von null Energie aus externen Quellen. „Zero Emission Building“ bedeutet, dass das Gebäude null Kohlendioxid-Emissionen erzeugt. Hinter „Zero Waste Building“ steckt das Gebot, dass das Gebäude bei Umbau oder Abbau null Abfall hinterlässt: „Alle Bauteile können am Ende des Lebenszyklus vollständig, ohne jedwede zu verbrennende oder zu deponierende Anteile, rezykliert werden. Das Grundstück kann ohne Altlasten oder sonstige verbliebene Rückstände renaturiert werden“, heißt es in Sobeks Definition. Nur eine Utopie? Wer es nicht glaubt, kann Werner Sobek besuchen: Sein Wohnhaus in Stuttgart trägt den nüchternen Projektnamen R128 – und hier zeigt der Pionier des nachhaltigen Bauens: Die dreifache Null steht.
Wenn Häuser zu Energiespeichern werden
Auch Timo Leukefeld zählt zu den visionären Vordenkern einer neuen Art des Bauens und Wohnens. Sein großes Thema ist die Energieautarkie, in diesem Bereich berät er Bauherren bei der Planung und Sanierung konkreter Bauprojekte und lehrt an verschiedenen Hochschulen als Honorarprofessor das Thema „Vernetzte energieautarke Gebäude“. Seine Thesen erhalten einige Sprengkraft, weil sie an den Grundfesten der Ökonomie rütteln, wie wir sie kennen: Noch erleben wir eine Wirtschaft der Knappheit, doch diese werde bald abgelöst von einer „Ökonomie des Überflusses“, wie Timo Leukefeld in einem Beitrag für das Zukunftsinstitut schreibt. „Produkte und Dienstleistungen kosten immer weniger in einer Welt, in der 3D-Drucker ganze Häuser samt Einrichtung herstellen. Strom aus erneuerbaren Energien wird hierzulande in absehbarer Zeit nur noch etwa einen Cent pro Kilowattstunde kosten.“
Marktvolumen energieeffizienter Gebäude
Laut den Zahlen des Dienstleisters Statista wird sich das Marktvolumen für energieeffiziente Gebäude in den kommenden Jahren auf globaler Ebene mehr als verdoppeln. Lag es 2016 weltweit bei 133 Milliarden Euro, wird es laut Prognose im Jahr 2025 eine Größe von rund 312 Milliarden Euro betragen. Alleine in Deutschland wurden im Jahr 2018 rund zehn Milliarden Euro in nachhaltige Gebäude investiert.
Seine Vision von energieautarken Häusern sind Gebäude, die sich selbst mit Wärme versorgen und den notwendigen Strom für Haushaltsgeräte und Mobilität liefern. „Sie bauen dafür auf den kostenfreien und krisensicheren Rohstoff Sonne: Photovoltaikmodule und Solarthermiekollektoren teilen sich Dachflächen und Balkonbrüstungen. Langzeitspeicher halten Wärme und Strom für die Nutzer vor. Garagen und Parkplätze sind mit Elektro-Zapfsäulen ausgestattet“, so Leukefeld. Die Bilanz dieser Bauten berechnet er wie folgt: „Die Gebäude werden auf diese Art an die 70 bis 80 Prozent energieautark. Die Energiekosten für ein solches Gebäude liegen zudem etwa 70 Prozent unter denen eines Passivhauses.“ Trotz ihrer hohen energetischen Unabhängigkeit sollen die Gebäude nach Leukefelds Vorstellung Teil des öffentlichen Versorgungsnetzes bleiben – „in erster Linie, um ihre Elektro- und Wärmespeicher regionalen Energieversorgungsunternehmen zur Lagerung von Energieüberschüssen zur Verfügung zu stellen. Damit werden Häuser zu Energiezwischenspeichern: Überschüssiger Strom geht nicht verloren, Haushalte und Energieversorger profitieren, so Leukefeld. Ein Gebäude wechselt damit seine Rolle, es wandelt sich vom reinen Energieverbraucher zu einem smarten Nutzer.
Wertschöpfung im Bau auf dem Prüfstand
Für die Entwicklung solcher visionärer Häuser werden Bauingenieure benötigt, die sich nicht nur glänzend darauf verstehen, nachhaltig zu bauen. Ein Gebäude, das wie ein intelligenter Energieproduzent und Speicher funktioniert, benötigt eine Reihe Features, die von Vertretern verschiedener Disziplinen entwickelt werden müssen. Hier trifft das Know-how der Bauingenieure auf die Motivation von Architekten sowie das Wissen von IT-Spezialisten und Energetikern. Aber auch wirtschaftliche und vertragliche Expertisen sind wichtig, um Gebäude in diesem innovativen „Energie-Smart-Grids“ gewinnbringend zu platzieren. Auf diese Art finden laut Timo Leukefeld „Energieversorgungsunternehmen, Wohnungswirtschaft und Banken neue lukrative Geschäftsmodelle“. Und diese sind nötig in einer Wirtschaft, in der, wie der Experte voraussagt, die Kosten für den eigentlichen Bau deutlich zurückgehen werden, weil neue und enorm effiziente Techniken immer mehr Aufgaben übernehmen. Liegt der Experte richtig, wird auch in der Baubranche eine neue Art der Wertschöpfung entstehen.
Boot, Baum oder Tiny House?
Laut einer Studie des Baufinanz-Dienstleisters Interhyp gaben 53 Prozent der Befragten an, dass ihnen Energieeinsparung und Umweltschutz bei der Planung eines Baus sehr wichtig wären; für 34 Prozent ist das Thema immerhin wichtig. Nur rund vier Prozent der Befragten halten Umweltbelange bei der Hausplanung für nicht relevant. Offen zeigten sich die Teilnehmenden bei alternativen Wohnformen: 43 Prozent der Befragten können sich das Wohnen in einem Ökohaus vorstellen, 29 Prozent in einem Mehrgenerationenhaus. Kleinsthäuser – sogenannte Tiny Houses – kommen immerhin noch für 13 Prozent in Frage, den Bezug eines Baumhauses können sich 11 Prozent vorstellen, ein Hausboot liegt sogar bei 29 Prozent.
Betonrecycling vor Ort: Rezeptur gesucht
Aber egal, wie innovativ die neuen Häuser auch sein werden: Was die Umwelt weiter belasten wird, ist der Baubestand – und zwar auch dann, wenn er abgerissen wird. Denn während der Schutt energieaufwändig entsorgt wird, entstehen an anderer Stelle mit hohen Energiekosten und CO2-Emissionen Baustoffe für das neue Gebäude. Was wäre also naheliegender, als alte Baustoffe vor Ort in neue umzuwandeln: ein Recycling dort, wo das Material benötigt wird. Ein Forschungsprojekt der Hochschule für Angewandte Wissenschaften München entwickelt derzeit Rezepturen für eine solche Art von Recycling-Beton. Dabei ist innovatives Denken notwendig, weil die Regulierungen in Deutschland nur eine begrenzte Zumischung von grobkörnigem Recycling-Beton erlauben.
Wie sinnvoll sind diese Regelungen, wenn man den Einsatz des recycleten Betons auf bestimme Wände beschränkt? Und wie ändert sich die Belastbarkeit des Bauschutts, wenn man bestimmte Parameter der Rezeptur ändert? Diesen Fragen geht ein Forschungsteam um Andrea Kustermann nach. Die Professorin für Bauingenieurwesen glaubt, dass Recycling- Beton mit 100 Prozent wiederverwerteter Gesteinskörnung durchaus für neue Hochbau-Konstruktionen geeignet ist. „Man muss die Materialeigenschaften allerdings genau kennen, um beurteilen zu können, wo ein Werkstoff eingesetzt werden kann – es macht einen großen Unterschied, ob man eine Innenwand daraus baut, die kaum Frost ausgesetzt wird, oder eine Fassade“, so die Professorin. Noch läuft die Forschung. Das Team will aber schon bald die Genehmigung für den Einsatz des 100-prozentigen Recycling-Materials bei der Baubehörde beantragen –2020 sollen dann die ersten temporären Gebäude aus den Baustoffen entstehen, die beides sind: alt und neu.
Baubotanik: Technik im Verbund mit Pflanzen
Noch einen Schritt weiter geht Ferdinand Ludwig, Professor an der TU München und dort Begründer eines neuen Forschungsberichts namens Baubotanik. Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Bauwerken, die durch das Zusammenwirken „technischen Fügens und pflanzlichen Wachsens entstehen“, beschreibt Ludwig seinen Ansatz. „Dazu werden lebende und nicht-lebende Konstruktionselemente so miteinander verbunden, dass sie zu einer pflanzlich-technischen Verbundstruktur verwachsen: Einzelne Pflanzen verschmelzen zu einem neuen, größeren Gesamtorganismus, und technische Elemente wachsen in die pflanzliche Struktur ein.“ Dabei geben, so Ludwig, die funktionale wie gestalterische Integration von Pflanzen nicht nur Antworten auf die brennenden ökologischen Fragen unserer Zeit. „Sie stellt auch eine methodische Herausforderung dar, wie mit Aspekten von Wachsen und Vergehen, von Zufall und Wahrscheinlichkeit im Entwurf umgegangen werden kann.“
Auch hier zeigt sich, dass es für Bauingenieure in Zukunft verstärkt darum gehen wird, sehr weit zu denken: Die Bauvision für die kommenden Jahrzehnte steht auf vielen Säulen. Dabei geht es um nicht weniger als um Bauwerke, die nicht mehr Fremdkörper für die Umwelt sind, sondern das Ökosystem nicht stören – oder mehr noch: Es bereichern. An dieser Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft teilzuhaben, das ist für junge Bauingenieure zugleich Herausforderung und Chance.
Buchtipp
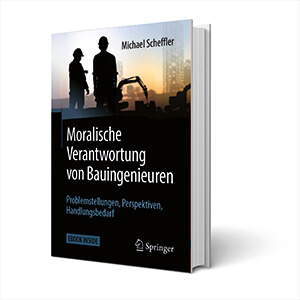 Moralische Verantwortung von Bauingenieuren
Moralische Verantwortung von Bauingenieuren
Dr. Michael Scheffler hat Bauingenieurwesen und Philosophie studiert. In seinem Buch „Moralische Verantwortung von Bauingenieuren“ erörtert er Grundsatzfragen des Handelns im Alltag von Bauingenieuren insbesondere im Hinblick auf den derzeitigen Stellenwert und die Wahrnehmung moralischer Verantwortung. Bestehende Störungen werden freigelegt, Problemstellungen diskutiert und vordringliche Handlungsbedarfe aufgezeigt. Michael Scheffler: Moralische Verantwortung von Bauingenieuren. Springer 2019, 18 Euro. (Werbelink)




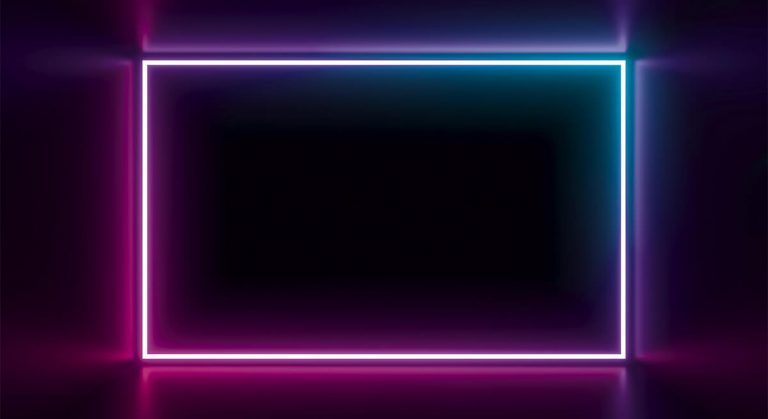
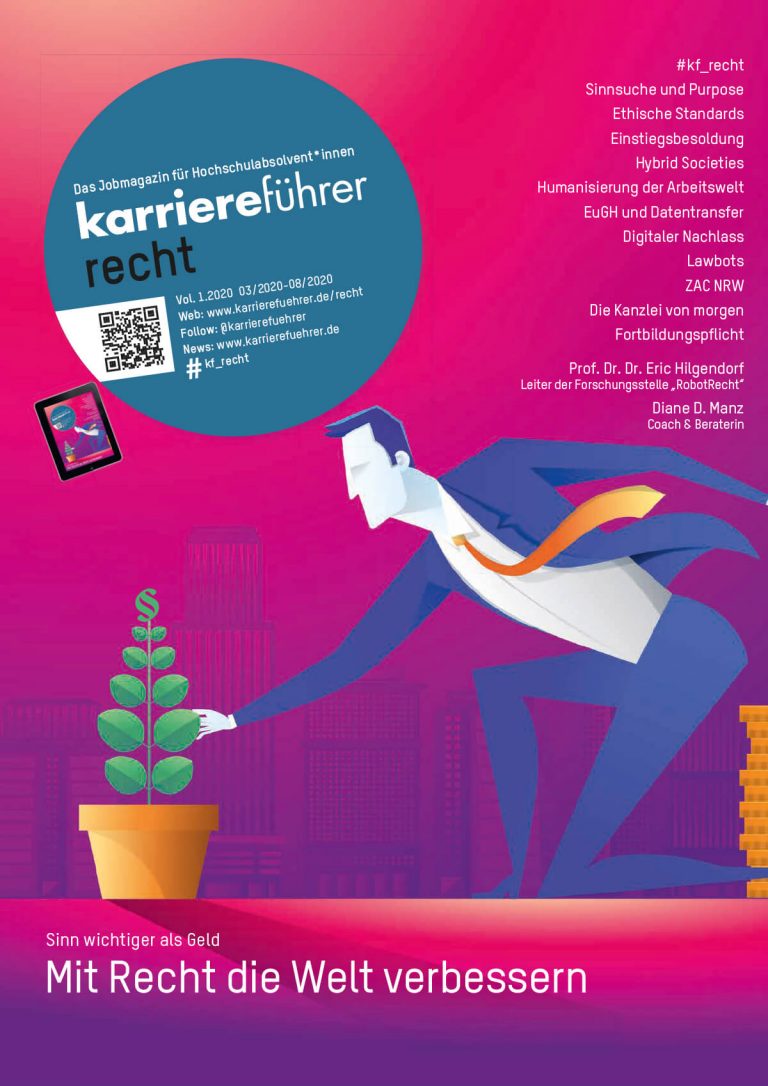
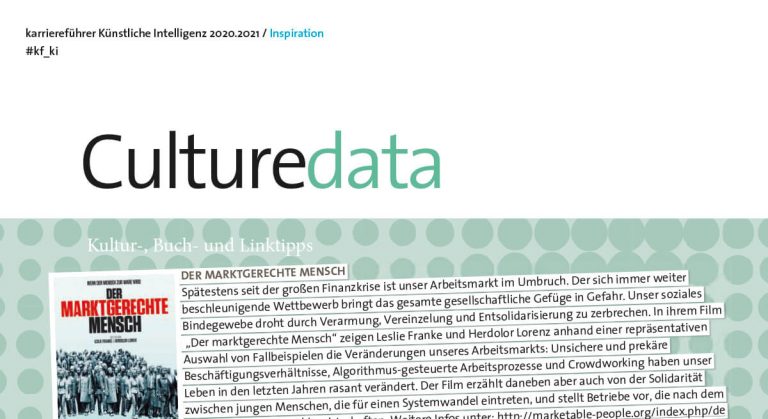
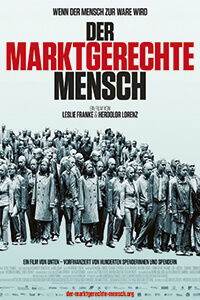 Spätestens seit der großen Finanzkrise ist unser Arbeitsmarkt im Umbruch. Der sich immer weiter beschleunigende Wettbewerb bringt das gesamte gesellschaftliche Gefüge in Gefahr. Unser soziales Bindegewebe droht durch Verarmung, Vereinzelung und Entsolidarisierung zu zerbrechen. In ihrem Film „Der marktgerechte Mensch“ zeigen Leslie Franke und Herdolor Lorenz anhand einer repräsentativen Auswahl von Fallbeispielen die Veränderungen unseres Arbeitsmarkts: Unsichere und prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Algorithmus-gesteuerte Arbeitsprozesse und Crowdworking haben unser Leben in den letzten Jahren rasant verändert. Der Film erzählt daneben aber auch von der Solidarität zwischen jungen Menschen, die für einen Systemwandel eintreten, und stellt Betriebe vor, die nach dem Prinzip des Gemeinwohls wirtschaften.
Spätestens seit der großen Finanzkrise ist unser Arbeitsmarkt im Umbruch. Der sich immer weiter beschleunigende Wettbewerb bringt das gesamte gesellschaftliche Gefüge in Gefahr. Unser soziales Bindegewebe droht durch Verarmung, Vereinzelung und Entsolidarisierung zu zerbrechen. In ihrem Film „Der marktgerechte Mensch“ zeigen Leslie Franke und Herdolor Lorenz anhand einer repräsentativen Auswahl von Fallbeispielen die Veränderungen unseres Arbeitsmarkts: Unsichere und prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Algorithmus-gesteuerte Arbeitsprozesse und Crowdworking haben unser Leben in den letzten Jahren rasant verändert. Der Film erzählt daneben aber auch von der Solidarität zwischen jungen Menschen, die für einen Systemwandel eintreten, und stellt Betriebe vor, die nach dem Prinzip des Gemeinwohls wirtschaften.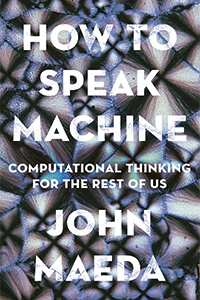 Der Designer und Technologe John Maeda definiert in seinem aktuellen Buch „How to speak machine“ die grundlegenden Gesetze, wie Computer denken, und warum man sich darum kümmern sollte, auch wenn man kein Programmierer ist. Er bietet eine Reihe einfacher Gesetze an, die nicht nur die Computer von heute, sondern auch die unvorstellbaren Maschinen der Zukunft regeln. Denn, so der Autor: Die Technologie ist bereits jetzt mächtiger, als wir uns vorstellen können, und sie wird in einem exponentiellen Tempo immer leistungsfähiger. Einmal in Bewegung gesetzt, werden die Algorithmen nie müde. Und wenn die Größe, Geschwindigkeit und Unermüdlichkeit eines Programms mit seiner Fähigkeit, zu lernen und sich selbst zu transformieren, kombiniert wird, kann das Ergebnis unvorhersehbar und gefährlich sein.
Der Designer und Technologe John Maeda definiert in seinem aktuellen Buch „How to speak machine“ die grundlegenden Gesetze, wie Computer denken, und warum man sich darum kümmern sollte, auch wenn man kein Programmierer ist. Er bietet eine Reihe einfacher Gesetze an, die nicht nur die Computer von heute, sondern auch die unvorstellbaren Maschinen der Zukunft regeln. Denn, so der Autor: Die Technologie ist bereits jetzt mächtiger, als wir uns vorstellen können, und sie wird in einem exponentiellen Tempo immer leistungsfähiger. Einmal in Bewegung gesetzt, werden die Algorithmen nie müde. Und wenn die Größe, Geschwindigkeit und Unermüdlichkeit eines Programms mit seiner Fähigkeit, zu lernen und sich selbst zu transformieren, kombiniert wird, kann das Ergebnis unvorhersehbar und gefährlich sein.
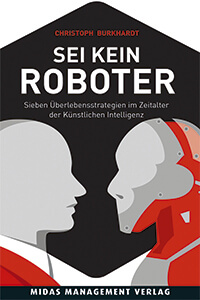 Werden smarte Maschinen lernen, sich wie Menschen zu verhalten? Werden Roboter den Großteil unserer Arbeit erledigen? Schaffen wir uns durch unseren Automatisierungswahn am Werden smarte Maschinen lernen, sich wie Menschen zu verhalten? Werden Roboter Ende selbst ab? Auf diese Fragen gibt der Innovationspsychologe und Silicon-Valley-Experte Christoph Burkhardt Antworten. „Viele smarte Maschinen verhalten sich schon heute sehr menschenähnlich. Aber die wirkliche Herausforderung liegt bei den Menschen, die sich zu sehr wie Maschinen verhalten“, sagt der in San Francisco lebende Autor. „Nur wer sich nicht wie ein Roboter verhält, wird auch nicht durch einen ersetzt.“
Werden smarte Maschinen lernen, sich wie Menschen zu verhalten? Werden Roboter den Großteil unserer Arbeit erledigen? Schaffen wir uns durch unseren Automatisierungswahn am Werden smarte Maschinen lernen, sich wie Menschen zu verhalten? Werden Roboter Ende selbst ab? Auf diese Fragen gibt der Innovationspsychologe und Silicon-Valley-Experte Christoph Burkhardt Antworten. „Viele smarte Maschinen verhalten sich schon heute sehr menschenähnlich. Aber die wirkliche Herausforderung liegt bei den Menschen, die sich zu sehr wie Maschinen verhalten“, sagt der in San Francisco lebende Autor. „Nur wer sich nicht wie ein Roboter verhält, wird auch nicht durch einen ersetzt.“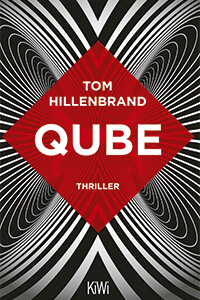 Investigativjournalist Calvary Doyle wird auf offener Straße niedergeschossen. Zuvor hatte der Reporter zum Thema Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf KI-Gefahrenabwehr spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt in dem Fall zu ermitteln. So besaß der Journalist anscheinend neue, beunruhigende Informationen über den berüchtigten Turing-Zwischenfall, bei dem die Menschheit die Kontrolle über eine KI verlor. Die KI befand sich seinerzeit in einem Quantencomputer, einem sogenannten Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen Würfel, mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und kann Fran Bittner den zweiten Qube finden, bevor jemand auf die Idee kommt, ihn zu aktivieren? Der Thriller von Spiegel-Bestseller-Autor Tom Hillenbrand führt uns an die Grenzen unserer Welt.
Investigativjournalist Calvary Doyle wird auf offener Straße niedergeschossen. Zuvor hatte der Reporter zum Thema Künstliche Intelligenz recherchiert. Die auf KI-Gefahrenabwehr spezialisierte UNO-Agentin Fran Bittner beginnt in dem Fall zu ermitteln. So besaß der Journalist anscheinend neue, beunruhigende Informationen über den berüchtigten Turing-Zwischenfall, bei dem die Menschheit die Kontrolle über eine KI verlor. Die KI befand sich seinerzeit in einem Quantencomputer, einem sogenannten Qube. Gibt es womöglich noch einen solchen Würfel, mit einer weiteren digitalen Superintelligenz darin? Und kann Fran Bittner den zweiten Qube finden, bevor jemand auf die Idee kommt, ihn zu aktivieren? Der Thriller von Spiegel-Bestseller-Autor Tom Hillenbrand führt uns an die Grenzen unserer Welt.






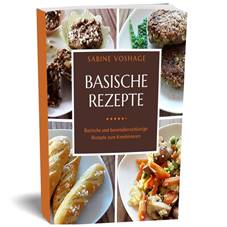
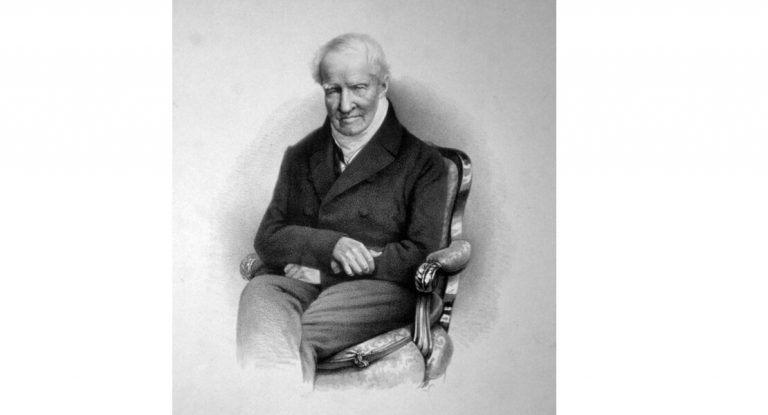




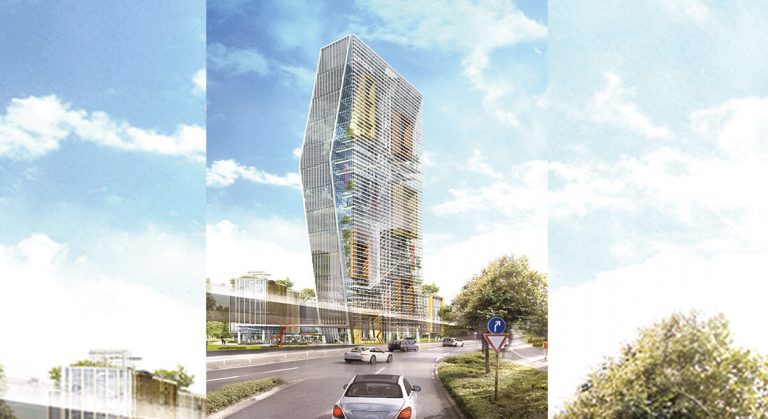
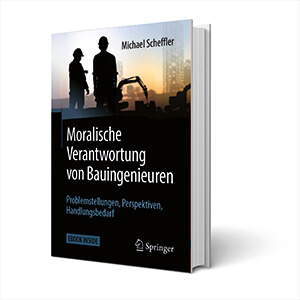 Moralische Verantwortung von Bauingenieuren
Moralische Verantwortung von Bauingenieuren