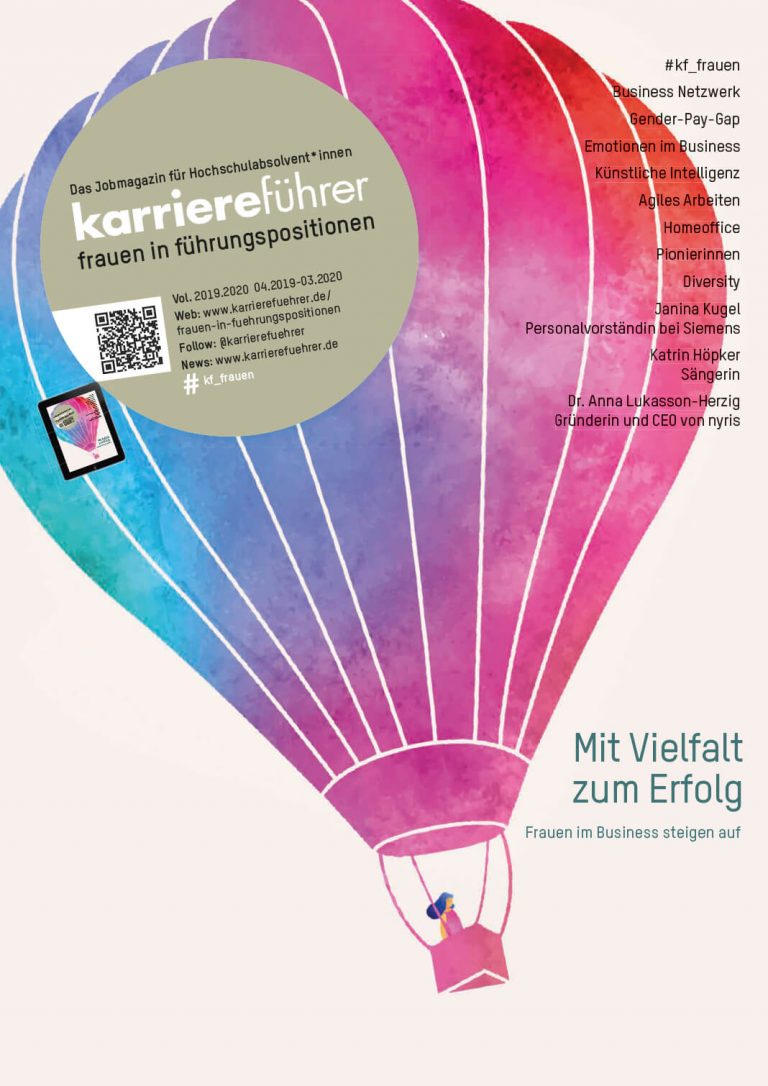Unter dem Begriff Integrated Industry entstehen neue Anlagen, in denen interdisziplinäres Know-how sowie digitale Themen wie Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) ganz neue Möglichkeiten schaffen. Das fängt an bei Pilotprojekten, bei denen Ingenieure mit Biologen kooperieren – und führt zu Ideen, das Ökosystem der Erde anhand einer technischen Plattform zu managen. von André Boße
In Aachen befinden sich drei Institute der Fraunhofer- Gesellschaft: das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT, das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT und das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME. Die drei Fachbereiche behandeln viele eigene Themen, doch die Möglichkeiten der Industrie 4.0 legen den Instituten nahe, dass es sinnvoll ist, gemeinsam an neuen Lösungen zu arbeiten. Und genau das passiert: „Vernetzte, adaptive Produktion“ ist der Name eines Leistungszentrums, in dem die Forscher und Ingenieure Produktionsanlagen und -systeme entwickeln, in denen sich das Know-how aller drei Institute widerspiegelt.
Klimawandel stoppen, Erde retten
Klimaschutz ist in aller Munde. Kaum ein Tag vergeht, an dem in den Medien nicht über drohende Szenarien berichtet wird. Viele Politiker geben sich allerdings unbeeindruckt: Deutschland gibt sich als Vorbild in Sachen Klimaschutz, unterläuft aber die eigenen Beschlüsse. Der US-Präsident Donald Trump steigt aus dem Klima abkommen aus. Zahlreiche Länder der Dritten Welt wiederholen die Fehler der Industriestaaten: Sie opfern Wälder und Naturräume einem unbedachten Fortschrittsglauben. Joachim Käppner, Redakteur und Autor der Süddeutschen Zeitung, ist jedoch überzeugt: Noch ist es nicht zu spät zur Rettung der Natur und unserer Lebensgrundlagen – wenn wir alle sofort umdenken und unser Handeln verändern. Sein Buch will den Weg dahin zeigen.
Joachim Käppner: Die letzte Chance für unsere Erde. Verlag Süddeutsche Zeitung 2018. 9,90 Euro 
Die Forscher – darunter auch Ingenieure – entwickeln hier Lösungsansätze, damit der Wandel zur Industrie 4.0 tatsächlich gelingen kann. Zusammen mit Forschern der RWTH Aachen und Partnern aus der Industrie arbeitet das Fraunhofer- Leistungszentrum an neuen Produktionssystemen und Wertschöpfungsketten. Ob die Theorie auch wirklich funktioniert, wird anhand von konkreten Fertigungen validiert. Das Aachener Projekt läuft seit Ende 2016 und startete mit einem stattlichen Budget in Höhe von 6,4 Millionen Euro.
Aufgabe des Leistungszentrums sei es, in einem Zeitraum von drei Jahren eine offene Forschungsplattform und Testumgebung für die Industrie zu entwerfen, in der neue Konzepte einer digitalisierten Produktion erforscht und praxisnah erprobt werden können, heißt es in der Broschüre zum Projekt. Leistungsstarke Partner aus dem Umfeld von IT-Systemanbietern, Anlagenherstellern und produzierenden Unternehmen hätten bereits ihre Mitarbeit für die weitere Zusammenarbeit zugesagt – was zeigt, dass dieses Leistungszentrum die Grenzen zwischen Ingenieurwesen und IT einreißt. Und genau dieses offene Denken ist gefragt: Je weiter die Realisierung der Ideen und Methoden der Industrie 4.0 voranschreitet, desto enger verzahnen sich die beiden Bereiche. Wobei wichtig ist, dass die Kollaborationen auf Augenhöhe passieren: Weder müssen Ingenieure plötzlich komplett wie IT-Spezialisten ticken, noch dürfen sie verlangen, dass die Digitalexperten ein Grundlagenstudium für Maschinen- und Anlagenbau abschließen.
Da alle Daten aus der Produktion von den Sensoren aufgezeichnet und individuell für jedes Produkt gespeichert werden, entsteht von jedem Produkt ein ‚digitaler Zwilling‘.
Der Gewinn entsteht gerade dadurch, dass beide Gruppen ihre Expertise und ihre Denkweisen einbringen. Was jedoch nötig ist, ist eine Offenheit für den jeweils anderen Bereich und seine Themen und Möglichkeiten. So dürfen die Ingenieure KI- und Cloud-Methoden nicht ablehnen, nur weil sie auf den ersten Blick keine Anwendungsmöglichkeiten erkennen. Auf der anderen Seite stehen sie vor der Aufgabe, den IT-Leuten klarzumachen, dass digitale Lösungen in der Industrie eben nicht nur in virtuellen Räumen benötigt werden, sondern mit tatsächlichen Maschinen zu tun haben, die tatsächliche Dinge tun. (Mehr zu diesem Thema im Top-Interview mit Prof. Dr. Martin Ruskowski)
Digitalisierung in der Produktion
Zurück nach Aachen ins multidisziplinäre Leistungszentrum: Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten finden dort in mehreren „Pilotlinien“ statt: In einer geht es um die Fertigung von Bauteilen für Turbinen für die Luftfahrt und die Energiegewinnung, eine andere setzt auf Pflanzen zur Gewinnung von Medikamenten, und weitere befassen sich mit der Produktion von Batteriemodulen für Elektroautos und mit dem Werkzeugbau. „Allen gemeinsam ist, dass wir damit die Digitalisierung und Vernetzung in die reale Fertigungsumgebung bringen“, sagt Professor Dr. Thomas Bergs, Direktor des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT und Lehrstuhlinhaber am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen. „Wir statten die Anlagen mit zahlreichen Sensoren aus, die permanent Messdaten aus den Maschinen an eine zentrale Datenbank senden – und zwar kabellos, zum Beispiel über den kommenden Mobilfunkstandard 5G.“
Geoengineering: Eingriff in die Natur
Je weniger Erfolg die Menschen haben, den Klimawandel abzumildern, desto intensiver wird über die Möglichkeit technischer Eingriffe diskutiert, die das Klima beeinflussen. Die Experten vom Max-Planck-Institut für Meteorologie unterscheiden zwei Methoden: „Carbon dioxide removal techniques“ (CDR) soll CO2 aus der Atmosphäre entfernen; solares Strahlungsmanagement (SRM) reflektiert solare Strahlung zurück in den Weltraum, womit der Erwärmung durch die Treibhausgase entgegengewirkt werden soll. Experten warnen, dass diese Eingriffe weitreichende und nicht absehbare andere Folgen haben können, weshalb erste Experimente nur am Computer vorgenommen werden. Quelle: www.mpimet.mpg.de/mitarbeiter/ulrike-niemeier/geoengineering/
Bei der Herstellung der Turbinenbauteile für Flugzeugantriebe komme es zum Beispiel auf Präzision und Sicherheit an. In der Produktion werden die Schaufeln heute vielfach mit Werkzeugmaschinen aus einem massiven Titanblock gefräst. Dabei können Schwingungen entstehen, die bei der Bearbeitung zu Ungenauigkeiten führen. In der Pilotanlage, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer IPT, wurden deshalb Senso ren installiert, um die Schwingungen von Hundertstel Millimetern innerhalb weniger Millisekunden präzise aufzunehmen.
Bei der Pilotanlage, in der unter kontrollierten Bedingungen Pflanzen gesät, aufgezogen und biochemisch verändert werden, sodass sie Medikamente produzieren, überwachen andere Sensoren wiederum das Pflanzenwachstum. Ziel dabei sei es, Qualitäten und Größen der Pflanzen durch Bildanalysealgorithmen und Big-Data-Verfahren bewerten zu können, um optimale Bedingungen für die Produktion der Wirkstoffe in den Pflanzen zu schaffen. Die enormen Datenmengen, die in den verschiedenen Produktionsprozessen entstehen, sollen, zum Teil über das 5G-Netz, in eine gesicherte Cloud mit dem Namen „Virtual Fort Knox“ fließen. „Erst die drahtlose Datenübertragung mit 5G in die Cloud schafft die Voraussetzungen, um durch schnelle Anpassung der Maschine solche Schwingungen zu verhindern, noch bevor sie auftreten“, so Bergs. Und noch eine Besonderheit bietet das Leistungszentrum: Da alle Daten aus der Produktion von den Sensoren aufgezeichnet und individuell für jedes Produkt gespeichert werden, entsteht von jedem Produkt ein „digitaler Zwilling“ – also eine virtuelle Version des echten Produkts, die jedoch die gesamte Produktionshistorie enthält. „Mithilfe des digitalen Zwillings einer Produktionsstufe können wir die Zeit quasi zurückdrehen und genau feststellen, wann und an welcher Stelle ein Fehler passiert ist“, sagt Mario Pothen, Projektleiter beim Fraunhofer IPT. Treten also Schäden auf, könne man im Prozess „zurückblättern“ und den Daten entnehmen, wo der Fehler entstanden ist, um den Prozess zu optimieren.
Integrated Industry
Das Leistungszentrum „Vernetzte, adaptive Produktion“ zeigt zweierlei: Erstens kommen jetzt als Piloten Anlagen in die Praxis, die das Versprechen der Industrie 4.0 einhalten, weil sie die industrielle Produktion tatsächlich intelligenter machen. Zweitens entstehen diese Entwicklungen in Teams und mit thematischen Zusammenhängen, die alle üblichen Rahmen sprengen. Die „Integraded Industry“ wird Wirklichkeit, weil sich Techniken vernetzen, synchronisieren und in der Produktion eingesetzt werden. Beim Frä sen riesiger Turbinen zum Beispiel kommt es auf minimale Schwingungen an. Die eingesetzten Sensoren ähneln denen, die auch das Wachstum von Pflanzen überwachen. Auch Cloud, Datenübertragungswege und Analysetools ähneln sich: Durch die angewandte Industrie 4.0 rücken die Ingenieure verschiedener Fachbereiche enger zusammen und arbeiten daher mit Experten aus ganz anderen Bereichen zusammen – insbesondere mit IT-Spezialisten. Das Beispiel des „digitalen Zwillings“ ist ein perfektes Sinnbild für diese Synergien: Dieses virtuelle Produkt ist kein Selbstzweck – sinnvoll ist es nur dann, wenn es dabei hilft, das tatsächliche Produkt zu optimieren. Reale und digitale Anlagen werden also in Bezug gesetzt. Wobei diese Bezüge im besten Fall von einer Instanz mitorganisiert wird, die im Kern dieser Entwicklungen steht: der künstlichen Intelligenz.
Während die autonom handelnde künstliche Intelligenz kritisch hinterfragt wird, bietet die ‚Augmented Intelligence‘ Ingenieuren eine Reihe von Chancen.
Von automatisiert bis autonom
Das Spektrum möglicher Einsätze der künstlichen Intelligenz zeigt aktuell vier Möglichkeiten, die die Unternehmensberatung PwC in der Studie „Fourth Industrial Revolution for the Earth“ wie folgt zusammengefasst hat: Die „Automated Intelligence“ übernimmt sich wiederholende Tätigkeiten, die dennoch eine Form von Intelligenz benötigen. Dazu zählt zum Beispiel ein Roboter, der lernt, in einer Fabrik die Abfälle zu sortieren. „Assisted Intelligence“ ist ein System, das riesige Datenmengen nach Auffälligkeiten durchforstet – und zwar viel schneller, als ein Mensch es je könnte. Systeme mit „Augmented Ingelligence“ gehen einen Schritt weiter, weil sie in der Lage sind, nach einer Datenvorgabe von Menschen in einer „augmented“ (auf Deutsch: „erweiterten“) Realität Szenarien von morgen zu entwerfen, und uns dabei helfen, einen Eindruck von der ungewissen Zukunft zu erhalten. „Autonomous Intelligence“ schließlich ist ein System, das ohne menschliches Dazutun Entscheidungen trifft und vollzieht.
Mission Weltenrettung
Während diese autonom handelnde KI kritisch hinterfragt wird, bietet die „Augmented Intelligence“ Ingenieuren eine Reihe von Chancen. Der „digitale Zwilling“ eines technischen Gegenstands aus der Produktion ist eine davon, jedoch denken einige Ingenieure schon viel weiter. Bräuchte man nicht eigentlich einen „digitalen Zwilling“ unserer Erde? Im genannten PwC-Report entwerfen die Autoren die Vision einer virtuellen Version unserer Welt, mit der sich in Echtzeit alle Ökosysteme beobachten, modellieren und managen lassen. Auf dieser Plattform würde eine riesige Menge Daten verarbeitet werden, man müsste sie transparent gestalten und in der Anwendung einfach halten. Und: Ihr zugrunde liegen müsste eine Kollaboration von Unternehmen, IT-Experten, Ingenieuren, Regierungen und Organisationen. Kurz: Das Ziel ist eine „Integrated Weltenrettung“.
Industrie 4.0: Unternehmen erhöhen Investitionen
Laut einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young von Anfang 2019 verstärken deutsche Unternehmen ihre Anstrengungen zur Vernetzung der Produktion und Digitalisierung ihres Geschäftsmodells deutlich: So wollen acht von zehn Unternehmen im kommenden Jahr mehr in Industrie 4.0 investieren. Dazu zählen beispielsweise Investitionen in die Vernetzung von Maschinen, in digitale Abbilder oder ins Cloud Computing. Die größten Hindernisse bei der Einführung : 62 Prozent der Unternehmen können die nötigen Investitionen nicht stemmen, 54 Prozent haben zu wenig qualifiziertes Personal.
Ingenieure hätten hier die Aufgabe, zusammen mit KI-Spezialisten Probleme zu erkennen und Lösungen zu entwickeln. „Wenn wir künstliche Intelligenz richtig einbinden, können wir damit eine Revolution in puncto Nachhaltigkeit erreichen. Künstliche Intelligenz wird der Motor der Vierten Industriellen Revolution sein“, sagt Hendrik Fink, Partner und Leiter Sustainability Services bei PwC. Dabei sei es wichtig, dass die Risiken dieser KI-gestützten Kooperationen bedacht werden. Dazu zählen laut des Reports nicht nur wirtschaftliche Risi ken, sondern insbesondere auch Sicherheits- und Kontrollrisiken, beispielsweise die Frage, wie sich die Systeme vor unerlaubten Zugriffen schützen lassen. Auch ethische und soziale Fragestellungen seien mit der KI verbunden. Fink: „Alle Stakeholder sollten eng zusammenarbeiten, um für Sicherheit und Transparenz zu sorgen. Nur wenn sie Vertrauen in der Gesellschaft schaffen, kann KI gewinnbringend zur Rettung unseres Planeten eingesetzt werden“, so Fink.
Vom Artenschutz bis zur sicheren Infrastruktur
Der Report des Beratungsunternehmens zeigt sechs Handlungsfelder, deren Unterpunkte belegen, wie groß die Rolle der Ingenieure sein wird, wenn es um nicht weniger geht als darum, die Zukunft des Menschen auf dieser Erde zu sichern. An erster Stelle steht der Klimawandel, der abgemildert werden muss – von Bedeutung sind hier Bereiche wie Erneuerbare Energien, neue Mobilitätslösungen, nachhaltige Produktionsmethoden sowie smarte Städte und Häuser. Beim zweiten Thema „Biologische Vielfalt und Artenschutz“ sind Ingenieure gefragt, um Verschmutzungen zu kontrollieren und eine „Grüne Ökonomie“ zu etablieren. „Gesunde Meere“ lenkt den Blick auf die Ozeane, wo die Bekämpfung und Verhütung von Verschmutzung, insbesondere durch Plastik, eine große Rolle spielt. Beim Thema „Gewässerschutz“ geht um neue Techniken, um die wachsende Weltbevölkerung mit Trinkwasser zu versorgen. Gefragt sind hier auch Vorsorgestrategien mit Blick auf Dürren, die uns bevorstehen werden. Das Thema „Luftreinhaltung“ nennt neue Filter- und Frühwarnsysteme sowie die Entwicklung sauberer Kraftstoffe als Kernaufgaben. Beim sechsten Thema „Unwetter- und Katastrophenvorsorge“ geht es unter anderem darum, eine widerstandsfähige Infrastruktur gegen Stürme und Fluten zu entwickeln.
Von kleinsten Sensoren für die Analyse von Schwingungen bis zur Konstruktion großer Dämme – die Herausforderungen, auf die Ingenieure in den kommenden Jahren treffen werden, sind an Vielfalt kaum zu überbieten. Dementsprechend offen müssen Einsteiger sein. Sie müssen sich bewusst werden, dass das Feinjustieren von kleinen Schrauben große Auswirkungen haben kann. Und dass sie bei diesen Prozessen von KI-Systemen begleitet werden, die mal automatisiert helfen, mal neue Szenarien entwerfen – aber auch im Zusammenspiel mit Informatikern so programmiert werden, dass sie Aufgaben autonom übernehmen, ohne dass dadurch ein Risiko des Kontrollverlusts entsteht.
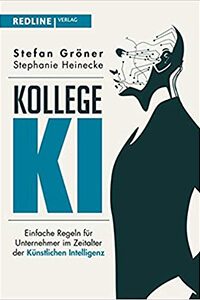 Buchtipp: „Kollege KI“
Buchtipp: „Kollege KI“
Der Einsatz von KI-Methoden in der Produktion macht sich bezahlt, wenn er glückt. Die Autoren Stefan Gröner und Stephanie Heinecke befürchten jedoch, dass viele Unternehmen noch immer in einer Art „Schockstarre“ stecken, weil sie nicht wissen, was wirklich auf sie zukommt, sollte die künstliche Intelligenz Einzug erhalten. Ihr Buch „Kollege KI: Künstliche Intelligenz verstehen und sinnvoll im Unternehmen einsetzen“ ist als Einführung gedacht, um Chancen aufzuzeigen und Risiken zu erklären. Es eignet sich auch für Einsteiger in den Ingenieurberuf, die wissen wollen, welche KI-Szenarien in den Unternehmen möglich sind. Stefan Gröner und Stephanie Heinecke: Kollege KI. Künstliche Intelligenz verstehen und sinnvoll im Unternehmen einsetzen. Redline Verlag 2019. 19,99 Euro 








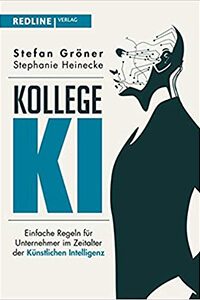 Buchtipp: „Kollege KI“
Buchtipp: „Kollege KI“



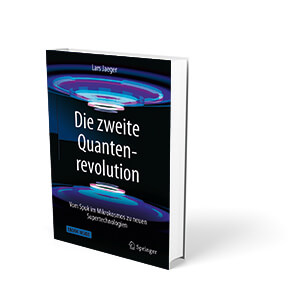 Buchtipp
Buchtipp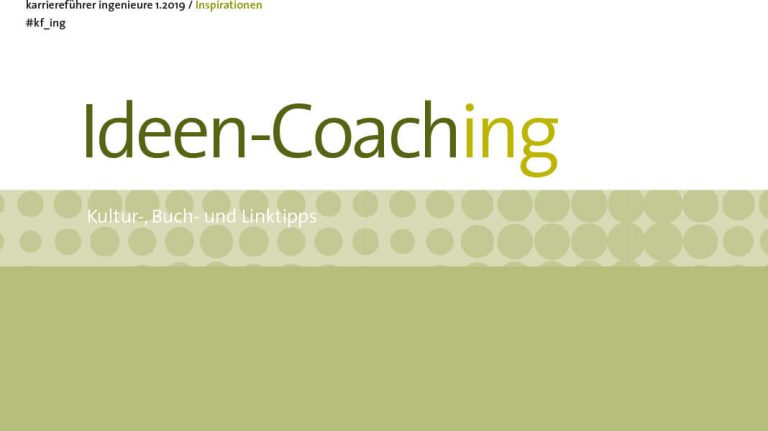


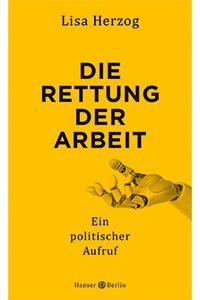 Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Künstliche Intelligenzen und Roboter übernehmen schon jetzt immer mehr Aufgaben und sorgen für Existenzängste, die in die Hände von Populisten spielen. Dabei sollten wir die Zukunft der Arbeit nicht dem Markt überlassen – sie ist eine Frage der politischen Gestaltung, die gerade jetzt couragiert beantwortet werden kann. Arbeit hält Gesellschaften zusammen, sie ist etwas fundamental Menschliches. Lisa Herzog, Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München, zeigt, wie sie in digitalen Zeiten gerechter und demokratischer werden kann, als sie es je war – für alle, nicht nur für wenige Privilegierte. Ihr Buch gibt neue Antworten auf eine der großen Fragen unserer Zeit und gibt wichtige Impulse für eine bessere Politik.
Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Künstliche Intelligenzen und Roboter übernehmen schon jetzt immer mehr Aufgaben und sorgen für Existenzängste, die in die Hände von Populisten spielen. Dabei sollten wir die Zukunft der Arbeit nicht dem Markt überlassen – sie ist eine Frage der politischen Gestaltung, die gerade jetzt couragiert beantwortet werden kann. Arbeit hält Gesellschaften zusammen, sie ist etwas fundamental Menschliches. Lisa Herzog, Professorin für Politische Philosophie und Theorie an der Hochschule für Politik an der Technischen Universität München, zeigt, wie sie in digitalen Zeiten gerechter und demokratischer werden kann, als sie es je war – für alle, nicht nur für wenige Privilegierte. Ihr Buch gibt neue Antworten auf eine der großen Fragen unserer Zeit und gibt wichtige Impulse für eine bessere Politik.