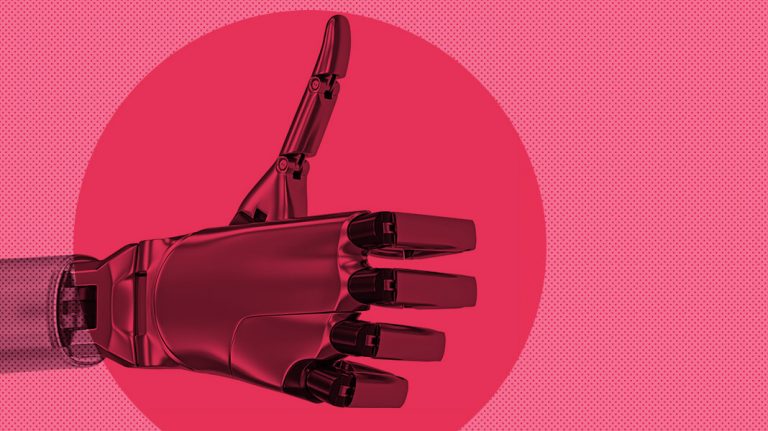Künstliche Intelligenz, vernetzte Daten und Big Data als DiagnoseTool: Das Potenzial der digitalisierten Transformation ist enorm. Genutzt wird es in Deutschland sehr selten, Hürden sind der Datenschutz oder eine konservative Sicht auf den Ärzteberuf. Experten sagen: Das muss sich ändern. Denn die Zukunft der Medizin werde so oder so digital sein. Zu groß sind die Vorteile für die Patienten und das gesamte Gesundheitssystem. Ein Essay von André Boße
Wie sieht sie aus, die Zukunft der Medizin? Wer im Jahr 2019 eine Arztpraxis betritt oder die Notaufnahme in einem Krankenhaus besuchen muss, wird zunächst einmal feststellen: Die Gegenwart unterscheidet sich in vielen Fällen nur wenig von der Vergangenheit. Natürlich gibt es in jedem Behandlungszimmer einen Computer, wenn auch häufig ein recht altes Modell. Selbstverständlich erfolgen Datenerfassung und Rezeptausgabe größtenteils digital. Doch von einer digitalen Revolution, wie sie andere Bereiche erfasst, ist wenig zu spüren.
Datenschutz vs. Digitalisierung der Medizin
Woran liegt das? Prof. Dr. Erwin Böttinger ist Mediziner und Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut, einer Denkfabrik in Potsdam, die sich den Prozessen der digitalen Transformation widmet. Zusammen mit dem Arzt Jasper zu Putlitz hat er das Buch „Die Zukunft der Medizin“ herausgegeben, eine Sammlung von neuen Ansätzen für ein digitales Gesundheitssystem und innovative medizinische Techniken. Im Gespräch macht Erwin Böttinger deutlich, warum sich Deutschland im Gesundheitswesen mit der Digitalisierung so schwertut:
Digitalisierung: Politischer Druck
Apps auf Rezept, Online-Sprechstunden einfach nutzen und überall bei Behandlungen auf das sichere Datennetz im Gesundheitswesen zugreifen – das sind die Ziele eines „Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation“, das das Bundeskabinett am 10. Juli 2019 beschlossen hat. Auch bei der Einführung der elektronischen Krankenakte geht es voran: Apotheken (bis 2020) und Krankenhäuser (bis 2021) sind nun verpflichtet, sich an die dafür notwenige Telematikinfrastruktur anzuschließen. Arbeit steht mit Blick auf den Datenschutz an: Die derzeit gültigen Regulierungen zur elektronischen Krankenakte haben bereits 15 Jahre auf dem Buckel. Ein Update in Form eines neuen Datenschutzgesetzes ist nötig. Dennoch: Zum 1.1.2021 soll die elektronische Krankenakte in Deutschland eingeführt werden.
„In der Bundesrepublik gibt es einen speziellen Umgang mit Daten zu den Themen Gesundheit und Medizin. Diese besitzen eine Sonderstellung, gelten als unbedingt schützenswert. Ja, diese Daten sind sensibel. Jedoch führt diese Vorsicht dazu, dass die Digitalisierung der Medizin und des Gesundheitssystems arg ins Stocken geraten ist. Und darunter leiden die Patienten, die nicht von einer verbesserten Versorgung profitieren können.“
Im Sinne des Patienten wäre es, wenn das gesamte System einen Paradigmenwechsel erfährt: „Wir müssen weg von der standesberuflich dominierten und krankheitsorientierten Medizin, hin zu einer kundenzentrierten und personalisierten Medizin, die sich als Dienstleisterin für die Patienten versteht. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass die Ärzte denken, sie wüssten am besten, was gut für den Patienten ist, während dieser selbst häufig im Dunkeln tappt.“
Wann kommt die elektronische Krankenakte?
Dementsprechend fordert Erwin Böttinger eine „bürgerzentrierte Demokratisierung“ im Gesundheitswesen. Grundlage dafür seien insbesondere elektronische Patientenakten, die systematisch Daten zur Gesundheit und klinischen Versorgung von Patienten in digitalem Format sammeln: Daten wie Alter, Gewicht und weitere demografische Merkmale, dazu Informationen über verabreichte Medikamente und Allergien, den Impfstatus und Laborwerte, Vitalfunktionen und abrechnungsrelevante Informationen. Während solche digitalen Akten in vielen Ländern wie den USA langsam, aber sicher zu Standards werden, hängt Deutschland hinterher. Immerhin hat das Bundesgesundheitsministerium 2021 als Startjahr für das Projekt festgelegt (siehe Kasten).
Künstliche Intelligenz ist die Schlüsseltechnologie der Zukunft – gerade im Bereich Gesundheit.
Doch noch lagern laut Böttinger in Deutschland die Daten weiterhin in „Gesundheitsdatensilos“, die kaum vernetzt oder überhaupt vernetzbar seien: „In der Regel werden Gesundheitsdaten in der klinischen Versorgung in Krankenhaus oder Praxisinformationssystemen lokal am Ort der Gesundheitsdienstleistung auf sogenannten ‚On-premise‘-IT-Infrastrukturen vorgehalten.“ Diese „Silos“ sorgen dafür, dass digitale Zukunftstechniken zwar ihr Potenzial andeuten, aber noch kaum einsetzbar sind.
KI: Großes Potenzial liegt brach
Ein Beispiel dafür ist die Künstliche Intelligenz – kurz KI. Diese ist „die Schlüsseltechnologie der Zukunft – gerade im Bereich Gesundheit“, heißt es in einer Studie des Beratungsunternehmens PwC über „Die Revolution der Medizin“. KI könne dazu beitragen, Krankheiten früher zu erkennen, Menschen besser zu versorgen und die Gesundheitsausgaben allein in Europa in den kommenden zehn Jahren um einen dreistelligen Milliardenbetrag zu senken. Eingesetzt werden können zum Beispiel bildgebende Verfahren: „Maschinelles Lernen kann den Arzt bei der Auswertung etwa von Röntgenbildern unterstützen und sorgt so für präzisere Diagnosen.“ Technologien wie „Natural Language Processing“ sind in der Lage, Sprache zu erfassen und auf Basis von Algorithmen zu verarbeiten. „Sie helfen dem Arzt so, Entscheidungen zu treffen“, heißt es in der Studie.
KI erkennt Hautkrebs zuverlässiger
Forscher des Nationalen Centrums für Krebserkrankungen in Heidelberg (NTC) sowie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) wollten im Rahmen einer Studie herausfinden, wer ein Melanom zuverlässiger von einem harmlosen Muttermal unterscheiden kann: renommiere Ärzte oder ein von Data-Experten und Forschern entwickelter Algorithmus. Nur sieben der insgesamt 157 beteiligten Dermatologen schnitten besser ab als der Computer, 136 kamen auf schlechtere Ergebnisse. Zwar sei das Beispiel unterkomplex und werde den tatsächlichen Herausforderungen in der Praxis nicht gerecht, jedoch zeige das Ergebnis, dass Algorithmen die „klinische Beurteilung von Hauttumoren sinnvoll ergänzen können“, sagt Jochen Sven Utikal, Leiter der Klinischen Kooperationseinheit des DKFZ.
Hinzu kommen sogenannte „Wearables“: „Bislang vor allem als Fitness-Tracker eingesetzt entwickeln sie sich zum medizinischen Instrument, etwa zur Selbstüberwachung von Werten bei chronischen Krankheiten.“ KI bietet in der Medizin also großen Mehrwert, doch bis es soweit ist, dass man diesen nutzen kann, sei der Weg steinig. Denn Künstliche Intelligenz basiert eben auf der Basis von großen Datenbeständen – und diese müssen zunächst einmal aufgebaut werden, was mit den Informationen in „Silos“ kaum möglich ist. Damit sich dies ändert, müssten daher schnell regulatorische Fragestellungen, etwa im Bereich Datenschutz, geklärt werden, fordern die Studienautoren. Dieses noch zu überwindende Hindernis ist vermutlich auch der Hauptgrund, warum laut PwC-Studie 64 Prozent der deutschen Entscheider in der Gesundheitswirtschaft zwar die Veränderungskraft von KI erkennen, aber erst 30 Prozent konkrete Schritte eingeleitet haben.
Arztprofil von morgen: Menschen führen, innovativ denken
Wie aber kann es gelingen, bei diesem Thema voranzukommen? Die Studie fordert, das Vertrauen von Ärzten in die Künstliche Intelligenz zu stärken, auch vor dem Hintergrund, dass KI überall dort, wo sie sich etabliert, die Arbeitsumfelder verändert. „Künstliche Intelligenz wird Stellen im Gesundheitswesen nicht ersetzen, aber die Stellenprofile stark verändern“, schreiben die Autoren der PwC-Studie. „Das spüren vor allem die Mitarbeiter, die sich mit der Diagnostik von Krankheiten wie Krebs und Erkrankungen aus den Fachrichtungen Neurologie und Kardiologie beschäftigen.“ Von Ärzten verlange das ein hohes Vertrauen in das intelligente Diagnosewerkzeug. „KI belohnt sie aber mit kürzeren Wartezeiten auf das Ergebnis und mehr Zeit für den einzelnen Patienten. Routineabläufe können im Gesundheitswesen künftig an lernende Computersysteme delegiert werden, während bei Mitarbeitern vor allem die Fähigkeiten gefragt sein werden, die menschliche Intelligenz erfordern: Probleme lösen, Menschen führen, Innovationen schaffen.“
Bleibt die Frage, ob die Patienten bereit sind, KI-Techniken einzusetzen oder einsetzen zu lassen – gerade beim so sensiblen Thema Gesundheit. Auch hier fragte die PwC-Studie nach und kam zu dem Ergebnis, dass „gut die Hälfte der Versicherten künftig bereit wäre, sich auf Künstliche Intelligenz in der Medizin einzulassen, knapp die Hälfte kann sich vorstellen, kleinere Eingriffe durch einen Roboter durchführen zu lassen.“ Die Bereitschaft hänge allerdings stark davon ab, wie genau und wie schnell Diagnose- und Therapieinstrumente arbeiteten. In der Akzeptanz sei zudem ein deutlicher Unterschied zwischen den Industriestaaten und Schwellenländern festzustellen: „Während Menschen in ärmeren Ländern offener für Roboter und maschinelles Lernen sind, zeigen Versicherte in reichen Ländern mit einem hoch entwickelten Gesundheitssystem mehr Skepsis.“ Umso wichtiger sei es, in Deutschland einen kontinuierlichen Austausch mit der Öffentlichkeit zu pflegen und diese von den Mehrwerten zu überzeugen – wobei es bedeutsam ist, Fragen der Ethik, der Regulierung und des Datenschutzes von Beginn an mitzudenken.
Neue Erkenntnisse in der Molekularbiologie sorgen dafür, dass Ärzte und Forscher heute viel mehr über die Entstehung von Krankheiten wissen. In den Operationssälen bieten Roboter ganz neue Möglichkeiten chirurgischer Eingriffe.
Medizin steckt voller digitaler Dynamik
Eines steht für Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Center am Hasso-Plattner-Institut, fest: Eine Medizin ohne digitalen Wandel wird den Anschluss verlieren: „Wir beobachten, dass gerade in allen medizinischen Bereichen enorme Fortschritte gemacht werden, in der Organisation des Gesundheitssystems genauso wie in der Forschung oder den verschiedenen Therapieansätzen.“ So sorgen neue Erkenntnisse in der Molekularbiologie dafür, dass Ärzte und Forscher heute viel mehr über die Entstehung von Krankheiten wissen. In den Operationssälen bieten Roboter ganz neue Möglichkeiten chirurgischer Eingriffe. „In der Medizin steckt sehr viel Dynamik“, sagt Böttinger. „Das alles stimmt mich optimistisch, dass es bei Krankheiten wie Alzheimer und Demenz, bei Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu wesentlichen Durchbrüchen kommen kann.“ Grundlage für diese medizinischen Fortschritte seien ebenfalls Techniken wie Künstliche Intelligenz mit ihren Deep-Learning-Verfahren, Big Data oder Robotik. „Umso wichtiger ist es, dass wir in Deutschland verstehen, dass wir uns derzeit wegen unserer übermäßigen Vorsicht beim Thema Datenschutz bewusst vom globalen Fortschritt abkoppeln“, sagt Böttinger.
Buchtipp
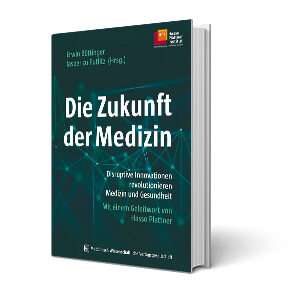 Die Zukunft der Medizin
Die Zukunft der Medizin
Der von Erwin Böttinger und Jasper zu Putlitz herausgegebene Band versteht sich als Standardwerk zu Innovationen, die Medizin und Gesundheitssystem revolutionieren. Autoren aus den Bereichen Digital und Medizin stellen in Fachbeiträgen neue Techniken vor, darunter medizinische Ansätze wie Operationen mit Genomen, Nanosystemen für die personalisierte Medizin oder Roboter-Gehhilfen. Auch auf die Informations- und Datentechnologien, die die Data-Organisation der Medizin revolutionieren sollen, werden vorgestellt.
Erwin Böttinger, Jasper zu Putlitz (Hrsg.): Die Zukunft der Medizin. Disruptive Innovationen revolutionieren Medizin und Gesundheit. ISBN-13: 978-3954663989 (Werbelink)
Am Ende der Entwicklung könnte ein neues Berufsbild des Arztes entstehen: Man geht häufig nicht mehr nur zu ihm, wenn man krank ist, sondern sucht ihn regelmäßig auf, um mit ihm gemeinsam und auf Grundlage einer Vielzahl von Daten darüber zu beraten, wie man gesund bleibt. An die Stelle einer Krankheitsdiagnose steht proaktives Gesundheitsmanagement. Ins Zentrum der Medizin rückt die Vorsorge – und zwar deutlich weitergedacht als heute, denn neben allgemeinen Ratschlägen können Arzt und Besucher individuell schauen, wie es gelingen kann, die Gesundheit zu erhalten. Das ist gut für den Patienten – und entlastet das gesamte Gesundheitssystem.
Die PwC-Studie hat bei drei Fallbeispielen durchgerechnet, wie der Einsatz Künstlicher Intelligenz Kosten vermeiden kann. So zeigten klinische Studien, dass sich bereits aus den Gesundheitsdaten von Zweijährigen ablesen lasse, wie hoch ihr Risiko für Adipositas ist. „Durch gezielte Präventionsmaßnahmen ließen sich etwa 90 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren einsparen“, heißt es in der Studie. Künstliche Intelligenz ermögliche zudem die Früherkennung von Demenz mit einer Genauigkeit von 82 bis 90 Prozent. „Wird die Krankheit in einem frühen Stadium erkannt, lassen sich in den kommenden zehn Jahren rund 8 Milliarden Euro einsparen.“ Mit Blick auf den Brustkrebs ermögliche KI nicht nur die Früherkennung, sondern auch eine passgenaue Therapie. „So kann Künstliche Intelligenz voraussagen, wie ein Patient voraussichtlich auf die Chemotherapie reagiert. Das Einsparpotenzial in diesem Bereich wird für die kommenden zehn Jahre auf 74 Milliarden Euro geschätzt.“ Genau hier liege das revolutionäre Potenzial von KI-Techniken in der Medizin, wie Michael Burkhart feststellt, bei PwC Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft: „Bislang standen wir immer vor einem Zielkonflikt: entweder die Versorgungsqualität zu verbessern oder die Kosten für die Versicherten zu senken. KI macht beides zugleich möglich.“ Die Sache rechnet sich also – weshalb sich Einsteiger auf eine digital geprägte Zukunft einstellen dürfen.






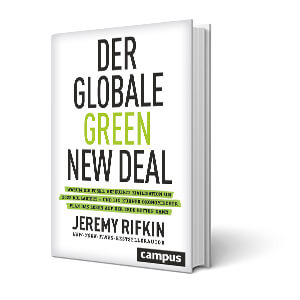 Rund um den Globus kippt angesichts der drohenden Klimakatastrophe die Stimmung, und der Protest der Millennials gegen eine Politik, die ihre Zukunft zerstört, wird immer lauter. Gleichzeitig sitzt die Welt angesichts alternativer Technologien auf einer 100-Billionen- Dollar-Blase aus Investitionen in fossile Brennstoffe. Zukunftsforscher Jeremy Rifkin zeigt, wie aus dieser Konstellation die Chance auf einen Green New Deal entsteht. Er warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden ökonomischen Kollaps unserer Zivilisation und glaubt, um das Jahr 2028 wird die Weltökonomie in eine „globale Betriebsstörung“ stürzen. Gelingt ein gemeinsamer radikaler Aufbruch in letzter Minute?
Rund um den Globus kippt angesichts der drohenden Klimakatastrophe die Stimmung, und der Protest der Millennials gegen eine Politik, die ihre Zukunft zerstört, wird immer lauter. Gleichzeitig sitzt die Welt angesichts alternativer Technologien auf einer 100-Billionen- Dollar-Blase aus Investitionen in fossile Brennstoffe. Zukunftsforscher Jeremy Rifkin zeigt, wie aus dieser Konstellation die Chance auf einen Green New Deal entsteht. Er warnt vor einem unmittelbar bevorstehenden ökonomischen Kollaps unserer Zivilisation und glaubt, um das Jahr 2028 wird die Weltökonomie in eine „globale Betriebsstörung“ stürzen. Gelingt ein gemeinsamer radikaler Aufbruch in letzter Minute?




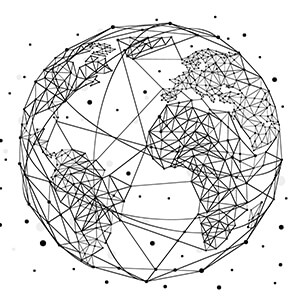


 Wie können mithilfe der Digitalisierung die zentralen Probleme der Menschen und des Planeten – Hunger, Armut, Ungleichheit, Klimawandel und Ressourcenverschwendung – gelöst werden? Das zeigt Karl-Heinz Land, Autor, Speaker und Experte zum Thema Digitale Transformation, in seinem neuen Buch „Erde 5.0. Die Zukunft provozieren“. Er gibt Impulse für einen anderen Kapitalismus, für Sinn- und Zirkulärwirtschaft, für Bildung und ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie eine solidarische Weltgesellschaft in der fünften industriellen Revolution. Seine Vision: Mithilfe von Technologie können wir die Welt zu einem besseren und lebenswerten Ort auf globaler Ebene umgestalten.
Wie können mithilfe der Digitalisierung die zentralen Probleme der Menschen und des Planeten – Hunger, Armut, Ungleichheit, Klimawandel und Ressourcenverschwendung – gelöst werden? Das zeigt Karl-Heinz Land, Autor, Speaker und Experte zum Thema Digitale Transformation, in seinem neuen Buch „Erde 5.0. Die Zukunft provozieren“. Er gibt Impulse für einen anderen Kapitalismus, für Sinn- und Zirkulärwirtschaft, für Bildung und ein bedingungsloses Grundeinkommen sowie eine solidarische Weltgesellschaft in der fünften industriellen Revolution. Seine Vision: Mithilfe von Technologie können wir die Welt zu einem besseren und lebenswerten Ort auf globaler Ebene umgestalten.
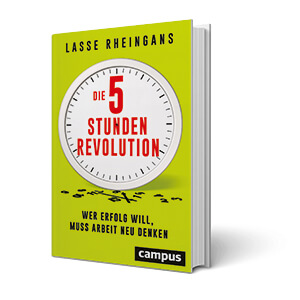



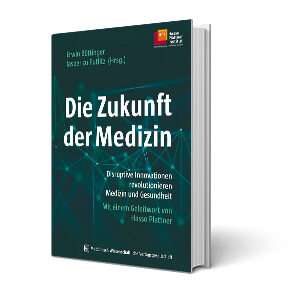 Die Zukunft der Medizin
Die Zukunft der Medizin