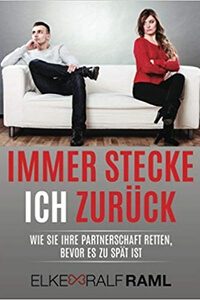Die Digitalisierung in den Unternehmen schreitet voran, die Themen werden immer komplexer, haben längst ans Business angedockt. Nun stehen weitere Veränderungen an, dabei sind Sicherheit und KI im Fokus. Entsprechend gefragt sind IT-Berater, die in der Lage sind, Innovation und Security zusammenzudenken, in agilen und interdisziplinären Teams zu arbeiten und viele Soft Skills mitbringen. Von André Boße
Die digitale Transformation ist längst noch nicht abgeschlossen, in einigen Branchen steckt sie sogar noch in den Kinderschuhen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen: Das System ist komplex, es bildet ein Geflecht aus rund 2000 Klinken, einer Vielzahl von gesetzlichen Krankenkassen, mehr als 200.000 Arztpraxen sowie einem dichten Netz an Apotheken. Eine Studie des Digital-Consulting-Unternehmens Sopra Steria zeigt: Die große Mehrheit der Deutschen ist bereit für eine digitale Transformation in der Gesundheitsversorgung, „es herrscht eine breite Überzeugung, dass die Unterstützung der Krankenhäuser, Arztpraxen und Krankenversicherer mit digitalen Lösungen wie elektronischer Patientenakte, E-Rezept und Gesundheit-Apps die Behandlung und Prävention von Krankheiten deutlich verbessern wird“.
Mit dem aktuellen Stand der Digitalisierung des Gesundheitswesens seien die Deutschen jedoch nicht zufrieden, auch das zeigt die Studie. Um die starke Nachfrage der Bevölkerung nach mehr digitaler Unterstützung im Gesundheitswesen zu stillen, seien neue Strategien und Ansätze gefragt, zumal der Einfluss globaler Technologiekonzerne im digitalen Gesundheitsmarkt wachse. „Den Beteiligten im Gesundheitswesen droht ein teilweiser Verlust der Souveränität über Patientendaten“, warnen die Studienautoren. Die Branche verpasst also nicht nur eine Chance, sondern verliert auch noch ihr Vertrauen beim Thema Datensicherheit. Keine Frage, sowohl die Politik als auch die Akteure des Systems stehen vor einer großen Aufgabe, das System auf modernste IT umzustellen. Und entsprechend groß ist auch der Beratungsbedarf.
Das Umfeld, in dem Unternehmen und Organisationen tätig sind, ändert sich rasant. Motoren des Wandels sind erstens die Kunden, die andere Anforderungen stellen, zweitens gesetzliche und politische Vorgaben, von denen immer mehr damit zu tun haben, die Folgen der Erderwärmung abzumildern und die Klimaziele zu erreichen.
Digitalisierung trifft auf Reglementierung
Die Gesundheitsbranche ist nur ein Beispiel. Egal, wohin man schaut: Das Umfeld, in dem Unternehmen und Organisationen tätig sind, ändert sich rasant. Motoren des Wandels sind erstens die Kunden, die andere Anforderungen stellen, zweitens gesetzliche und politische Vorgaben, von denen immer mehr damit zu tun haben, die Folgen der Erderwärmung abzumildern und die Klimaziele zu erreichen. Ob Automobilindustrie oder Versicherer, Energieversorger oder die Tourismusbranche: Die zwei Trends Digitalisierung und Reglementierung sorgen dafür, dass IT-Architekturen in den Unternehmen digitale Innovation und Security zusammendenken müssen. Das ist ein herausfordernder Spagat, der nach Consulting verlangt. Doch wo liegt überhaupt die Basis, wie gut also sind die deutschen Unternehmen bei der digitalen Transformation vorangekommen?
Wen suchen IT-Beratungsunternehmen?
Laut der Lünendonk-Studie „Führende IT-Beratungs- und IT-Service- Unternehmen in Deutschland – mit Sonderkapitel zum IT-Mittelstand“ werden von den IT-Beratungsunternhemen vor allem Data Scientists, Cloud- und Security-Experten sowie Softwareentwickler gesucht. Bei mittelständischen Anwenderunternehmen und IT-Dienstleistern mangelt es an ausreichend SAP-Spezialisten für die bevorstehenden Transformationsprojekte auf die neue ERP-Version S/4.
Das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Capgemini spricht in seiner „IT-Trends-Studie 2019“ von guten Rahmenbedingungen: Die Budgets für ITProzesse bewegten sich auf hohem Niveau, zudem hätten sich viele Unternehmen in den vergangenen Jahren im Zusammenhang mit Big Data mit der Dateninfrastruktur auseinandergesetzt. „Wenn sie ihre Arbeit gut gemacht haben, können sie jetzt davon profitieren und mit intelligenten Technologien den nächsten Schritt gehen“, sagt Dr. Uwe Dumslaff, CTO Germany bei Capgemini. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass aktuell sieben von zehn der befragten Unternehmen bereits intelligente Technologien wie Machine Learning, Bilderkennung oder Natural Language Processing einsetzen – besonders intensiv geschehe dies sowohl in Konzernen als auch in Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand. Genutzt werden diese KI-Techniken vor allem, um manuelle Möglichkeiten zu automatisieren. Auch die Datenanalyse stehe bereits im Fokus, insbesondere, um das Verhalten von Kunden, Maschinen oder des Marktes vorherzusagen.
Fehlendes Know-how Inhouse
„Weniger Anklang findet ihr Einsatz bei deutlich komplexeren Einsatzszenarien“, heißt es in der Capgemini-Studie. Ein Grund dafür ist häufig fehlendes Know-how: „Ausgebremst wird der Einsatz intelligenter Technologien hauptsächlich dadurch, dass Unternehmen zu wenig Experten im eigenen Haus haben.“ Entsprechend groß ist der Bedarf, auf externe Dienstleister zuzugreifen. Wobei sich diese am Erfolg messen lassen müssen, denn bislang sind die Ergebnisse der Digitalisierung in vielen Fällen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, auch das zeigt die Capgemini-Studie. Interessant ist dabei, dass Branchen, die die Digitalisierung weniger hoch einschätzen als andere, mit den Resultaten ihrer digitalen Schritte zufriedener sind. „Stellenwert und Erfolg korrespondieren häufig nicht“, schreiben die Autoren. „Während dem Handel Digitalisierung weniger wichtig ist als der Automobilindustrie, schätzt er seine bisherigen Erfolge höher ein.“
Weiterhin Investitionen in IT-Beratung
Die Analysten von Lünendonk stellen in ihrer Branchen-Studie fest, dass die Nachfrage nach IT-Beratung sowie der anschließenden Umsetzung der Konzepte nicht abflacht: „Trotz weltweiter Unsicherheitsfaktoren wie dem Handelsstreit zwischen den USA und China oder dem Brexit investieren Unternehmen weiterhin stark in die Digitalisierung. Für 2019 erwarten IT-Dienstleister in Deutschland daher einen Umsatzanstieg um 10,6 Prozent und für das Jahr 2020 um 10,8 Prozent.“
Vergleichsweise zufrieden mit ihren digitalen Erfolgen seien die Branchen Verkehr und Tourismus, Logistik und Energie. „Demgegenüber haben Versicherungen aufgrund ihrer komplexen und zum Teil veralteten IT-Landschaft auch weiterhin Probleme, bei der Digitalisierung voranzukommen“, so die Studie. Für IT-Consultants bedeutet das: Beratung orientiert sich an den Anforderungen und Zielsetzungen der jeweiligen Branche. Je nach Erwartungen, Stellenwert und vorhandener IT-Architektur müssen die Beratungskonzepte angepasst werden. So hilft es zum Beispiel nicht, einem Versicherer ein innovatives KI-Konzept zu verpassen: Auch wenn die Potenziale tatsächlich vorhanden sind, sind viele Konzerne noch nicht dazu bereit, auf diesem Level aktiv zu werden. Daher sind Branchenkenntnisse für IT-Berater von entscheidender Bedeutung. Wobei es nicht nur darauf ankommt, Strategie, Markt und Zielgruppen zu kennen, sondern auch eine tiefgreifende Analyse der vorhandenen IT-Strukturen vorzunehmen. Erst dann zeigt sich, welche Themen und digitalen Innovationen zu welchem Zeitpunkt machbar und sinnvoll sind.
Fünf Trendthemen, von Datenschutz bis BYOx
Dass die Digitalisierung weiter voranschreiten wird, ist selbst den IT-skeptischen Unternehmen klar. Capgemini hat dabei fünf Trend-Themen definiert, die von der Nische in die breite Wahrnehmung gesprungen sind – und für die der Bedarf nach Beratung groß ist:
- DSGVO-Compliance: Die Datenschutzgrundverordnung ist seit Mitte 2018 in Kraft, der erste Wirbel hat sich gelegt. Doch in den Unternehmen sind Planung und Ausführung vielfach noch nicht abgeschlossen.
- Privacy by Design: Datenschutz muss in die IT-Systeme integriert werden, sodass an dieser Stelle Security- Experten und Entwickler die IT-Struktur gemeinsam gestalten.
- Multi-Faktor-Authentifizierung: Beim Smartphone kennt man das längst, neben der PIN loggt man sich per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ein. Unternehmen nutzen die Chancen diese Optionen noch selten – hier kann konkret Sicherheit verbessert werden.
- BYOx-Security: Gefragt sind Konzepte, private Geräte (nach dem Motto: „bring your own device“) in die ITLandschaft zu integrieren, ohne dass dabei Bedienbarkeit oder Sicherheit verloren gehen.
- Security-Automation: Im Zuge der neuen Datenschutzverordnungen sehen viele die Automatisierung von Sicherheitsprozessen aktuell kritisch, in naher Zukunft wird es aber verstärkt darum gehen, Security durch Techniken wie KI oder Blockchain effizienter und stärker zu gestalten.
Agile Teams, Kooperationen mit den Großen
Um den Herausforderungen gerecht zu werden, stellen sich die Beratungsteams laut Lünendonk-Studie heute anders auf, als noch vor wenigen Jahren: In knapp 50 Prozent aller Projekte kommen bei IT-Dienstleistern agile Teams zum Einsatz, wobei parallel auch die Kunden verstärkt auf agile Strukturen setzen. Zudem gewinnen für IT-Beratungen Kooperationen mit Technologieunternehmen an Bedeutung. „Besonders SAP und Microsoft werden als wichtige Partner und Ergänzung zum eigenen Portfolio angesehen“, heißt es in der Studie. Wobei sich generell zeige, dass Business und IT mehr und mehr zusammenwachsen.
Soft Skills mit großer Bedeutung
Doch an welche Consultants wenden sich die Kunden mit ihrem Beratungsbedarf überhaupt? „Die Frage nach dem richtigen Dienstleistungspartner ist für viele Unternehmen immer schwerer zu beantworten, denn interdisziplinäre Kompetenzen wie Strategie- und Managementberatung, ITBeratung/ Systemintegration sowie Kreativ- und Designberatung sind immer enger miteinander verwoben. Die Grenzen zwischen den Marktsektoren ‚Digitalagentur‘, ‚Strategieund Managementberatung‘ und ‚IT-Dienstleistung‘ verschwimmen in der Folge immer mehr“, sagt Mario Zillmann, Partner bei den Markt- und Branchenexperten Lünendonk & Hossenfelder, die Ende September eine Studie zum „Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland“ vorgestellt haben. Dabei führt der Beratungsbedarf ihrer Kunden die Consultants mitunter nicht nur an den Rand ihrer Kapazitäten – sondern auch darüber hinaus: Zwölf Prozent aller Projektanfragen mussten die befragten IT-Dienstleister im Jahr 2018 ablehnen, wie die Studie aufzeigt. „Als häufigste Ursache wurden fehlende Fachkräfte genannt, die die Projekte umsetzen könnten.“
Der Mangel an Experten bremst also das Wachstum. Was aber nicht heißt, dass die Anforderungen an Einsteiger sinken. Im Gegenteil, die Komplexität der Mandate führt dazu, dass immer neue Fähigkeiten bedeutsam werden. „Soft Skills sind für IT-Mitarbeiter so wichtig, weil sie große Barrieren überwinden müssen“, sagt Greg Layok, Geschäftsführer des amerikanischen Beratungsunternehmens West Monroe. Erst kürzlich fand das Beratungshaus in einer Umfrage mit 1250 Personalverantwortlichen heraus, dass Job-Kandidaten in der IT zu 98 Prozent nach ihren sozialen Fähigkeiten beurteilt werden. „Sie müssen anspruchsvolle Themen kollaborativ bearbeiten“, sagt Layok. „Dabei müssen sie so kommunizieren, dass sie von Mitarbeitern aus den Fachbereichen verstanden werden und sollten auch die jeweiligen Problemstellungen der einzelnen Geschäftsbereiche kennen.“ Im Grunde erreicht IT-Beratung daher gleich in zweifacher Hinsicht ein nächstes Level: Digitalisierungsthemen werden immer komplexer, auch ist die IT mittlerweile ein fester Teil der Unternehmensstrategie der Kunden. Denn der Erfolg der digitalen Transformationen entscheidet, wie erfolgreich ein Unternehmen wirtschaftet – heute schon und erst recht in naher Zukunft.
Buchtipp
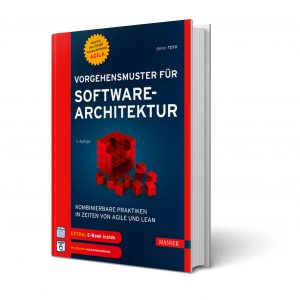 Herangehensweisen für die Architekturentwicklung sind teilweise Jahrzehnte alt und haben den Wandel hin zu agilen Vorgehen nicht mitgemacht. Im Vergleich zu aktuellen Projektmanagement-Praktiken sieht Architektur schwer und alt aus. Das führt dazu, dass Softwarearchitektur entweder vernachlässigt wird oder sich als Fremdkörper nur schwer in die heutigen, dynamischen Umfelder integrieren lässt. Moderne Projekte arbeiten in Teams, hoch flexibel und sehr ergebnisorientiert. Eng verzahnt mit dem Kunden werden qualitativ hochwertige Produkte erstellt. Auch Architektur muss sich hier umstellen und teilweise neu erfinden. In der Praxis ist das bereits beobachtbar. Entwicklungsteams kümmern sich gemeinsam um Architekturaufgaben, Architektur wird „Just-in-time“ entschieden und bettet sich in den üblichen Priorisierungsprozeß von Anforderungen und Tätigkeiten. Die Theorie hat an dieser Stelle noch etwas aufzuholen. Stefan Toth: Vorgehensmuster für Softwarearchitektur. Hanser 2019, 34,90 Euro (Werbelink)
Herangehensweisen für die Architekturentwicklung sind teilweise Jahrzehnte alt und haben den Wandel hin zu agilen Vorgehen nicht mitgemacht. Im Vergleich zu aktuellen Projektmanagement-Praktiken sieht Architektur schwer und alt aus. Das führt dazu, dass Softwarearchitektur entweder vernachlässigt wird oder sich als Fremdkörper nur schwer in die heutigen, dynamischen Umfelder integrieren lässt. Moderne Projekte arbeiten in Teams, hoch flexibel und sehr ergebnisorientiert. Eng verzahnt mit dem Kunden werden qualitativ hochwertige Produkte erstellt. Auch Architektur muss sich hier umstellen und teilweise neu erfinden. In der Praxis ist das bereits beobachtbar. Entwicklungsteams kümmern sich gemeinsam um Architekturaufgaben, Architektur wird „Just-in-time“ entschieden und bettet sich in den üblichen Priorisierungsprozeß von Anforderungen und Tätigkeiten. Die Theorie hat an dieser Stelle noch etwas aufzuholen. Stefan Toth: Vorgehensmuster für Softwarearchitektur. Hanser 2019, 34,90 Euro (Werbelink)










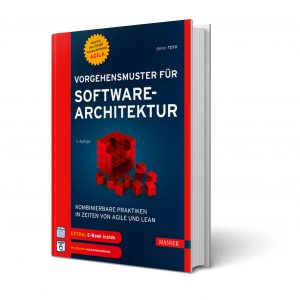 Herangehensweisen für die Architekturentwicklung sind teilweise Jahrzehnte alt und haben den Wandel hin zu agilen Vorgehen nicht mitgemacht. Im Vergleich zu aktuellen Projektmanagement-Praktiken sieht Architektur schwer und alt aus. Das führt dazu, dass Softwarearchitektur entweder vernachlässigt wird oder sich als Fremdkörper nur schwer in die heutigen, dynamischen Umfelder integrieren lässt. Moderne Projekte arbeiten in Teams, hoch flexibel und sehr ergebnisorientiert. Eng verzahnt mit dem Kunden werden qualitativ hochwertige Produkte erstellt. Auch Architektur muss sich hier umstellen und teilweise neu erfinden. In der Praxis ist das bereits beobachtbar. Entwicklungsteams kümmern sich gemeinsam um Architekturaufgaben, Architektur wird „Just-in-time“ entschieden und bettet sich in den üblichen Priorisierungsprozeß von Anforderungen und Tätigkeiten. Die Theorie hat an dieser Stelle noch etwas aufzuholen.
Herangehensweisen für die Architekturentwicklung sind teilweise Jahrzehnte alt und haben den Wandel hin zu agilen Vorgehen nicht mitgemacht. Im Vergleich zu aktuellen Projektmanagement-Praktiken sieht Architektur schwer und alt aus. Das führt dazu, dass Softwarearchitektur entweder vernachlässigt wird oder sich als Fremdkörper nur schwer in die heutigen, dynamischen Umfelder integrieren lässt. Moderne Projekte arbeiten in Teams, hoch flexibel und sehr ergebnisorientiert. Eng verzahnt mit dem Kunden werden qualitativ hochwertige Produkte erstellt. Auch Architektur muss sich hier umstellen und teilweise neu erfinden. In der Praxis ist das bereits beobachtbar. Entwicklungsteams kümmern sich gemeinsam um Architekturaufgaben, Architektur wird „Just-in-time“ entschieden und bettet sich in den üblichen Priorisierungsprozeß von Anforderungen und Tätigkeiten. Die Theorie hat an dieser Stelle noch etwas aufzuholen. 
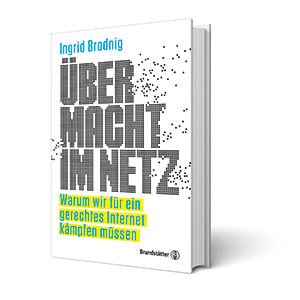 Der Titel des vierten Buches von Ingrid Brodnig beinhaltet eine feine Doppeldeutigkeit: Im Text schreibt sie „über Macht“ im Internet und analysiert, warum es sich dabei um eine gefährliche Übermacht einiger Akteure handelt. „Der digitale Wohlstand ist ungleich verteilt, Apps überwachen uns insgeheim und Online-Plattformen vermitteln oft schlecht bezahlte Jobs“, zählt die Autorin auf. Doch Ingrid Brodnig ist keine Pessimistin: Ihre konkreten Vorschläge für eine transparentere und fairere digitale Gesellschaft zeigen, dass die Gestaltungskraft bei uns allen liegt.
Der Titel des vierten Buches von Ingrid Brodnig beinhaltet eine feine Doppeldeutigkeit: Im Text schreibt sie „über Macht“ im Internet und analysiert, warum es sich dabei um eine gefährliche Übermacht einiger Akteure handelt. „Der digitale Wohlstand ist ungleich verteilt, Apps überwachen uns insgeheim und Online-Plattformen vermitteln oft schlecht bezahlte Jobs“, zählt die Autorin auf. Doch Ingrid Brodnig ist keine Pessimistin: Ihre konkreten Vorschläge für eine transparentere und fairere digitale Gesellschaft zeigen, dass die Gestaltungskraft bei uns allen liegt.




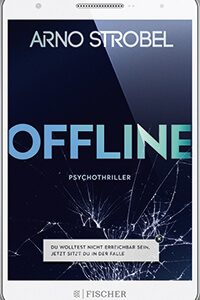 Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. einer aus der Gruppe und wird kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Digital Detox. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. So das Szenario im Buch „Offline“ des Bestseller-Autors Arno Strobel. Doch am zweiten Tag verschwindet Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg. Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen.
Fünf Tage ohne Internet. Raus aus dem digitalen Stress, einfach nicht erreichbar sein. einer aus der Gruppe und wird kurz darauf schwer misshandelt gefunden. Digital Detox. So das Vorhaben einer Gruppe junger Leute, die dazu in ein ehemaliges Bergsteigerhotel auf den Watzmann in 2000 Metern Höhe reist. So das Szenario im Buch „Offline“ des Bestseller-Autors Arno Strobel. Doch am zweiten Tag verschwindet Jetzt beginnt für alle ein Horrortrip ohne Ausweg. Denn sie sind offline, und niemand wird kommen, um ihnen zu helfen.
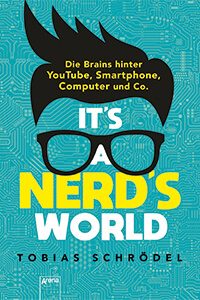 Smartphone? Coole Sache. Internet? Wie kann man ohne überleben!? Zeit, die Menschen zu feiern, die das möglich gemacht haben. Tobias Schrödel, IT-Experte und Deutschlands erster Comedy-Hacker, erzählt die Geschichten rund um die Brains, deren Hardware, Software und Internet-Anwendungen das Leben von uns allen für immer verändert haben – und die teilweise niemand kennt. Denn: Ehre, wem Ehre gebührt!
Smartphone? Coole Sache. Internet? Wie kann man ohne überleben!? Zeit, die Menschen zu feiern, die das möglich gemacht haben. Tobias Schrödel, IT-Experte und Deutschlands erster Comedy-Hacker, erzählt die Geschichten rund um die Brains, deren Hardware, Software und Internet-Anwendungen das Leben von uns allen für immer verändert haben – und die teilweise niemand kennt. Denn: Ehre, wem Ehre gebührt!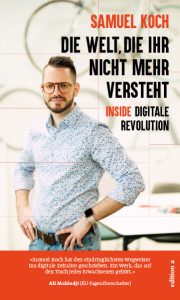 Samuel Koch gründete nach einem Informatik-Studium ein Software-Unternehmen, das Unternehmen und deren Mitarbeitern digitale Kompetenzen vermittelt. Derzeit arbeitet er an der Entwicklung einer eigenen Universität. Und er hat ein Buch über die Welt von morgen geschrieben, die schon da ist, und darüber, was junge High Potentials über sie wissen, das wir nicht wissen: Die Welt, die ihr nicht mehr versteht – Inside digitale Revolution. Darin räumt er mit Missverständnissen über Beschleunigung, Fortschritt und Privatsphäre auf, entwirft eine Schule für Lehrer, an der Schüler unterrichten und präsentiert eine optimistische digitale Utopie.
Samuel Koch gründete nach einem Informatik-Studium ein Software-Unternehmen, das Unternehmen und deren Mitarbeitern digitale Kompetenzen vermittelt. Derzeit arbeitet er an der Entwicklung einer eigenen Universität. Und er hat ein Buch über die Welt von morgen geschrieben, die schon da ist, und darüber, was junge High Potentials über sie wissen, das wir nicht wissen: Die Welt, die ihr nicht mehr versteht – Inside digitale Revolution. Darin räumt er mit Missverständnissen über Beschleunigung, Fortschritt und Privatsphäre auf, entwirft eine Schule für Lehrer, an der Schüler unterrichten und präsentiert eine optimistische digitale Utopie.