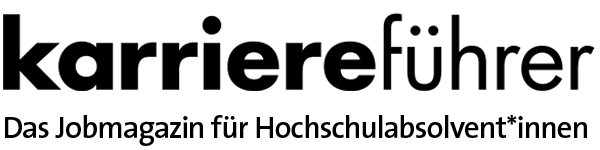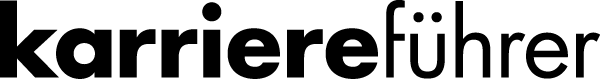Als Mediensprecher der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM) sieht sich Prof. Dr. Harald Gündel als Botschafter seines Fachgebiets. Mit viel Leidenschaft für seinen Beruf erklärt der Ärztliche Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am UniversitätsKlinikum Ulm, wie sich das Bild seines Bereichs in der Öffentlichkeit positiv gewandelt hat und welche Kompetenzen wichtig sind. Das Interview führte André Boße.
Zur Person
Prof. Dr. Harald Gündel ist Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitäts-Klinikum Ulm. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Themen Berufsleben & Gesundheit sowie Somatoforme Störungen. Harald Gündel ist zudem Mediensprecher der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und Ärztliche Psychotherapie (DGPM). In dieser Fachgesellschaft haben sich rund 1400 Mitglieder zusammengeschlossen, um die klinische und wissenschaftliche Entwicklung des Fachgebiets zu fördern und seine Belange nach außen zu vertreten.
Herr Prof. Gündel, wie hat sich das Fachgebiet der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie in den vergangenen Jahren entwickelt?
Sehr positiv. Wenn ich heute meinen Fachbereich in der Öffentlichkeit benenne, dann spüre ich oft ein sehr großes Interesse. Erstens, weil psychische Erkrankungen heute weit weniger stigmatisiert sind als es 1990 der Fall war, als ich als junger Mediziner in dieses Gebiet eingestiegen bin. Zweitens, weil immer mehr Menschen erkennen, dass sie sich in privaten oder beruflichen Belastungssituationen befinden. Mal bemerken sie die Folgen hauptsächlich körperlich, mal seelisch – das Gespür dafür aber, dass es hier Zusammenhänge gibt, steigt.
Nehmen denn diese Belastungssituationen heute zu? Oder gab es diese schon immer, nur wird heute offener darüber gesprochen?
Grundsätzlich gab es sie schon immer. Dass wir Menschen auf Belastungen seelisch und körperlich reagieren, ist als grundlegender biologischer Mechanismus in uns angelegt und kein Phänomen der heutigen Zeit. Es war für unsere Vorfahren sicherlich auch eine Belastung, nicht zu wissen, ob man den nächsten Tag überlebt, weil Kriege herrschten oder viele Krankheiten noch nicht heilbar waren. Gehen wir aber von den normalen Friedenszeiten der heutigen westlichen Welt aus, dann ist es fraglos so, dass die zeitliche Taktung für viele Menschen immer weiter zunimmt und somit notwendige Erholungsphasen zunehmend verloren gehen. Auch das Arbeitsleben verdichtet sich, ein Arbeitsablauf folgt auf den nächsten, viele Dinge müssen gleichzeitig gemacht werden, und das wirkt sich natürlich auch auf das Privatleben aus. Ich denke schon, dass dadurch der Stress, den unser menschlicher Organismus erfährt, insgesamt wächst. Bis zu dem Punkt, an dem manche Menschen Beschwerden entwickeln.
Wann ist dieser Punkt erreicht, wann wird eine normale, vertretbare Belastung zu chronischem Stress?
Das ist bei jedem Menschen grundverschieden. Gerade durch die klinische Erfahrung und die neurobiologische Forschung erkennen wir, wie sehr sich die psychosomatischen Zusammenhänge je nach Patienten und persönlicher Resilienz unterscheiden. Was wir aber auch wissen, ist, dass es für jeden Menschen eine Obergrenze gibt.
Was ist bei der Behandlung Ihrer Patienten das wichtigste Werkzeug?
Unser Fach trägt den Titel Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, was schon zeigt, dass unser zentrales Werkzeug die Psychotherapie ist, also das gesprochene Wort und nonverbale Therapieformen wie Kunst-, Körperoder Musiktherapie. Unser Ziel ist es letztlich, durch die Therapie und im Rahmen der therapeutischen Allianz dem jeweiligen Menschen eine schrittweise verbesserte Selbsterkenntnis und Selbstwirksamkeit zu ermöglichen.
Es geht also darum, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
Ja, und auch in dieser Hinsicht macht unser Fachgebiet „viel Spaß“, weil es sehr befriedigend ist, zu sehen, wie wir Menschen in die Lage bringen können, wieder selbst mehr Verantwortung zu übernehmen und sich selbst, oft gerade persönliche Resilienz und Beziehungsgestaltung, positiv zu entwickeln.
Sie sprachen eben über die neurobiologische Forschung, die Ihnen wichtige Kenntnisse gibt. Inwieweit ist dieser Bereich für Sie Teil des Arbeitsalltags?
Die Forschung selbst finden Sie in den Unikliniken; in den nicht universitären Krankenhäusern gibt es dafür in der Regel die zeitlichen Kapazitäten nicht. Aber auch für diese Kolleginnen und Kollegen ist es von zentraler Bedeutung, grundlegende psychosomatische Mechanismen zu verstehen. Zumal diese unseren Bereich deutlich aufwerten, weil wir heute nämlich neurobiologisch zeigen können, wie sich erstens subjektive Gefühle wie beispielsweise Ärger, Wut, Scham oder Trauer in körperlichen Substraten widerspiegeln und wie zweitens das Reden sowie Nachdenken – also das „Mentalisieren“ – über psychosoziale, oft zwischenmenschliche Belastungen zu therapeutischen Erfolgen führen kann. Das alte Klischee von den Psychosomatikern, die mit „Räucherstäbchen und Meditationsmusik“ um die Ecke kommen, ist längst nicht mehr haltbar.
Welche Rolle spielen Medikamente in der zeitgemäßen Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie?
Wir sind natürlich nicht per se gegen sogenannte Psychopharmaka, auch wir verschreiben sie, setzen sie ein. Jedoch folgt das Medikament dem klassischen Prinzip der Medizin: Wir geben dem Patienten etwas, und durch diese Hilfe von außen bessert sich sein Zustand. Unser psychosomatisch-psychotherapeutisches Grundprinzip ist ein anderes, denn wir versuchen im Patienten selbst mehr Einsicht in die persönliche Situation zu wecken. Unser Ziel ist es dann, Fähigkeiten, die in ihm schlummern, die jedoch durch die Erkrankung verschüttet sind, wieder offenzulegen. Hier kann nicht die Pille allein wirken. Es geht darum, dass der Mensch lernt, sich in bestimmten Situationen anders zu verhalten, damit er die Kräfte und Fähigkeiten, die er besitzt, wieder oder neu anwenden kann. Wenn Sie so wollen, übernimmt das Medikament die Rolle einer „Krücke“ – der Impuls, wieder laufen zu wollen, und die Suche nach der besten Technik, das wieder neu zu erlernen, kommen aber vom Patienten selbst. Und der „Profi“, der Therapeut, unterstützt und begleitet diesen Entwicklungsprozess.
Welche Fähigkeiten muss man als junger Mediziner mitbringen, um in diesem Bereich zu arbeiten?
Interesse, vielleicht Begeisterung für die Wechselwirkungen zwischen dem, was wir umgangssprachlich „Körper und Seele“ nennen, also Psychosozialem und Biologischem. Interesse an anderen Menschen, auch an geisteswissenschaftlichen Themen, Einfühlungsvermögen. Dazu das Interesse, seine jeweils eigenen Stärken und Schwächen besser kennenzulernen und die persönliche Weiterentwicklung in der Selbsterfahrung als Grundlage für die Behandlung von Patienten zu nutzen. Jede Therapie, also Behandlung, hat dann etwas mit „individueller Forschungsarbeit“ zu tun, jeder Mensch ist anders, hat andere Erfahrungen, und wir wollen herausfinden: Wie hängen hier Bewusstes und Unbewusstes zusammen?
Spielen Sie damit beinahe die Rolle eines Seelsorgers?
Nein, unsere Arbeit ist schon deutlich anders, erstens, weil uns die Medizin den sehr wichtigen Hintergrund und Rahmen für unsere Arbeit gibt: Ein guter Psychosomatiker muss zwingend ein großes Interesse für den menschlichen Körper mitbringen, nur dann kann er verstehen, wie wir Menschen als „verkörpertes Selbst“ funktionieren. Zweitens, weil ich den klassischen Seelsorger als eine Person verstehe, die „nur/vor allem“ gut zuhört, Trost spendet und mitmenschlich einfühlsam ist. Das ist sehr wichtig, reicht für unsere Arbeit aber nicht aus. In der Ausbildung lernen wir psychotherapeutische Ansätze, die eben nicht zwingend immer nur freundlich sind. Es kommt für den Patienten zum Beispiel auch darauf an, auch mal Ärger zuzulassen, sich mit eigenen Schwächen auseinanderzusetzen. Dafür muss ich ihn als Therapeut im Zweifel mit Dingen konfrontieren, die der Patient zunächst als Zumutung empfinden mag – die ihn aber mittelfristig voranbringen können. Psychotherapie ist eine spannende und komplexe Technik, die persönliche Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten ist aber grundlegend.