Der Fahrplan der EU in Richtung klimaneutrales Europa führt zur erhofften Dynamik: Die Investitionen in nachhaltige Technologien steigen, und Ingenieur*innen nehmen die Herausforderung an, Lösungen für die bekannten Probleme zu finden. Dies funktioniert im Himalaya genauso wie auf fränkischen Sportplätzen. Ein Essay von André Boße
Die EU hat Ende 2019 ihren Green Deal vorgestellt, einen „Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft“, wie es offiziell heißt. Dieser hat zwei Ziele: Erstens sollen bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden. Kurz gesagt: Die EU wäre dann klimaneutral. Zweitens soll das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abgekoppelt werden. Das bedeutet: Wachsen, ja, aber nicht mehr auf Kosten der Umwelt. Rund eineinhalb Jahre später kann man sagen: Der Green Deal ist definitiv ein „Big Deal“. Der Fahrplan ist keine kraftlose Forderung aus Brüssel an die Unternehmen, bitte etwas nachhaltiger zu wirtschaften. Die Maßgabe der EU hat sich zum Gamechanger entwickelt. Denn Unternehmen erkennen, dass das nachhaltige Wirtschaften der entscheidende Erfolgsfaktor der Zukunft ist. Zumal er sich koppeln lässt mit dem zweiten Megatrend von heute: der Digitalisierung.
Bill Gates investiert in nachhaltige Start-ups
Microsoft-Gründer Bill Gates ist bekannt als Akteur, der hohe Summen in Zukunftstechnologien zugunsten der Weltgesellschaft investiert. Mitte Februar kündigte er an, in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden USDollar in Start-ups und andere Projekte gegen den drohenden Klimawandel zu investieren. Dies berichtete er in einem Interview mit dem „Handelsblatt“. Es gelte, mit Innovation eine „Klimakatastrophe“ zu verhindern, sagte der Microsoft-Gründer. Gates forderte in dem Interview zusätzlich eine Verfünffachung der globalen staatlichen Forschungsinvestitionen in saubere Energien und andere Klimainnovationen innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Dies wären dann jährlich mindestens 110 Milliarden US-Dollar, also rund 90 Milliarden Euro.
Corona stärkt Green Deal
Als die EU im Dezember 2019 den Green Deal vorstellte, wurden im chinesischen Wuhan die ersten Patient*innen mit einer ungewöhnlichen Lungenkrankheit gemeldet. Andere Länder wussten aber noch nichts über dieses Virus. Das änderte sich nur wenige Wochen später: Corona hat seitdem die Welt im Griff. Interessant ist, dass es dem Virus aber nicht gelingt, den Green Deal zu schwächen. Im Gegenteil: Die Krise zeigt, warum es gerade jetzt wichtiger denn je ist, Risiken abzuschätzen und Wachstumsstrategien zu überdenken. „Es ist kein Zufall, dass die Pandemie vor allem die überhitzten Branchen des alten Normal besonders hart getroffen hat – Fleischproduktion, Kreuzfahrtschiffe, Flugverkehr, exzessiver Tourismus, fossile Automobilität“, stellt Vorwärtsdenker Matthias Horx vom Zukunftsinstitut in seinem Kommentar „2021: Das Jahr der Entscheidungen“ fest. Was diese „Krisen-Branchen“ verbinde, sei ihr Streben nach schnellem Wachstum, sagt Horx. „Wo aber Wirtschaft zur reinen Effizienzmaschine wird, wird sie besonders fragil. Das haben Krisen so an sich: Sie beenden Exzesse. Sie konfrontieren uns mit unserer eigenen Dekadenz. Sie lösen festgefräste Denkmuster auf und zerstören das Überkommene. Sie erzwingen Innovationen, die vorher im Latenten stecken geblieben waren.“
Innovationen zielen häufig darauf, Risiken besser zu managen. Jedes Jahr zum Weltwirtschaftsforum veröffentlicht das veranstaltende Word Economic Forum einen Report über die „Globalen Risiken“, für den rund 650 Leiter weltweiter Unternehmen einschätzen, welche Gefährdungen für die Wirtschaft am relevantesten sind. Ganz oben auf der Liste der Risiken 2021: Wetterextreme, ein Scheitern beim Klimaschutz sowie die vom Menschen gemachte Ausbeutung und Verschmutzung der Umwelt. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren noch wurde das Risikoranking von Themen wie Fiskal-, Liquiditäts- und Preiskrisen dominiert. Als einziges „grünes“ Thema fand sich der Klimawandel in der oberen Hälfte der Liste, umgeben war es von ökonomischen Themen.
Leitlinien zu klimabezogenen Berichten
Die EU-Kommission hat im Juni 2019 unverbindliche Leitlinien zur Berichterstattung über klimabezogene Informationen veröffentlicht. Diese geben Unternehmen Empfehlungen, wie sie darüber berichten können, wie ihre Aktivitäten sich auf den Klimawandel auswirken und welchen Einfluss dieser auf das Geschäftsmodell nimmt. Hier stehen besonders potenzielle Risiken im Fokus. Die Leitlinien erhalten zudem Best Practice-Beispiele zur Berichterstattung über wesentliche Erfolgsfaktoren.
Ingenieurideen mildern „Grüne Risiken“
Was bedeutet diese Entwicklung für technische Innovationen und für die Arbeit der Ingenieur*innen? Mehr denn je kommt es darauf an, dass sie an Lösungen arbeiten, die nachhaltiges Wachstum generieren. Damit das Unternehmen weiter Umsätze generiert – das ist klar. Aber nicht länger auf Kosten der Umwelt. Sondern, mehr noch, mit Technologien, die dabei helfen, die „Grünen Risiken“ abzumildern. Die gute Nachricht: Den Ingenieur*innen kommt dieser Arbeitsauftrag wie gelegen. Er korrespondiert mit den digitalen Möglichkeiten, aber auch mit dem Bedürfnis der jungen Generation. Sie versteht unter dem Konzept New Work, Dinge zu tun, die gedankliche Freiräume garantieren und sinnvoll dazu beitragen, die Welt lebenswert zu erhalten sowie nachhaltig zu gestalten.
Wie wirksam an dieser Stelle der Hebel allein für den Maschinenbau ist, zeigt eine aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Oliver Wyman. Unmittelbar sei der Maschinenbau zwar nur für rund ein Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich – etwa durch den Wärme- und Stromverbrauch bei der Fertigung von Maschinen. „Ungleich größer ist jedoch das Potenzial, anderen Sektoren wie etwa der Stahlverarbeitung oder der Zementbranche durch die Bereitstellung innovativer Technologien zu CO2-Einsparungen zu verhelfen: Fast 70 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen können durch den Maschinenbausektor beeinflusst werden“, heißt es in der Analyse. Dr. Daniel Kronenwett, Partner bei Oliver Wyman, nennt einen konkreten Anwendungsfall: „Ersetzen Stahlhersteller zukünftig beispielsweise Koksöfen durch Wasserstofftechnologie oder Fabriken extern bezogenen Kohlestrom durch dezentrale Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien, ist das ein enormer Hebel.“ Wie groß der Markt ist, zeigt die Kalkulation des Beratungsunternehmens: Um die Ziele des Green Deal zu erreichen, müssten jährlich mehr als 120 Milliarden Euro investiert werden, davon der größte Teil in Technologien und Equipment, die Nachhaltigkeit erzeugen.
Um die Ziele des Green Deal zu erreichen, müssten jährlich mehr als 120 Milliarden Euro investiert werden, davon der größte Teil in Technologien und Equipment, die Nachhaltigkeit erzeugen.
Für die Ingenieur*innen im Maschinenbau zeigen die Berater drei Handlungspfade auf: Erstens gehe es darum, die Energieeffizienz des vorhandenen Maschinenportfolios zu erhöhen. Hier helfen das Industrial Internet of Things (IIoT) sowie neue IT-Management-Systeme. Zweitens raten die Studienautoren zu Investitionen in Brückentechnologien zur Abscheidung, Speicherung oder Weiterverarbeitung von vorhandenem CO2. Drittens sei es wichtig, den Ausbau vielversprechender Durchbruch-Technologien zur Vermeidung von CO2 voranzutreiben, zum Beispiel die industrielle Wasserstofftechnologie. „Die erst kürzlich verabschiedete nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung dürfte dem Thema einen weiteren Impuls nach vorn geben“, sagt Daniel Kronenwett.
Eis-Wasser-Speicher im Sommer
Alte Maschinen optimieren, in Überbrückungstechnologien investieren, Durchbruch-Technologien entwickeln – so lautet der anspruchsvolle Dreischritt, vor dem weltweit die Ingenieur* innen stehen. Nicht zuletzt in dieser Pandemie zeigt sich: Steigen die Anforderungen, steigt auch die Innovationskraft. Die Impfstoffforschung ist hier ein gutes Beispiel. Auch Ingenieur* innen belegen weltweit, was diese Berufsgruppe schon immer ausgezeichnet hat: Sie finden Lösungen für Probleme, die zunächst unlösbar scheinen. Werfen wir einen Blick in den Himalaya, wo auf einer Höhe von 3500 Metern über dem Meeresspiegel in den Bergen von Ladakh die Bauern unter einer akuten Wasserknappheit leiden: Fällt in der Region überhaupt Niederschlag, dann häufig Schnee, wobei die Wolken an den Berggipfeln hängenbleiben. Die Winter hier oben sind kalt, in den Sommern wird es wärmer und noch trockener.
Europäischer Erfinderpreis
Einmal im Jahr schreibt das Europäische Patentamt den Europäischen Erfinderpreis aus. Bewerben können sich kluge Köpfe aus Industrieunternehmen, aus kleinen und mittelständischen Betrieben oder aus der Forschung. Die Gewinner des letzten Wettbewerbs haben zum Beispiel ein Verfahren für ein verbessertes Kunststoffrecycling oder eine umweltfreundliche Verpackung aus Pilzen entwickelt.
Der Ingenieur Sonam Wangchuk entwickelte die Idee, moderne Pipelinetechnik mit einer uralten Tradition der Wasserspeicherung zu kombinieren: Schmelzen Schnee und Eis auf dem Gipfel, wird das Wasser die Hänge hinab auf die landwirtschaftlichen Gebiete geleitet. Dort „sprudelt“ das Wasser unter Druck senkrecht aus der Erde und geht auf einem künstlich angelegten Eishügel nieder – eine Art Mini-Gletscher, der durch seine besondere Form bei Plustemperaturen nur sehr langsam schmilzt. Die Eishügel funktionieren wie ein Speicher, der nach und nach Wasser abgibt und somit die Wasserversorgung sichert. Der 2015 gebaute Prototyp wurde mit Hilfe einer Crowdfunding- Kampagne finanziert, die alle Kosten der 2,3 Kilometer langen Pipeline von einem Schmelzwasserfluss bis hinunter zum Dorf deckte. Der Eishügel steht bis Anfang Juli und spendet jährlich rund 1,5 Millionen Liter Schmelzwasser – wohlgemerkt Wasser, das sonst versickert wäre. Sonam Wangchuk gewann für diese Entwicklung den „Rolex-Preis für Unternehmungsgeist“, wobei er den Eishügel am Hang als Pilotprojekt für weitere Investitionen betrachtet: Die Eishügel sollen eine wirksame Klimaanpassungsmaßnahme und Begrünungstechnologie für die Wüste sein. Mittelfristig möchte der studierte Maschinenbauer in seiner Heimatregion 50 noch größere Eishügel anlegen, von denen jeder rund zehn Millionen Liter für die Bewässerung von je zehn Hektar Land liefert, heißt es in einem Pressetext des „Rolex-Preises“.
Guter Platz, kein Mikroplastik
Während der Ingenieur Sonam Wangchuk also im Himalaya die Wasserversorgung garantiert, arbeiten Forschungsteams am Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hochschule Hof daran, Kunststoffe auf biologischer Basis zu entwickeln – und diese auch einzusetzen. Gelungen ist dies bereits auf Sport- und Spielplätzen mit Kunststoffbelägen. Diese Beläge bieten grundsätzlich eine Menge Vorteile: Sie vermeiden Verletzungen, sind robust, schimmeln nicht. Das Problem: „Durch Abrieb aus Bodenbelägen, Kunstrasen und Spielplatzgeräten könnten kleinste Kunststoffteilchen in die Umwelt und somit in die Trinkwasserversorgung gelangen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Instituts. Nun gelang es den Forschern, abriebfeste Beläge aus rein natürlichen Biopolymeren zu entwickeln. Obwohl es sich um ein organisches Element handelt, könne dieses nicht schimmeln und sei witterungsbeständig. Eingesetzt wird er bereits auf zahlreichen Plätzen in Franken. „Dank künstlicher Intelligenz funktioniert der Belag darüber hinaus wie ein Wärmetauscher: Bei Hitze kühlt sich der Boden ab, im Winter lässt die eis- und schneefreie Oberfläche kein Training oder Spiel aufgrund eines unbespielbaren Platzes ausfallen“, informiert das Institut.
Die Beispiele zeigen, wie vielfältig der Green Deal ist: Nachhaltige Verbesserungen zum Wohle der Menschen sowie zum Schutz von Klima und Umwelt sind überall nötig. Was benötigt wird, sind erfinderische Ingenieur*innen, die vorwärts denken: in eine Zukunft, in der es mehr denn je darauf ankommt, das Wohl von Mensch, Welt und Unternehmen zusammenzudenken. Das Schöne an dieser Perspektive: Diese Arbeit erfüllt einen Sinn. Weil sie nicht mehr nur danach verlangt, jede Schraube so zu platzieren, dass die Maschine schneller läuft. Sondern weil es zum Job der Ingenieur*innen gehört, dem System der Nachhaltigkeitstechnologie immer wieder neue wirksame und ineinandergreifende Zahnräder hinzuzufügen.
Das grüne Paradoxon
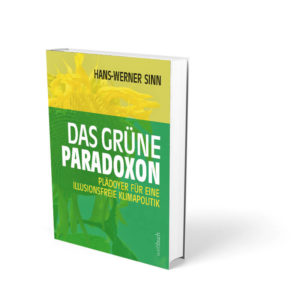 Manche Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv, sagt Hans-Werner Sinn, emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Zum Beispiel habe die Beimischung von Biosprit fatale Folgen von globalem Ausmaß, so der Autor: Wenn wir Lebensmittel tanken, pfl egen wir unser grünes Gewissen zu Lasten der Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die europäische Umweltpolitik unterliegt laut dem Professor der Illusion, dass sie durch einseitige Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen und damit der Nachfrage nach fossilen Rohstoffen die weltweite Produktion solcher Rohstoffe verringern kann. Doch was, wenn aus Angst vor einer Verschlechterung der Marktlage sogar noch mehr Rohstoffe gefördert werden? Der Autor zeigt in seinem Buch die gefährlichen Irrtümer der Umweltpolitik. Sein Plädoyer: Wenn wir unser Klima retten wollen, muss der blinde Aktionismus gestoppt und eine globale Strategie zur Verlangsamung des Ressourcenabbaus gefunden werden. Hans-Werner Sinn: Das grüne Paradoxon. Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Weltbuch Verlag 2020. 19,90 Euro
Manche Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv, sagt Hans-Werner Sinn, emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Zum Beispiel habe die Beimischung von Biosprit fatale Folgen von globalem Ausmaß, so der Autor: Wenn wir Lebensmittel tanken, pfl egen wir unser grünes Gewissen zu Lasten der Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die europäische Umweltpolitik unterliegt laut dem Professor der Illusion, dass sie durch einseitige Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen und damit der Nachfrage nach fossilen Rohstoffen die weltweite Produktion solcher Rohstoffe verringern kann. Doch was, wenn aus Angst vor einer Verschlechterung der Marktlage sogar noch mehr Rohstoffe gefördert werden? Der Autor zeigt in seinem Buch die gefährlichen Irrtümer der Umweltpolitik. Sein Plädoyer: Wenn wir unser Klima retten wollen, muss der blinde Aktionismus gestoppt und eine globale Strategie zur Verlangsamung des Ressourcenabbaus gefunden werden. Hans-Werner Sinn: Das grüne Paradoxon. Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Weltbuch Verlag 2020. 19,90 Euro
Every Day For Future
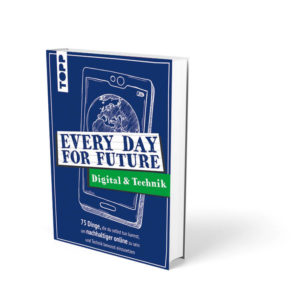 Die Buchreihe „Every Day For Future“ bietet den Leser*innen konkrete Tipps, um im Alltag das Klima zu schützen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Die Ausgabe „Digital & Technik“ zeigt, dass die scheinbar so saubere digitale Welt alles andere als klimaneutral ist. Bei den Ratschlägen für einen bewussteren Verbrauch blickt Autor Frerik Precht auf die Lebensdauer, Leistungsfähigkeit und Stromversorgung von digitalen Geräten. Nicht alle der 75 Tipps werden die Welt verbessern, aber für jeden sind einige nachhaltige Denkanstöße dabei. Frerik Precht: Every Day For Future – Digital & Technik. 75 Dinge, die du selbst tun kannst, um nachhaltiger online zu sein und Technik bewusst einzusetzen. Frech Verlag 2020. 8 Euro
Die Buchreihe „Every Day For Future“ bietet den Leser*innen konkrete Tipps, um im Alltag das Klima zu schützen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Die Ausgabe „Digital & Technik“ zeigt, dass die scheinbar so saubere digitale Welt alles andere als klimaneutral ist. Bei den Ratschlägen für einen bewussteren Verbrauch blickt Autor Frerik Precht auf die Lebensdauer, Leistungsfähigkeit und Stromversorgung von digitalen Geräten. Nicht alle der 75 Tipps werden die Welt verbessern, aber für jeden sind einige nachhaltige Denkanstöße dabei. Frerik Precht: Every Day For Future – Digital & Technik. 75 Dinge, die du selbst tun kannst, um nachhaltiger online zu sein und Technik bewusst einzusetzen. Frech Verlag 2020. 8 Euro
Zeitsprung in eine bessere Welt
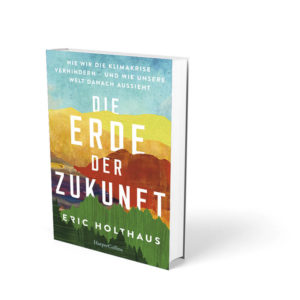 Menschen haben die Erde in den Klimakollaps gestürzt, und Menschen werden sie auch wieder aus dem Dreck ziehen. Eric Holthaus ist Meteorologe und Wissenschaftsjournalist. Er berichtet seit Jahren über Überschwemmungen, Hurrikans und Dürren. Auch er weiß: Weltweit ist das Wetter aus den Fugen geraten, die Extreme nehmen zu. Eine Klima-Apokalypse scheint unausweichlich. Doch Resignation, Ignoranz oder Zynismus sind für Holthaus keine Option. Stattdessen nimmt er uns mit in das Jahr 2050 und skizziert, wie es uns in drei Jahrzehnten gelungen sein könnte, den totalen Kollaps unserer Ökosysteme abzuwenden. Denn der erste Schritt zum Wandel, ist die Vorstellung, dass er möglich ist. Eric Holthaus: Die Erde der Zukunft. Wie wir die Klimakrise verhindern – und wie unsere Welt danach aussieht. HarperCollins 2021. 18 Euro
Menschen haben die Erde in den Klimakollaps gestürzt, und Menschen werden sie auch wieder aus dem Dreck ziehen. Eric Holthaus ist Meteorologe und Wissenschaftsjournalist. Er berichtet seit Jahren über Überschwemmungen, Hurrikans und Dürren. Auch er weiß: Weltweit ist das Wetter aus den Fugen geraten, die Extreme nehmen zu. Eine Klima-Apokalypse scheint unausweichlich. Doch Resignation, Ignoranz oder Zynismus sind für Holthaus keine Option. Stattdessen nimmt er uns mit in das Jahr 2050 und skizziert, wie es uns in drei Jahrzehnten gelungen sein könnte, den totalen Kollaps unserer Ökosysteme abzuwenden. Denn der erste Schritt zum Wandel, ist die Vorstellung, dass er möglich ist. Eric Holthaus: Die Erde der Zukunft. Wie wir die Klimakrise verhindern – und wie unsere Welt danach aussieht. HarperCollins 2021. 18 Euro







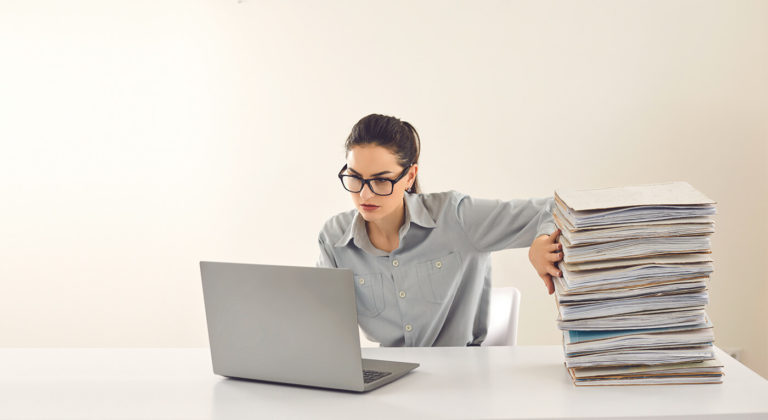
 Ralf Laue, Agnes Koschmider, Dirk Fahland: Prozessmanagement und Process-Mining. De Gruyter Studium 2020, 39,95 Euro
Ralf Laue, Agnes Koschmider, Dirk Fahland: Prozessmanagement und Process-Mining. De Gruyter Studium 2020, 39,95 Euro

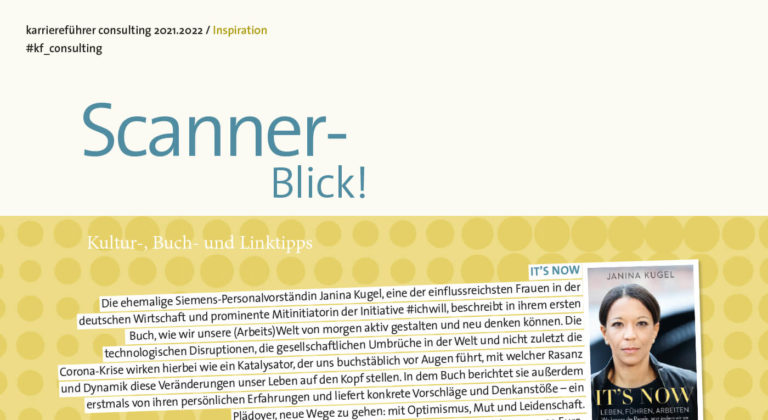
 Die ehemalige Siemens-Personalvorständin Janina Kugel, eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft und prominente Mitinitiatorin der Initiative #ichwill, beschreibt in ihrem ersten Buch, wie wir unsere (Arbeits)Welt von morgen aktiv gestalten und neu denken können. Die technologischen Disruptionen, die gesellschaftlichen Umbrüche in der Welt und nicht zuletzt die Corona-Krise wirken hierbei wie ein Katalysator, der uns buchstäblich vor Augen führt, mit welcher Rasanz und Dynamik diese Veränderungen unser Leben auf den Kopf stellen. In dem Buch berichtet sie außerdem erstmals von ihren persönlichen Erfahrungen und liefert konkrete Vorschläge und Denkanstöße – ein Plädoyer, neue Wege zu gehen: mit Optimismus, Mut und Leidenschaft. Janina Kugel: It’s now. Ariston 2021, 22 Euro..
Die ehemalige Siemens-Personalvorständin Janina Kugel, eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft und prominente Mitinitiatorin der Initiative #ichwill, beschreibt in ihrem ersten Buch, wie wir unsere (Arbeits)Welt von morgen aktiv gestalten und neu denken können. Die technologischen Disruptionen, die gesellschaftlichen Umbrüche in der Welt und nicht zuletzt die Corona-Krise wirken hierbei wie ein Katalysator, der uns buchstäblich vor Augen führt, mit welcher Rasanz und Dynamik diese Veränderungen unser Leben auf den Kopf stellen. In dem Buch berichtet sie außerdem erstmals von ihren persönlichen Erfahrungen und liefert konkrete Vorschläge und Denkanstöße – ein Plädoyer, neue Wege zu gehen: mit Optimismus, Mut und Leidenschaft. Janina Kugel: It’s now. Ariston 2021, 22 Euro..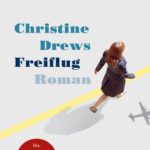 Deutschland in den Siebzigerjahren. Katharina Berner stammt aus einer gut situierten Unternehmerfamilie, geht aber seit jeher ihren eigenen Weg. Dass sie Jura studieren wollte, statt eine Familie zu gründen, haben weder ihr Vater, der alte Patriarch, noch ihre Mutter oder Schwestern je verstanden. Doch sie hat sich durchgesetzt und arbeitet in einer großen Kanzlei in Köln – glücklich ist sie allerdings nicht. Die männlichen Kollegen machen ihr den Alltag zur Hölle, am liebsten würde sie sich selbstständig machen. Nur wie, wenn nicht einmal jemand Büroräume an sie vermieten will? Da bittet eine junge Frau Katharina um Hilfe: Rita Maiburg besitzt eine Pilotenlizenz, versucht jedoch vergeblich, eine Anstellung zu bekommen. Die Lufthansa hat ihre Bewerbung mit der Begründung abgelehnt, dass sie grundsätzlich keine Frauen als Piloten einstellt. Diese Ungerechtigkeit will Rita sich nicht gefallen lassen. Katharina nimmt den Fall an, und die beiden beschließen zu klagen – gegen die Lufthansa und die BRD. Einen Verbündeten findet Katharina in ihrem Vermieter Theo, der sie nach Kräften unterstützt. Doch wird es den beiden Frauen gelingen, Ritas Traum vom Fliegen endlich Wirklichkeit werden zu lassen? Christine Drews: Freiflug. Dumont 2021, 20 Euro.
Deutschland in den Siebzigerjahren. Katharina Berner stammt aus einer gut situierten Unternehmerfamilie, geht aber seit jeher ihren eigenen Weg. Dass sie Jura studieren wollte, statt eine Familie zu gründen, haben weder ihr Vater, der alte Patriarch, noch ihre Mutter oder Schwestern je verstanden. Doch sie hat sich durchgesetzt und arbeitet in einer großen Kanzlei in Köln – glücklich ist sie allerdings nicht. Die männlichen Kollegen machen ihr den Alltag zur Hölle, am liebsten würde sie sich selbstständig machen. Nur wie, wenn nicht einmal jemand Büroräume an sie vermieten will? Da bittet eine junge Frau Katharina um Hilfe: Rita Maiburg besitzt eine Pilotenlizenz, versucht jedoch vergeblich, eine Anstellung zu bekommen. Die Lufthansa hat ihre Bewerbung mit der Begründung abgelehnt, dass sie grundsätzlich keine Frauen als Piloten einstellt. Diese Ungerechtigkeit will Rita sich nicht gefallen lassen. Katharina nimmt den Fall an, und die beiden beschließen zu klagen – gegen die Lufthansa und die BRD. Einen Verbündeten findet Katharina in ihrem Vermieter Theo, der sie nach Kräften unterstützt. Doch wird es den beiden Frauen gelingen, Ritas Traum vom Fliegen endlich Wirklichkeit werden zu lassen? Christine Drews: Freiflug. Dumont 2021, 20 Euro.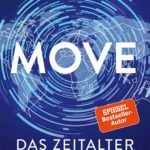 In diesem Buch eröffnet Parag Khanna, indisch-amerikanischer Politikwissenschaftler und in Singapur lebender Vordenker, einen anderen, neuen Blick auf die Welt. Er bringt Geschichte, Politik und die natürlichen Lebensbedingungen des Menschen, die sich gerade rasant verändern, zusammen und leitet daraus Voraussagen für die Zukunft ab. Seine Grundthese: Die Menschheit wird sich in den nächsten Jahrzehnten neu auf der Erde verteilen (müssen). Gebiete, die bislang von der Natur bevorzugt wurden, drohen unbewohnbar zu werden; alte Industrieregionen, die Millionen von Menschen angezogen haben, werden veröden, neue Zentren entstehen. All dies wird nicht auf ein Land beschränkt sein, sondern zum weltweiten Phänomen. Die Gründe, die Khanna für riesige Migrationsströme über die Kontinente hinwegsieht, sind vielfältig: von demographischen Schieflagen und unterschiedlichen Modernisierungsgeschwindigkeiten über Klimaveränderungen bis zu sich neu verteilenden Arbeitsmöglichkeiten. Parag Khanna: Move. Rowohlt 2021, 24 Euro.
In diesem Buch eröffnet Parag Khanna, indisch-amerikanischer Politikwissenschaftler und in Singapur lebender Vordenker, einen anderen, neuen Blick auf die Welt. Er bringt Geschichte, Politik und die natürlichen Lebensbedingungen des Menschen, die sich gerade rasant verändern, zusammen und leitet daraus Voraussagen für die Zukunft ab. Seine Grundthese: Die Menschheit wird sich in den nächsten Jahrzehnten neu auf der Erde verteilen (müssen). Gebiete, die bislang von der Natur bevorzugt wurden, drohen unbewohnbar zu werden; alte Industrieregionen, die Millionen von Menschen angezogen haben, werden veröden, neue Zentren entstehen. All dies wird nicht auf ein Land beschränkt sein, sondern zum weltweiten Phänomen. Die Gründe, die Khanna für riesige Migrationsströme über die Kontinente hinwegsieht, sind vielfältig: von demographischen Schieflagen und unterschiedlichen Modernisierungsgeschwindigkeiten über Klimaveränderungen bis zu sich neu verteilenden Arbeitsmöglichkeiten. Parag Khanna: Move. Rowohlt 2021, 24 Euro.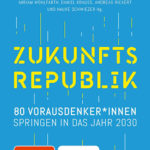 Um ein Land zukunftsfähig zu machen, braucht es vor allem eines: kreative Köpfe, die über das Morgen hinausdenken. Darum haben die Herausgeberinnen und Herausgeber des Buchs „Zukunftsrepublik“ 80 herausragende Persönlichkeiten zusammengebracht, die unsere Zukunft mit ihren Ideen entscheidend prägen werden. Das Buch ist ein Feuerwerk an Zukunftsvisionen, persönlichen Einschätzungen und Wegweisern für die sechs Kategorien Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit, Politik und Gesellschaft. Marie-Christine Ostermann, Celine Flores Willers, Miriam Wohlfarth, Daniel Krauss, Andreas Rickert, Hauke Schwiezer (alle Hrsg.): Zukunftsrepublik – 80 Vorausdenker*innen springen in das Jahr 2030. Campus 2021, 24,95 Euro.
Um ein Land zukunftsfähig zu machen, braucht es vor allem eines: kreative Köpfe, die über das Morgen hinausdenken. Darum haben die Herausgeberinnen und Herausgeber des Buchs „Zukunftsrepublik“ 80 herausragende Persönlichkeiten zusammengebracht, die unsere Zukunft mit ihren Ideen entscheidend prägen werden. Das Buch ist ein Feuerwerk an Zukunftsvisionen, persönlichen Einschätzungen und Wegweisern für die sechs Kategorien Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit, Politik und Gesellschaft. Marie-Christine Ostermann, Celine Flores Willers, Miriam Wohlfarth, Daniel Krauss, Andreas Rickert, Hauke Schwiezer (alle Hrsg.): Zukunftsrepublik – 80 Vorausdenker*innen springen in das Jahr 2030. Campus 2021, 24,95 Euro.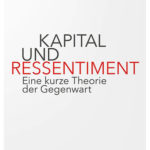 Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung. Joseph Vogl rekonstruiert in seiner Analyse, wie im digitalen Zeitalter ganz neue unternehmerische Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über nationale Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen. Joseph Vogl: Kapital und Ressentiment. C.H. Beck 2021, 18 Euro.
Es zieht sich eine Spur der Zerstörung von der Herrschaft der Finanzmärkte über die neuen Netzgiganten bis hin zur dynamisierten Meinungsindustrie. Auf der Strecke bleiben dabei Demokratie, Freiheit und soziale Verantwortung. Joseph Vogl rekonstruiert in seiner Analyse, wie im digitalen Zeitalter ganz neue unternehmerische Machtformen entstanden sind, die unser vertrautes politisches Universum mit einer eigenen Bewertungslogik überschreiben und über nationale Grenzen hinweg immer massiver in die Entscheidungsprozesse von Regierungen, Gesellschaften und Volkswirtschaften eingreifen. Joseph Vogl: Kapital und Ressentiment. C.H. Beck 2021, 18 Euro.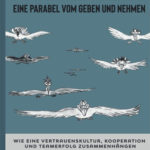 In vielen Unternehmen werden das geschäftliche Miteinander sowie die Arbeitsabläufe noch immer von Konkurrenzdenken und Egoismus dominiert. Dabei ist das, was vor hundert Jahren noch die Norm und erfolgversprechend war, schon längst überholt. Anhand einer Parabel, die veranschaulicht, wie wichtig Vertrauen und Teamwork für eine nachhaltige Unternehmenskultur und für eine erfolgreiches Personalmanagement sind, zeigt Sofie Klos, dass Kooperation und Vertrauen langfristig betrachtet deutlich erfolgreicher sind. Die Autorin stellt unterschiedliche Kooperationsstrategien vor, die sinnbildlich anhand des Verhaltens von Vögeln bei einem Wettflug betrachtet und analysiert werden. Sofie Klos: Die Wildgans-Strategie. Cherry Media 2020, 14,90 Euro.
In vielen Unternehmen werden das geschäftliche Miteinander sowie die Arbeitsabläufe noch immer von Konkurrenzdenken und Egoismus dominiert. Dabei ist das, was vor hundert Jahren noch die Norm und erfolgversprechend war, schon längst überholt. Anhand einer Parabel, die veranschaulicht, wie wichtig Vertrauen und Teamwork für eine nachhaltige Unternehmenskultur und für eine erfolgreiches Personalmanagement sind, zeigt Sofie Klos, dass Kooperation und Vertrauen langfristig betrachtet deutlich erfolgreicher sind. Die Autorin stellt unterschiedliche Kooperationsstrategien vor, die sinnbildlich anhand des Verhaltens von Vögeln bei einem Wettflug betrachtet und analysiert werden. Sofie Klos: Die Wildgans-Strategie. Cherry Media 2020, 14,90 Euro.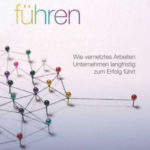 Das Buch von Eva-Maria Kraus zeigt auf, wie Führungskräfte ein strategisches Netzwerk aufbauen. Krisen wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass wir nur gemeinsam im Miteinander zu auch langfristig erfolgreichen Lösungen kommen können. Hier funktioniert kein Silodenken oder das Kleben an traditionellen Hierarchien. Eva-Maria Kraus ist überzeugt: Nur durch die Schaffung einer Kultur des Miteinander und Füreinander werden Unternehmen gerüstet in die Zukunft auch nach Corona gehen können. Hier sind die Dynamik und Kraft von strategisch vernetztem Arbeiten essenziell. Eva-Maria Kraus: Zusammen führen. Wiley-VCH 2021, 24,99 Euro.
Das Buch von Eva-Maria Kraus zeigt auf, wie Führungskräfte ein strategisches Netzwerk aufbauen. Krisen wie die Corona-Pandemie haben gezeigt, dass wir nur gemeinsam im Miteinander zu auch langfristig erfolgreichen Lösungen kommen können. Hier funktioniert kein Silodenken oder das Kleben an traditionellen Hierarchien. Eva-Maria Kraus ist überzeugt: Nur durch die Schaffung einer Kultur des Miteinander und Füreinander werden Unternehmen gerüstet in die Zukunft auch nach Corona gehen können. Hier sind die Dynamik und Kraft von strategisch vernetztem Arbeiten essenziell. Eva-Maria Kraus: Zusammen führen. Wiley-VCH 2021, 24,99 Euro. Mit Anfang 30 da sein, wo viele gern am Ende des Lebens wären: Rayk Hahne hat es geschafft. Er ist Unternehmensberater, BMX-Profisportler, Familienvater und Podcaster. Aus den über 100 Tools und Techniken, die seine Gäste wie Investor Frank Thelen oder Sportikone Marcell Jansen in seinem Podcast verraten haben, stellt er die Essenz vor. Von „Wie sieht ein perfekter (Unternehmer)Tag aus“ bis hin zu „Denke groß wie Frank Thelen“ zeigt Rayk Hahne, wie sich mit hartem Einsatz, Disziplin und einem klaren (Trainings)Plan Freiheit in allen Lebensbereichen, beruflich wie privat, erreichen lässt. Rayk Hahne: Dein perfekter Unternehmertag. FinanzBuch Verlag 2021, 17,99 Euro.
Mit Anfang 30 da sein, wo viele gern am Ende des Lebens wären: Rayk Hahne hat es geschafft. Er ist Unternehmensberater, BMX-Profisportler, Familienvater und Podcaster. Aus den über 100 Tools und Techniken, die seine Gäste wie Investor Frank Thelen oder Sportikone Marcell Jansen in seinem Podcast verraten haben, stellt er die Essenz vor. Von „Wie sieht ein perfekter (Unternehmer)Tag aus“ bis hin zu „Denke groß wie Frank Thelen“ zeigt Rayk Hahne, wie sich mit hartem Einsatz, Disziplin und einem klaren (Trainings)Plan Freiheit in allen Lebensbereichen, beruflich wie privat, erreichen lässt. Rayk Hahne: Dein perfekter Unternehmertag. FinanzBuch Verlag 2021, 17,99 Euro.
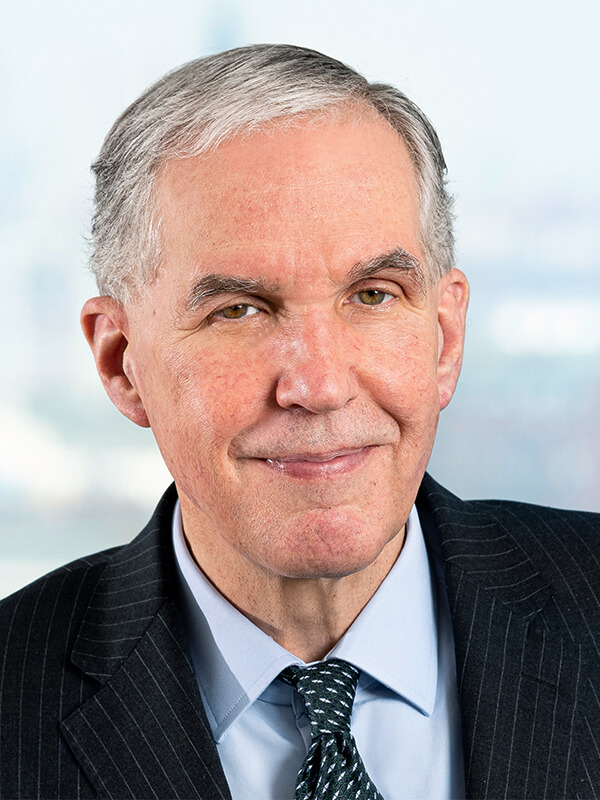
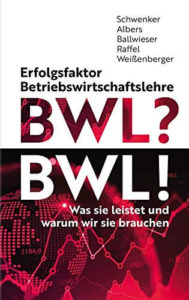 Schwenker, Albers, Ballwieser, Raffel, Weißenberger: Erfolgsfaktor Betriebswirtschaftslehre. Vahlen 2021, 24,90 Euro
Schwenker, Albers, Ballwieser, Raffel, Weißenberger: Erfolgsfaktor Betriebswirtschaftslehre. Vahlen 2021, 24,90 Euro

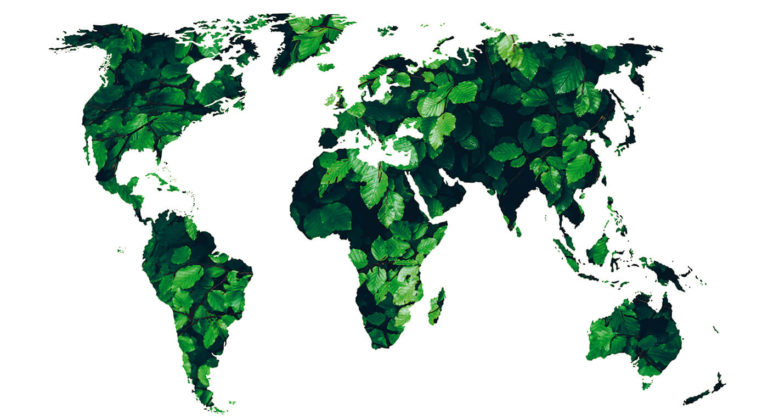
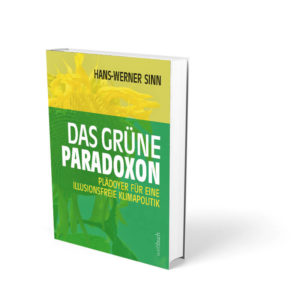 Manche Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv, sagt Hans-Werner Sinn, emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Zum Beispiel habe die Beimischung von Biosprit fatale Folgen von globalem Ausmaß, so der Autor: Wenn wir Lebensmittel tanken, pfl egen wir unser grünes Gewissen zu Lasten der Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die europäische Umweltpolitik unterliegt laut dem Professor der Illusion, dass sie durch einseitige Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen und damit der Nachfrage nach fossilen Rohstoffen die weltweite Produktion solcher Rohstoffe verringern kann. Doch was, wenn aus Angst vor einer Verschlechterung der Marktlage sogar noch mehr Rohstoffe gefördert werden? Der Autor zeigt in seinem Buch die gefährlichen Irrtümer der Umweltpolitik. Sein Plädoyer: Wenn wir unser Klima retten wollen, muss der blinde Aktionismus gestoppt und eine globale Strategie zur Verlangsamung des Ressourcenabbaus gefunden werden. Hans-Werner Sinn: Das grüne Paradoxon. Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Weltbuch Verlag 2020. 19,90 Euro
Manche Beiträge zum Klimaschutz sind nicht nur sinnlos, sondern kontraproduktiv, sagt Hans-Werner Sinn, emeritierter Hochschullehrer an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ehemaliger Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung. Zum Beispiel habe die Beimischung von Biosprit fatale Folgen von globalem Ausmaß, so der Autor: Wenn wir Lebensmittel tanken, pfl egen wir unser grünes Gewissen zu Lasten der Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Die europäische Umweltpolitik unterliegt laut dem Professor der Illusion, dass sie durch einseitige Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen und damit der Nachfrage nach fossilen Rohstoffen die weltweite Produktion solcher Rohstoffe verringern kann. Doch was, wenn aus Angst vor einer Verschlechterung der Marktlage sogar noch mehr Rohstoffe gefördert werden? Der Autor zeigt in seinem Buch die gefährlichen Irrtümer der Umweltpolitik. Sein Plädoyer: Wenn wir unser Klima retten wollen, muss der blinde Aktionismus gestoppt und eine globale Strategie zur Verlangsamung des Ressourcenabbaus gefunden werden. Hans-Werner Sinn: Das grüne Paradoxon. Plädoyer für eine illusionsfreie Klimapolitik. Weltbuch Verlag 2020. 19,90 Euro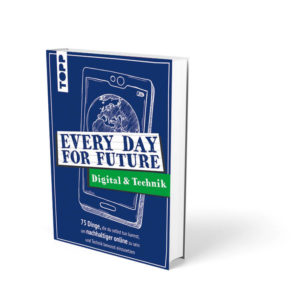 Die Buchreihe „Every Day For Future“ bietet den Leser*innen konkrete Tipps, um im Alltag das Klima zu schützen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Die Ausgabe „Digital & Technik“ zeigt, dass die scheinbar so saubere digitale Welt alles andere als klimaneutral ist. Bei den Ratschlägen für einen bewussteren Verbrauch blickt Autor Frerik Precht auf die Lebensdauer, Leistungsfähigkeit und Stromversorgung von digitalen Geräten. Nicht alle der 75 Tipps werden die Welt verbessern, aber für jeden sind einige nachhaltige Denkanstöße dabei. Frerik Precht: Every Day For Future – Digital & Technik. 75 Dinge, die du selbst tun kannst, um nachhaltiger online zu sein und Technik bewusst einzusetzen. Frech Verlag 2020. 8 Euro
Die Buchreihe „Every Day For Future“ bietet den Leser*innen konkrete Tipps, um im Alltag das Klima zu schützen und weniger Ressourcen zu verbrauchen. Die Ausgabe „Digital & Technik“ zeigt, dass die scheinbar so saubere digitale Welt alles andere als klimaneutral ist. Bei den Ratschlägen für einen bewussteren Verbrauch blickt Autor Frerik Precht auf die Lebensdauer, Leistungsfähigkeit und Stromversorgung von digitalen Geräten. Nicht alle der 75 Tipps werden die Welt verbessern, aber für jeden sind einige nachhaltige Denkanstöße dabei. Frerik Precht: Every Day For Future – Digital & Technik. 75 Dinge, die du selbst tun kannst, um nachhaltiger online zu sein und Technik bewusst einzusetzen. Frech Verlag 2020. 8 Euro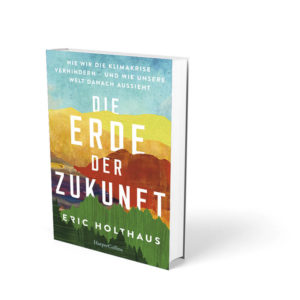 Menschen haben die Erde in den Klimakollaps gestürzt, und Menschen werden sie auch wieder aus dem Dreck ziehen. Eric Holthaus ist Meteorologe und Wissenschaftsjournalist. Er berichtet seit Jahren über Überschwemmungen, Hurrikans und Dürren. Auch er weiß: Weltweit ist das Wetter aus den Fugen geraten, die Extreme nehmen zu. Eine Klima-Apokalypse scheint unausweichlich. Doch Resignation, Ignoranz oder Zynismus sind für Holthaus keine Option. Stattdessen nimmt er uns mit in das Jahr 2050 und skizziert, wie es uns in drei Jahrzehnten gelungen sein könnte, den totalen Kollaps unserer Ökosysteme abzuwenden. Denn der erste Schritt zum Wandel, ist die Vorstellung, dass er möglich ist. Eric Holthaus: Die Erde der Zukunft. Wie wir die Klimakrise verhindern – und wie unsere Welt danach aussieht. HarperCollins 2021. 18 Euro
Menschen haben die Erde in den Klimakollaps gestürzt, und Menschen werden sie auch wieder aus dem Dreck ziehen. Eric Holthaus ist Meteorologe und Wissenschaftsjournalist. Er berichtet seit Jahren über Überschwemmungen, Hurrikans und Dürren. Auch er weiß: Weltweit ist das Wetter aus den Fugen geraten, die Extreme nehmen zu. Eine Klima-Apokalypse scheint unausweichlich. Doch Resignation, Ignoranz oder Zynismus sind für Holthaus keine Option. Stattdessen nimmt er uns mit in das Jahr 2050 und skizziert, wie es uns in drei Jahrzehnten gelungen sein könnte, den totalen Kollaps unserer Ökosysteme abzuwenden. Denn der erste Schritt zum Wandel, ist die Vorstellung, dass er möglich ist. Eric Holthaus: Die Erde der Zukunft. Wie wir die Klimakrise verhindern – und wie unsere Welt danach aussieht. HarperCollins 2021. 18 Euro
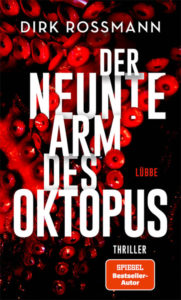 Was es mit dem Buchtitel auf sich hat? Das will Dirk Roßmann nicht verraten: „Das erfahren Sie, wenn Sie mein Buch lesen.“ Nur eines wolle er verraten: Der Oktopus habe ihn sehr fasziniert: „Er steht für das Wunder der Natur, das wir schützen müssen. Ein Oktopus ist perfekt, wie er ist, er braucht keinen weiteren Arm, er ist im Einklang mit sich, seiner Umwelt, den weiten Ozeanen, die alles verbinden und unseren Planeten zum blauen Planeten machen.“ Der Roman startet an dem Punkt, an dem die drei Supermächte China, Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen, um den Klimawandel noch in den Griff zu bekommen. Wobei die Maßnahmen der Allianz gravierend in das Leben der Menschen eingreifen – und nicht jeder diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren will.
Was es mit dem Buchtitel auf sich hat? Das will Dirk Roßmann nicht verraten: „Das erfahren Sie, wenn Sie mein Buch lesen.“ Nur eines wolle er verraten: Der Oktopus habe ihn sehr fasziniert: „Er steht für das Wunder der Natur, das wir schützen müssen. Ein Oktopus ist perfekt, wie er ist, er braucht keinen weiteren Arm, er ist im Einklang mit sich, seiner Umwelt, den weiten Ozeanen, die alles verbinden und unseren Planeten zum blauen Planeten machen.“ Der Roman startet an dem Punkt, an dem die drei Supermächte China, Russland und die USA einen radikalen Weg einschlagen, um den Klimawandel noch in den Griff zu bekommen. Wobei die Maßnahmen der Allianz gravierend in das Leben der Menschen eingreifen – und nicht jeder diese neue Wirklichkeit kampflos akzeptieren will.