Das Thema Gender-Gerechtigkeit dreht sich um einige Dimensionen weiter: In den Blick rückt die Idee einer Diversität, die unterschiedlichsten Perspektiven gerecht wird. Eine solche Vielfalt ist besonders in den Unternehmen wichtig, die mit digitaler Technik die Arbeitswelt und Gesellschaft von morgen prägen. „Diversity in Tech“ wird somit zum Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und sinnstiftendes Handeln.
Die Unternehmensberatung McKinsey hat in der aktuellen Studie „Diversity wins!“ untersucht, wie sich der Zusammenhang zwischen dem Geschäftserfolg eines Unternehmens und der Vielfalt der Teams entwickelt. Dass das eine vom anderen beeinflusst wird, hatte sich schon in früheren Studien gezeigt. Für den aktualisierten Report haben die Expert*innen von McKinsey 1000 Unternehmen aus 15 Ländern befragt, das Resultat: Der Zusammenhang ist stärker denn je. „Je diverser, desto erfolgreicher“, so bringt McKinsey das Ergebnis in einer zusammenfassenden Pressemitteilung auf den Punkt. Die genannten Zahlen sprechen für sich: „Unternehmen mit hoher Gender-Diversität haben eine um 25 Prozent und damit signifikant größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein (2014 lag der Wert noch bei 15 Prozent). Betrachtet man den Faktor der ethnischen Diversität (Internationalität des Vorstands), liegt dieser Wert sogar bei 36 Prozent.“ Mit Blick auf die Pandemie wird McKinsey-Partnerin und Diversity-Expertin Julia Sperling in der Meldung wie folgt zitiert: „Umso wichtiger ist es, dass im aktuellen Krisenmodus die Förderung von Inklusion und Diversität nicht auf der Strecke bleibt.“
Vielfalt ist da – nutzen wir sie!
Vielfalt bringt’s also auch wirtschaftlich – davon ist heute auch die Mehrzahl der deutschen Unternehmen überzeugt. „Zwei Drittel aller Unternehmen in Deutschland sehen mit Diversity Management konkrete Vorteile für ihr Unternehmen verbunden“, heißt es in der aktuellen Studie „Diversity Trends“, die der Verein Charta der Vielfalt vorgelegt hat. Tendenz steigend: „63 Prozent der Unternehmen erwarten, dass Diversity Management zukünftig noch stärker an Relevanz gewinnt.“ Was dabei die Vorteile sind, die sich konkret aus der Vielfalt in Teams und im Leadership ergeben? Die Studie nennt hier „insbesondere die Attraktivität für bestehende und neue Beschäftigte, die Offenheit und Lernfähigkeit der Organisation sowie die Förderung von Innovation und Kreativität“. Kurz: Diversity ist attraktiv, offen und kreativ. Für das Recruiting sind das immens wichtige Faktoren.
Zugespitzt wird das Thema Vielfalt häufig auf die Gender-Frage, insbesondere auf Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten. Das ist ein zentraler Aspekt, keine Frage. Aber Vielfalt geht weit darüber hinaus.
Grundlage für die Vereinsarbeit der Charta der Vielfalt ist eine Selbstverpflichtung der teilnehmenden Unternehmen, Diversity zu fördern. Mehr als 3800 deutsche Organisationen haben die Charta der Vielfalt mittlerweile unterzeichnet. Vorstandsvorsitzende ist Ana-Cristina Grohnert, im Gespräch mit dem karriereführer sagt sie: „Zugespitzt wird das Thema Vielfalt häufig auf die Gender-Frage, insbesondere auf Frauenquoten in Vorständen und Aufsichtsräten. Das ist ein zentraler Aspekt, keine Frage. Aber Vielfalt geht weit darüber hinaus.“ Ihr Ansatz: Jede*r hat das Recht, als Individuum anerkannt zu werden. Was natürlich auch heißt, dass man jeweils den anderen genauso anerkennt. Ana-Cristina Grohnert fasst den Trend so zusammen: „Es geht weg vom Ego, hin zur Gemeinschaft.“ Wobei man eine solche vielfältige Community nicht künstlich erschaffen müsse. Denn sie ist ja da: „Vielfalt ist in unserer Gesellschaft vorhanden. Nutzen wir das! Sorgen wir dafür, dass wir Teilhabe gewähren, statt andere einzuschränken!“
Diversity in Tech: Mit Vielfalt die Zukunft gestalten
Was nach Sozialromantik klingt, besitzt für Ana-Cristina Grohnert eine knallharte ökonomische Dimension. „Wer versucht, um Diversity Management herumzukommen, der kann schnell den Anschluss verlieren“, sagt sie. Die Pandemie habe die Relevanz der Vielfalt noch verschärft: Es lasse sich, so Grohnert, beobachten, dass diejenigen Unternehmen, die sich schon länger und umfangreicher mit Diversity Management beschäftigten, flexibler auf die Corona-Krise reagieren konnten. Ein Indiz dafür nennt die Studie der Charta der Vielfalt: „Unternehmen mit einem hohen Engagement in Sachen Diversity setzen unter anderem deutlich stärker auf mobiles Arbeiten.“ Als es galt, im Zuge der Krise schnell umzuswitchen, hatten vielfältig aufgestellte Unternehmen einen enormen Startvorteil.
Diversity Management
Der Verein Charta der Vielfalt zeigt auf seiner Homepage, welche Aspekte ein zeitgemäßes Diversity Management aufgreifen sollte:
- Der Nutzen: Wie und wo kann Diversity Management im Hinblick auf Kundschaft und Klientel hilfreich sein?
- Die Ausgangssituation: Wie sind die Belegschaft, die Kundschaft und die zuliefernden Unternehmen zusammengesetzt? Welche Diversity-Maßnahmen sind bereits vorhanden?
- Die Planung: Wie lässt sich Diversity in der Organisation einführen oder stärken?
- Die Umsetzung: Welche Stationen führen zum Ziel? In welcher Zeit sollen konkrete Maßnahmen umgesetzt worden sein? Wie werden sie im Unternehmen kommuniziert?
- Der Erfolg: Welche Wirkung haben die Maßnahmen gebracht? Wie lassen sie sich jeweils optimieren, einstellen oder auf andere Bereiche ausweiten?
Eine besondere Dynamik entwickelt das Thema Vielfalt dort, wo das Entwicklungstempo hoch ist. Im Brennpunkt steht „Diversity in Tech“: Das Leben der Menschen wird immer stärker durchtechnisiert, durchdigitalisiert. Entsprechend wichtig ist es, dass bei der Gestaltung dieses Prozesses die Bedürfnisse und Anliegen aller Nutzer*innen mitgedacht werden. Vorbei die Zeit, als sich technische und digitale Anwendungen an eine bestimmte Kundschaft richteten: Die Digitalisierung betrifft jede*n. Daher muss sie auch für jede*n nach den jeweiligen Bedürfnissen gestaltet werden. Was wiederum nur funktioniert, wenn die Gestalter*innen selbst vielfältig aufgestellt sind. „Diversity in Tech“ ist damit auch ein Gesellschaftsthema: Wenn die Unternehmen mit ihren Aktivitäten den Purpose – also den Sinn – verfolgen, das Leben der Menschen besser, sicherer, komfortabler zu machen, dann müssen sie in einem ersten Schritt zunächst einmal analysieren, was sich verschiedene Gruppen unter einem besseren Leben vorstellen. Und das gelingt nur dann, wenn sich das Leben in seiner Vielfalt auch in den Unternehmensteams selbst widerspiegelt. Bis hinauf auf die Führungsebene.
VUKA-Welt verlangt nach Vielfalt
Ana-Cristina Grohnert verdeutlicht die Diversity-Herausforderungen der Unternehmen mit einem kleinen Gedankenexperiment: „Ein Mensch hat ein bestimmtes Problem zu lösen, und er kommt auf drei mögliche Lösungswege. Wie viele verschiedene Ansätze würden wohl zehn Menschen finden, die genauso denken wie dieser eine Mensch? Und wie viele Lösungsansätze würden demgegenüber zehn Menschen finden, die völlig unterschiedlich denken und unterschiedliche Perspektiven einbringen?“ Die Lösung liegt auf der Hand, und die Logik, nach der verschiedene Blickwinkel das Ergebnis bereichern, besticht heute mehr denn je. In einer Epoche nämlich, die Ökonomen mit der Abkürzung VUKA zusammenfassen: Das „V“ steht für Volatilität, also für die Flüchtigkeit von Dingen, die früher einmal gewiss waren. Das „U“ steht für die Unsicherheit, die daraus folgt, für die Vielzahl an Risiken, die sich ergeben. Das „K“ steht für die Komplexität der Zeit, mit ihren vielen Trends und Themen. Das „A“ schließlich steht für Ambivalenz, für die Mehrdeutigkeit also, die schließlich dazu führt, dass bestimmte Entwicklungen anders wahrgenommen werden, wenn man sie aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
In allen diesen Punkten ist die Bedeutung von Diversity angelegt: In einer Zeit der permanenten Schwankungen, Unsicherheiten, Komplexitäten und Mehrdeutigkeiten ist es notwendig, Lösungen immer aus diversen Blickwinkeln heraus zu entwickeln. Schon aus rein pragmatischen Gründen: Eine wie auch immer definierte Einzelgruppe wäre mit der Vielzahl der zu treffenden Entscheidungen überfordert. Die Idee von „one fits for all“, also der standardisierbaren Einheitslösung, funktioniert ebenfalls nicht mehr. Und selbst die oft genutzte Methode der Best-Practice-Beispiele verliert an Aussagekraft, denn was nützt die Erfahrung, dass ein bestimmter Weg an einer Stelle gut funktioniert hat, wenn es an anderer Stelle darum geht, ganz andere Pfade zu finden?
Buchtipp:
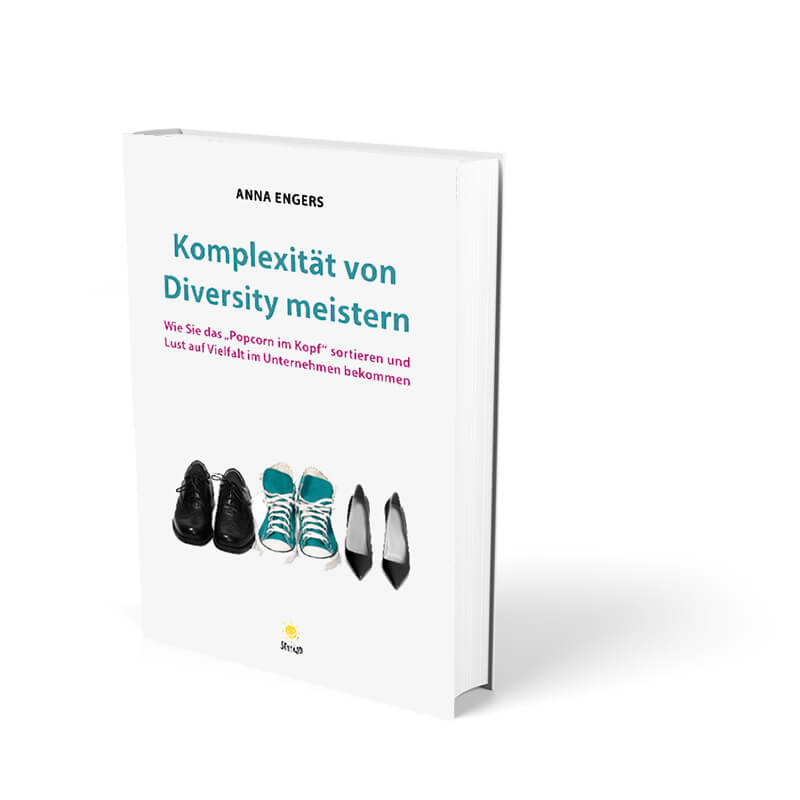 „Popcorn im Kopf“
„Popcorn im Kopf“
Für die Autorin Anna Engers hat Diversity etwas mit „Popcorn im Kopf“ zu tun: „Weil es ein so weitverzweigtes, unüberschaubares und facettenreiches Thema ist.“ Mit ihrem Buch will sie zeigen: „Diversity ist der Booster für jedes Unternehmen!“ Dabei widmet sie sich aber auch der Frage, warum so viele Akteur*innen weiterhin Probleme bei der Umsetzung von Diversity- Strategien haben. Im Buch zeigt sie auf, dass Vielfalt sehr viel mit der eigenen Haltung gegenüber Menschen zu tun hat, als Ziel gibt sie an, den Leser*innen einen anderen Blick auf das Thema zu geben, damit sie Diversity nach „Lust und Laune“ noch einmal neu denken. Anna Engers: Komplexität von Diversity meistern: Wie Sie das „Popcorn im Kopf“ sortieren und Lust auf Vielfalt im Unternehmen bekommen. Sorriso 2020. 18 Euro.
Sieben Dimensionen der Diversität
Je tiefer man ins Thema Vielfalt einsteigt, desto klarer wird, wie sehr sich das Differenzieren lohnt. Nicht, um die Sache immer weiter zu verkomplizieren. Sondern um alle Potenziale und toten Winkel ausfindig zu machen – und als Unternehmen und Nachwuchskraft davon zu profitieren. So hat der Verein der Charta der Vielfalt Anfang 2021 eine „siebte Vielfaltsdimension“ in seine Matrix aufgenommen: die soziale Herkunft. Sie gesellt sich zu den anderen Kerndimensionen dazu, dem Geschlecht sowie dem Alter, der ethnischen Herkunft sowie den körperlichen und geistigen Fähigkeiten, der Religion sowie der sexuellen Orientierung. Nun könnten Kritiker sagen, irgendwann müsse mal Schluss sein mit der Auffächerung der Vielfalt. Der gedankliche Fehler liegt hier bereits im Ansatz, die Vielfalt überhaupt begrenzen zu können.
Diversity ist dem Wesen nach nicht dazu gedacht, sie zu vereinfachen. Sie verlangt nach Differenzierung. Nicht, um das Leben komplizierter als nötig zu machen. Sondern, weil sie die Vielfalt der Persönlichkeiten annimmt. Wenn denn an dem häufig gehörten Spruch etwas dran ist, in der heutigen digitalen Zeit die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – dann funktioniert das nicht ohne Vielfalt. Menschen sind nun einmal divers. Das macht sie und den Umgang mit ihnen ja so spannend – und für Unternehmen und ihre Führungspersönlichkeiten so wertvoll: Jeder Mensch bringt eine eigene Perspektive mit ins Unternehmen. Wird Leadership diesem Potenzial gerecht, arbeiten Teams erfolgreicher. Insbesondere im Tech-Umfeld, in dem es so sehr darauf ankommt, innovativ und ideenreich zu sein.
#startupdiversity: gezielte Investments in Unternehmen von Gründerinnen
Der Digitalverband Bitkom und der Start-up-Verband schlagen mit einer gemeinsamen Initiative vor, dass Venture-Capital-Gesellschaften sich künftig dazu verpflichten, transparent darzustellen, welche ihrer Investments an Start-ups mit Gründerinnen gehen. Auch solle sich die Vielfalt im Management der Investoren widerspiegeln. Die beiden Verbände haben dafür im März dieses Jahres die Initiative #startupdiversity gestartet. „Ziel ist es, den seit Jahren bei rund 16 Prozent stagnierenden Gründerinnenanteil in Deutschland zu steigern“, heißt es in der Pressemitteilung. Teilnehmende Venture-Capital-Gesellschaften verpflichten sich demnach freiwillig, einmal jährlich Auskunft über die Verteilung in ihren Portfolio-Unternehmen sowie im eigenen Investment-Team zu geben. „Den Herausforderungen von Frauen – insbesondere mit Blick auf die Themen Finanzierung und Vernetzung – ist in den letzten Monaten mit mehr Sensibilität begegnet worden. Gleichzeitig ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch Corona zu einer echten Zerreißprobe geworden, was bestehende Probleme für Frauen weiter verschärft. Daher ist es wichtig, das Thema gerade jetzt ganz nach vorne zu stellen”, erläutert Christian Miele, Präsident des Bundesverbands Deutsche Start-ups.



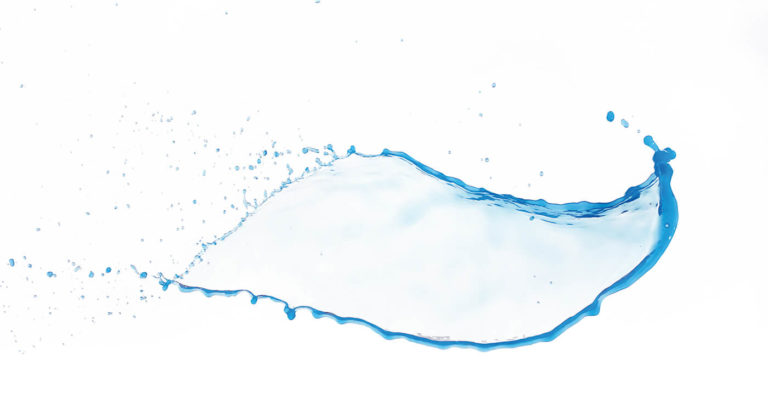




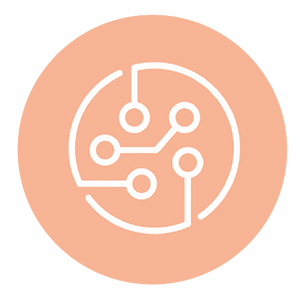



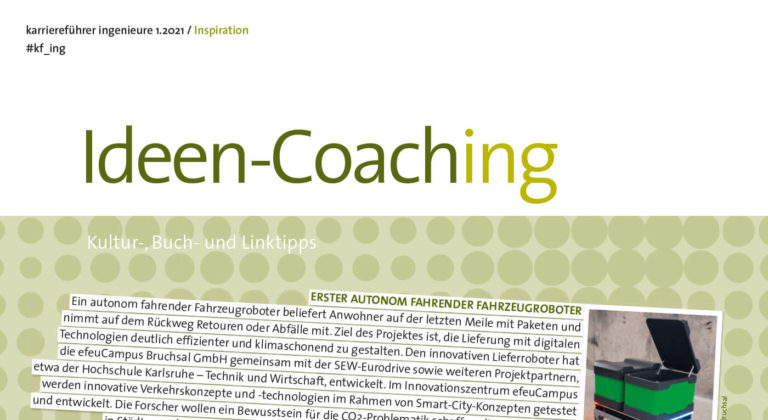


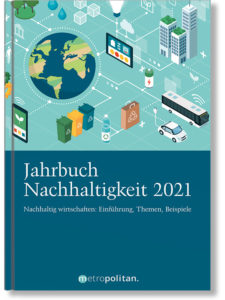 Das Jahrbuch Nachhaltigkeit 2021 gibt Impulse, um sich den wachsenden Herausforderungen der Gegenwart zu stellen: Die Erdüberlastungstag, also der Tag, an dem alle nutzbaren Ressourcen für das Jahr erschöpft sind, verlagert sich jedes Jahr nach vorn. Die Menschheit verbraucht zu viel Energie, Wasser und Rohstoffe. Beispiele aus der Praxis zeigen Pioniere im Gebiet des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements. Das Buch enthält Beiträge über neue Entwicklungen zu den Themen Kreislaufwirtschaft, Recycling, Lieferkettengesetz, Biodiversität und Wirtschaft. Relevante Netzwerke und Organisationen stellen sich vor, und es gibt eine Übersicht über wichtige Wettbewerbe und sinnvolle Zertifikate. Jahrbuch Nachhaltigkeit 2021. Nachhaltig wirtschaften: Einführung, Themen, Beispiele. Metropolitan.
Das Jahrbuch Nachhaltigkeit 2021 gibt Impulse, um sich den wachsenden Herausforderungen der Gegenwart zu stellen: Die Erdüberlastungstag, also der Tag, an dem alle nutzbaren Ressourcen für das Jahr erschöpft sind, verlagert sich jedes Jahr nach vorn. Die Menschheit verbraucht zu viel Energie, Wasser und Rohstoffe. Beispiele aus der Praxis zeigen Pioniere im Gebiet des betrieblichen Nachhaltigkeitsmanagements. Das Buch enthält Beiträge über neue Entwicklungen zu den Themen Kreislaufwirtschaft, Recycling, Lieferkettengesetz, Biodiversität und Wirtschaft. Relevante Netzwerke und Organisationen stellen sich vor, und es gibt eine Übersicht über wichtige Wettbewerbe und sinnvolle Zertifikate. Jahrbuch Nachhaltigkeit 2021. Nachhaltig wirtschaften: Einführung, Themen, Beispiele. Metropolitan. 

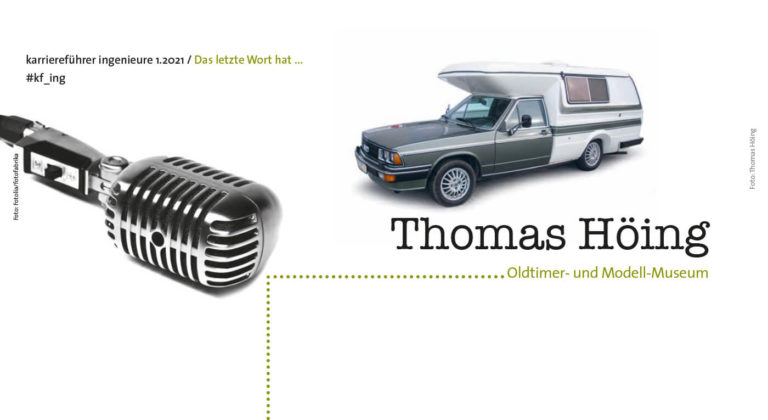




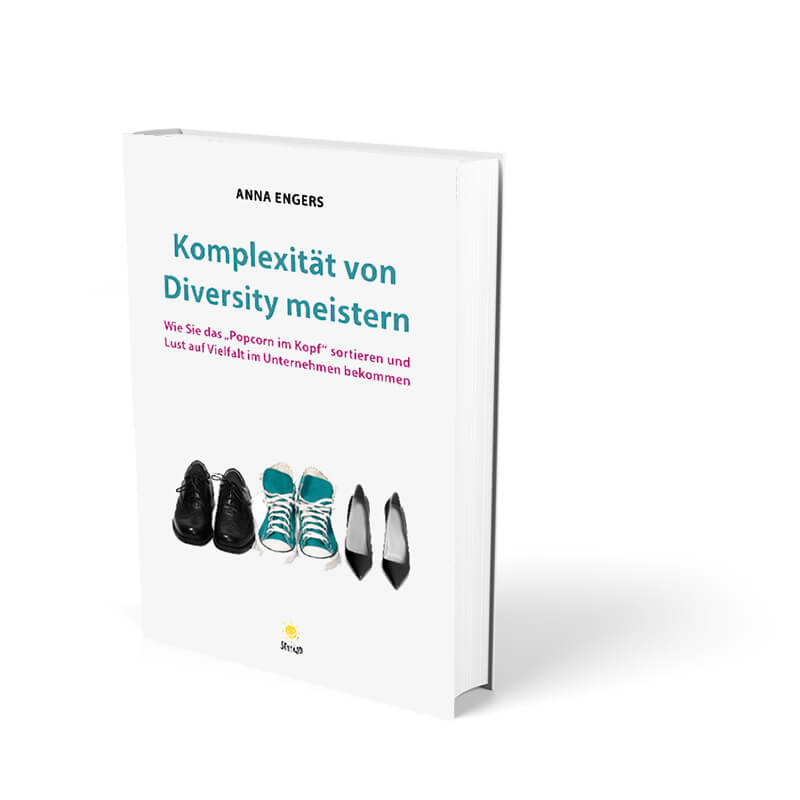 „Popcorn im Kopf“
„Popcorn im Kopf“