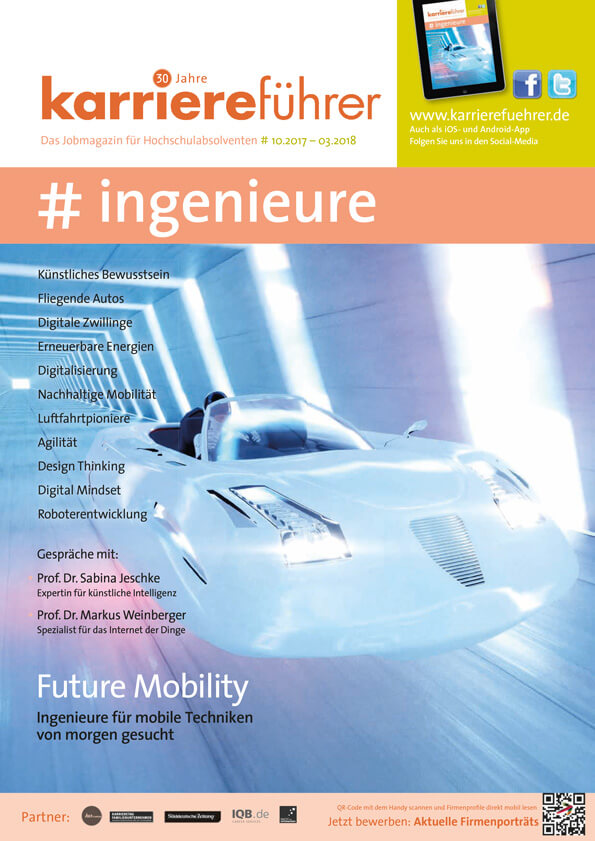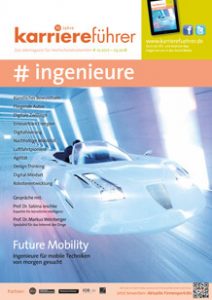Dr. Tobias Kollmann ist Professor für BWL und Wirtschaftsinformatik an der Uni Duisburg-Essen. Seine Spezialgebiete sind E-Business, E-Entrepreneurship und die digitale Transformation. Hier hat Deutschland im Vergleich zu Asien und Amerika einiges aufzuholen. Im Interview erzählt der 47-Jährige, wie das gelingen kann und welche Rolle dabei junge IT-Abenteurer spielen. Die Fragen stellte André Boße.
Herr Prof. Dr. Kollmann, vor rund einem halben Jahr haben Sie gesagt, die deutsche Wirtschaft habe die erste Halbzeit der Digitalisierung verpasst. Angenommen, die zweite Halbzeit hat gerade angefangen, beginnt nun die Aufholjagd?
Sagen wir so, wir sind zwar motiviert zur zweiten Hälfte angetreten, haben aber noch kein Tor geschossen. Was zum Beispiel weiterhin fehlt, sind relevante digitale Plattformen, die aus Deutschland heraus entwickelt wurden und zu einer zentralen Anlaufstelle im weltweiten Online-Wettbewerb geworden sind. Diese wurden in der ersten Halbzeit im B2C-Bereich, mit Blick auf die Privatkunden, hauptsächlich von amerikanischen Start-ups wie Facebook, Amazon oder Airbnb aufgebaut. Im Hinblick auf die zweite Halbzeit rund um Geschäftskunden im B2B-Bereich ist das Spiel aber noch nicht entschieden.
Zur Person
Prof. Dr. Tobias Kollmann, geboren 1970 in Bonn, studierte an den Universitäten Bonn und Trier Volkswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing. Seit Mitte der 1990er-Jahre beschäftigt er sich mit Fragen des E-Business, E-Commerce und dem Phänomen der „virtuellen Marktplätze“ und war damit einer der Pioniere auf diesem Gebiet. 2001 folgte er dem Ruf an die Uni Kiel, wo er Inhaber einer C4-Professur für E-Business wurde. Mit knapp 31 Jahren war er zu diesem Zeitpunkt der jüngste Professor auf diesem Gebiet in Deutschland. Seit April 2005 ist er Inhaber des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Business und E-Entrepreneurship, an der Universität Duisburg-Essen.
An welche Plattformen denken Sie?
Es wäre gut, wenn wir in Deutschland oder Europa eine führende Plattform für das Thema „Home Automation“ entwickeln würden. Auch eine Plattform für den digitalen Handel mit industriellen Rohstoffen im Netz halte ich für erstrebenswert. Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist die Entwicklung des zentralen Betriebssystems für das autonome Fahren, welches dann eine starke Plattform für die Mobilität der Zukunft sein könnte. Diese Liste ließe sich fortsetzen, und um im Bild zu bleiben: Wir wissen schon, wo das Tor steht. Jetzt müssen wir den Ball nur auch dort mal unterbringen.
Was ist denn der Grund für die deutsche Abschlussschwäche?
Noch kochen die meisten Unternehmen ihr eigenes Süppchen. Was im Netz jedoch zählt, ist die Reichweite und somit kritische Masse im Markt. Gerade im B2B-Bereich brauchen wir aber ein Aufbrechen von klassischen Branchenstrukturen. Das zugehörige Silo-Denken muss endlich weg! Digitale Innovationen und elektronische Geschäftsmodelle lassen sich gerade zwischen den einzelnen Branchenakteuren finden und nur gemeinsam ist man in der Lage, die zugehörigen Plattformen schnell und durchschlagend genug im Netz aufzubauen. Im Netz gilt: Lieber in einer Partnerschaft wachsen, als mit einer Einzelkämpfer- Mentalität klein zu bleiben.
Sprich: Eine Plattform gehört dann mehreren Unternehmen, die eigentlich in Konkurrenz zueinanderstehen.
Genau, denn im Internet kommt die Konkurrenz nicht aus der Nachbarschaft, sondern aus Amerika und Asien. Und gerade Amazon-B2B und Alibaba haben sich schon auf den Weg gemacht, auch die Online-Welt der Geschäftskunden an sich zu reißen. Deswegen brauchen wir hier neue Allianzen zwischen den Industrie-Unternehmen aus Deutschland und Europa. Noch haben wir im B2B-Bereich den Zugang zu den Märkten und die vorhandenen Strukturen der Geschäftsbeziehungen bieten uns die Chance, diese auf eigene Plattformen im Netz zu transformieren.
Es fehlen sowohl das digitale Mindset als auch die digitalen Skills.
Was hält uns davon ab?
Es fehlen sowohl das digitale Mindset als auch die digitalen Skills. Weder hat sich bislang ein Digital Leadership in den meisten Führungsetagen durchgesetzt noch beobachten wir, dass die Mitarbeiter auf allen Ebenen eines Unternehmens über digitale Kompetenzen verfügen. Hinzu kommt, dass nur zehn von 468 Aufsichtsräten der DAX30-Unternehmen im Jahr 2016 auf ein eigenes digitales Fachwissen aufgrund von Ausbildung oder Erfahrung zurückgreifen konnten. Woher sollen also die Impulse einerseits und die Rückendeckung andererseits für risikoreiche Digitalprojekte kommen? Das führt oftmals zum Stillstand und Abwarten und das ist auf kurze und lange Sicht fatal, denn das Internet wartet auf niemanden.
Was können junge Mitarbeiter mit viel digitalem Know-how in den Unternehmen erreichen?
Wenn oben die digitalen Köpfe fehlen, dann können sie die digitale Revolution von unten sein. Dafür brauchen wir aber junge Leute, die neben einem digitalen Mindset auch mit den notwendigen digitalen Skills über unsere Ausbildungssysteme in Verbindung gekommen sind. In der Kombination haben sie dann hervorragende Karrieremöglichkeiten, die in der Spitze bis hin zum Chief Digital Officer auf Vorstandsebene gehen können. Dabei geht es nicht nur um IT wie beim Chief Information Officer, sondern um einen ganzheitlichen Management-Ansatz für die digitale Transformation der Unternehmensstrategie und den Aufbau neuer digitaler Geschäftsmodelle und -prozesse.
Was raten Sie einem Absolventen mit großer digitaler Abenteuerlust: Sollte er diesen Kampf in einem der großen Konzerne antreten oder es bei oder sogar mit einem eigenen Start-up-Unternehmen versuchen?
Beides ist lohnenswert und kann sogar miteinander verbunden werden. Die Grundlagen dafür, mit einem eigenen Start-up im Internet etwas auf die Beine zu stellen, sind so gut wie nie. Man kann hier mit einer guten Geschäftsidee und der zugehörigen Umsetzung im Rahmen der Programmierung in kurzer Zeit wirklich viel erreichen. Und die Konzerne suchen seit einiger Zeit bewusst den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Start-ups, weil diese viel schneller die digitalen Innovationen entwickeln können als sie in ihren starren Strukturen selbst. Dadurch ergeben sich viele gute Anschlussmöglichkeiten zwischen der Start-up-Szene und der Welt der Konzerne.
Und wenn das eigene Start-up krachend scheitert?
Dann ist das heute und gerade in der digitalen Branche schon längst kein Beinbruch mehr. Scheitern gehört hier zum Geschäft und dient am Ende dem Erfahrungsaufbau. Da wir immer noch nicht sicher wissen, was wie und wann im Netz funktioniert, muss man keine Angst mehr haben, mit einem lebenslangen Makel rumzulaufen, wenn man sein Start-up gegen die Wand fährt. Das haben auch Konzerne längst erkannt und schielen sogar auf die Gründer dieser Start-ups, um ihnen einen Anschluss in die eigenen Digital- Strukturen zu ermöglichen.
„Deutschland 4.0 – Wie die Digitale Transformation gelingt“
Zusammen mit dem Journalisten Holger Schmidt zeigt Tobias Kollmann in diesem Buch auf, wie Deutschland als führende Industrienation auch in der digitalen Wirtschaft ein starker Akteur werden kann. Deutschland verfügt über unzählige Weltmarktführer in den klassischen Wirtschaftsbranchen, bisher aber über keinen digitalen Champion. Die großen Player aus dem Internet wie Google, Facebook & Co. dringen zunehmend auch in die realen Wirtschaftsbranchen ein und wollen hier die Spielregeln verändern. Vor diesem Hintergrund analysieren die Autoren die Rahmenbedingungen eines digitalen Wandels für unsere Wirtschaft und Gesellschaft, beleuchten die aktuellen Entwicklungen und geben Hinweise auf die notwendigen Änderungen für die Zukunft.
Wie beurteilen Sie die Kooperationen zwischen Konzernen und Start-ups?
Für mich liegt hier der wesentliche Schlüssel für den Erfolg unserer digitalen Wirtschaft. Die einen haben noch den Zugang zu den Märkten, die anderen haben die digitalen Innovationen und den Mut, diese umzusetzen. Daraus ergibt sich eine Win-win-Situation: Die Konzerne erhalten genau die Portion „digitale Abenteuerlust“, die ihnen fehlt; die Start-ups bekommen ein „reales Trampolin“, um durchzustarten. Achten müssen beide Seiten aber darauf, sich nicht gegenseitig die eigene Kultur aufzuzwingen. Ein Start-up muss flexibel, schnell und ohne große Genehmigungsstrukturen agieren können – und umgekehrt kann ein Konzern nur ein planungssicheres und ausgereiftes digitales Angebot seinen Kunden offerieren. Es geht darum, diese Eigenständigkeit zu bewahren und das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen.
Alle suchen aktuell die dringend benötigten IT-Fachkräfte. Wie beurteilen Sie in dieser Hinsicht die Ausbildung an den Hochschulen?
Zunächst muss man einmal festhalten, dass die digitale Transformation nicht durch einen Knopf im EDV-System realisiert werden kann. Ich glaube deswegen nicht, dass exzellente Programmierer alleine in der Lage sein werden, die deutsche Wettbewerbsstärke in der digitalen Wirtschaft zu erhalten. Was wir neben den IT-Kräften also auch brauchen, ist ein umfassendes Digital Management – also Mitarbeiter und Führungskräfte, die nicht nur die digitale Technik verstehen, sondern auch erkennen, welche neuen digitalen Geschäftsmodelle und -prozesse daraus entstehen können. Ich würde mir daher wünschen, dass unsere Hochschulen über neue integrative Studiengänge an der Schnittstelle von Informatik, Wirtschaftsinformatik und BWL nachdenken würden. Das würde zu mehr digitalen Köpfen führen, die ganzheitlich und wertschöpfend unsere Unternehmen ins digitale Zeitalter führen. Davon gibt es im Moment nämlich noch viel weniger als reine IT-Spezialisten.





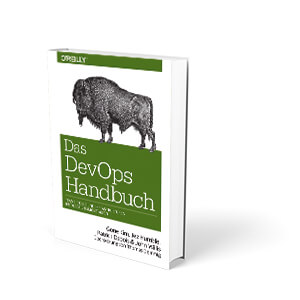 Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis: Das DevOps-Handbuch. O’Reilly 2017. 39,90 Euro.
Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois, John Willis: Das DevOps-Handbuch. O’Reilly 2017. 39,90 Euro.



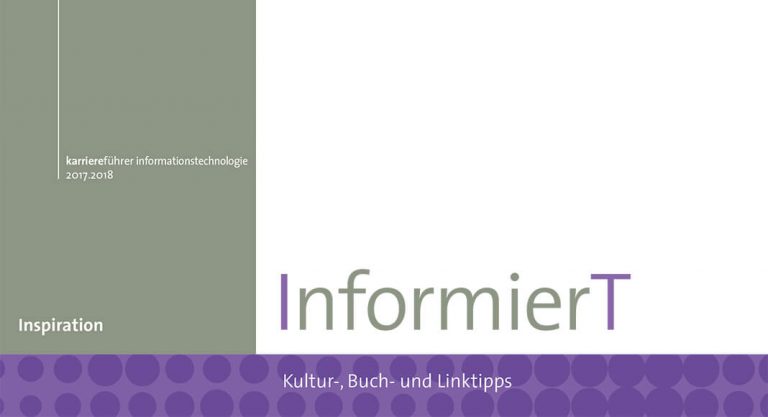

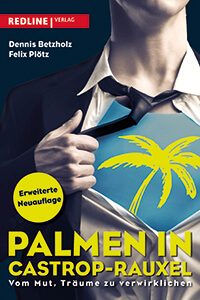 Ob man davon träumt, ein Start-up zu gründen, als Star gefeiert zu werden oder die Welt ein bisschen zu verbessern – das Buch „Palmen in Castrop-Rauxel zeigt anhand von 14 Geschichten, wie Träume ganz nebenbei realisierst werden können, ohne großes Startkapital und ohne gleich zu kündigen. Aufgezeigt wird auch, mit was man auf diesem Weg rechnen sollte und wie man trotz aller Rückschläge und Hindernisse ans Ziel kommt. Dennis Betzholz, Felix Plötz: Palmen in Castrop-Rauxel. Redline 2017. 14,99 Euro.
Ob man davon träumt, ein Start-up zu gründen, als Star gefeiert zu werden oder die Welt ein bisschen zu verbessern – das Buch „Palmen in Castrop-Rauxel zeigt anhand von 14 Geschichten, wie Träume ganz nebenbei realisierst werden können, ohne großes Startkapital und ohne gleich zu kündigen. Aufgezeigt wird auch, mit was man auf diesem Weg rechnen sollte und wie man trotz aller Rückschläge und Hindernisse ans Ziel kommt. Dennis Betzholz, Felix Plötz: Palmen in Castrop-Rauxel. Redline 2017. 14,99 Euro. Mit der visuellen Programmiersprache Scratch lässt sich spielerisch das Programmieren lernen. Dabei werden Puzzlestücke im Browser so miteinander kombiniert, dass Befehle an den Computer übertragen werden, die dieser dann ausführt. Mit auf diese Weise erstellten Programmen kann nicht nur ein Computer, sondern auch Mikrocontroller wie der Arduino oder der Calliope mini gesteuert werden. Erik Bartmann: Mit Scratch die elektronische Welt entdecken. Bombini 2017. 34,95 Euro.
Mit der visuellen Programmiersprache Scratch lässt sich spielerisch das Programmieren lernen. Dabei werden Puzzlestücke im Browser so miteinander kombiniert, dass Befehle an den Computer übertragen werden, die dieser dann ausführt. Mit auf diese Weise erstellten Programmen kann nicht nur ein Computer, sondern auch Mikrocontroller wie der Arduino oder der Calliope mini gesteuert werden. Erik Bartmann: Mit Scratch die elektronische Welt entdecken. Bombini 2017. 34,95 Euro.
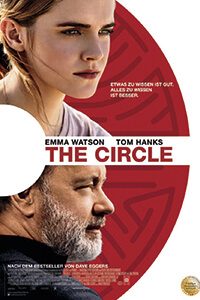 2013 erschien der von Dave Eggers geschriebene Roman „The Circle“. Darin bietet ein Riesenkonzern die Dienstleistungen zahlreicher heute großer Internetfirmen aus einer Hand an und sammelt so riesige Datenmengen seiner Kunden. Der US-Regisseur James Ponsoldt hat das Buch als Vorlage für einen Science-Fiction-Thriller genommen, der ebenfalls den Titel „The Circle“ trägt. Emma Watson hat die Hauptrolle in dem Film übernommen, Tom Hanks spielt den Chef des Konzerns. Im Kino und ab 26. Januar 2018 auch auf DVD erhältlich. Weitere Infos unter: http://wearethecircle.de
2013 erschien der von Dave Eggers geschriebene Roman „The Circle“. Darin bietet ein Riesenkonzern die Dienstleistungen zahlreicher heute großer Internetfirmen aus einer Hand an und sammelt so riesige Datenmengen seiner Kunden. Der US-Regisseur James Ponsoldt hat das Buch als Vorlage für einen Science-Fiction-Thriller genommen, der ebenfalls den Titel „The Circle“ trägt. Emma Watson hat die Hauptrolle in dem Film übernommen, Tom Hanks spielt den Chef des Konzerns. Im Kino und ab 26. Januar 2018 auch auf DVD erhältlich. Weitere Infos unter: http://wearethecircle.de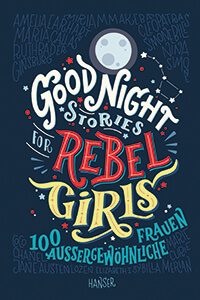 Die unter anderem im Digital-Bereich tätige Journalistin Elena Favilli und die Schriftstellerin und Theaterregisseurin Francesca Cavallo stellen zusammen in ihrem Buch „Good Night Stories for Rebel Girls“ 100 beeindruckende Frauen vor, die die Welt bewegen. Illustriert wurden die Geschichten von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt. Elena Favilli, Francesca Cavallo: Good Night Stories for Rebel Girls. Hanser 2017. 24 Euro.
Die unter anderem im Digital-Bereich tätige Journalistin Elena Favilli und die Schriftstellerin und Theaterregisseurin Francesca Cavallo stellen zusammen in ihrem Buch „Good Night Stories for Rebel Girls“ 100 beeindruckende Frauen vor, die die Welt bewegen. Illustriert wurden die Geschichten von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt. Elena Favilli, Francesca Cavallo: Good Night Stories for Rebel Girls. Hanser 2017. 24 Euro.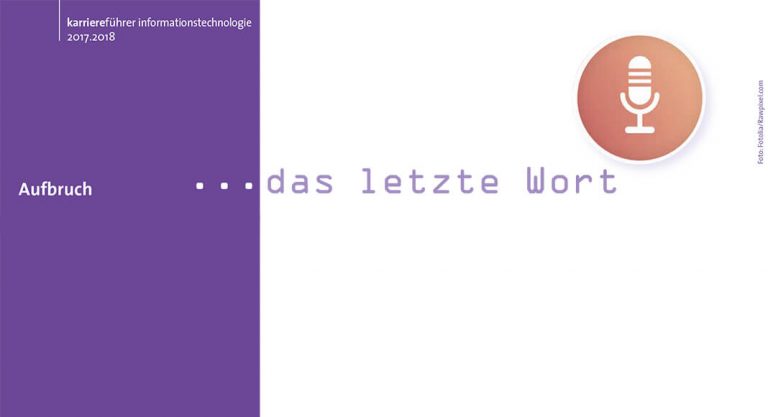
 Frau Hannig, in Ihrem Roman „Die Optimierer“ sorgen Roboter für Wohlstand und Sicherheit. Eigentlich eine ganz nette Vorstellung oder nicht?
Frau Hannig, in Ihrem Roman „Die Optimierer“ sorgen Roboter für Wohlstand und Sicherheit. Eigentlich eine ganz nette Vorstellung oder nicht?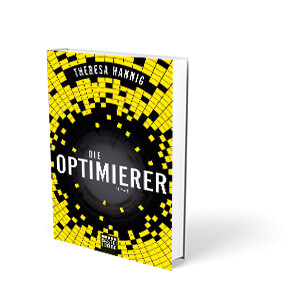 Theresa Hannig: Die Optimierer. Bastei Lübbe 2017. 10 Euro. Weitere Informationen zu Theresa Hannig unter:
Theresa Hannig: Die Optimierer. Bastei Lübbe 2017. 10 Euro. Weitere Informationen zu Theresa Hannig unter: