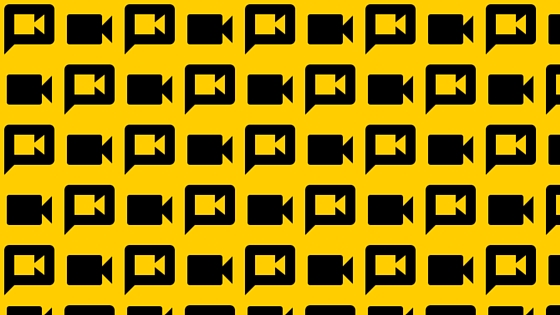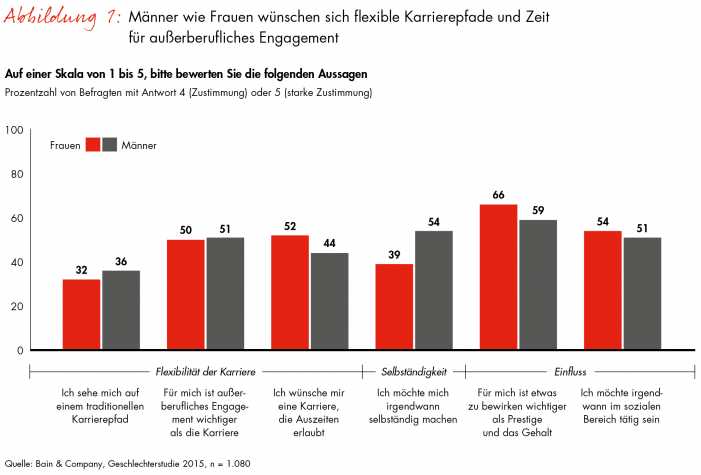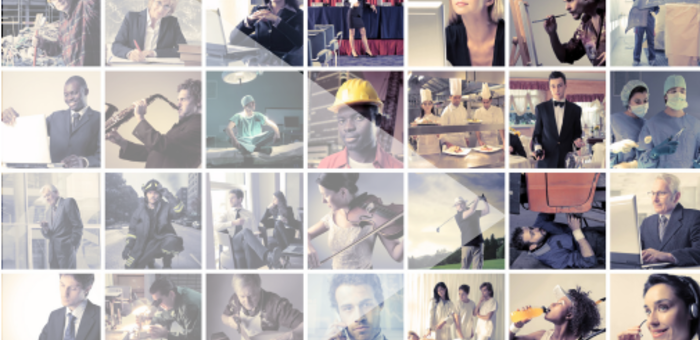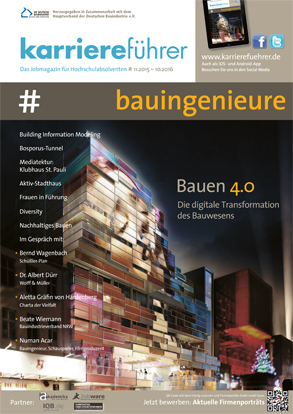Wer sich bei LIDL auf die Führungsfunktion eines Verkaufsleiters bewirbt, durchläuft einen speziell auf diese Position abgestimmten Bewerbungsprozess. Mit dem zeitversetzten Videointerview führte das Handelsunternehmen einen neuen Schritt in das Auswahlverfahren ein, der das Telefoninterview ersetzt.
Die Vorauswahl der Bewerbungen geschieht bei LIDL zunächst zentral. Bei der Lidl Personaldienstleistung werden Bewerbungs-Unterlagen gesichtet und Online-Assessments ausgewertet. Der nachfolgende Prozess bis hin zur Zusage wird dagegen von der jeweiligen Regionalgesellschaft übernommen, für die sich der Kandidat beworben hat.
Wie zeitversetzte Videointerviews funktionieren
Sobald der Bewerber das Online Assessments erfolgreich absolviert hat, erhält er von seiner Wunschregionalgesellschaft eine Einladungsmail zur Teilnahme am zeitversetzten Interview. Sieben Tage hat er nun Zeit, sich im Videointerview zu präsentieren. Hierzu loggt er sich auf einem LIDL-Internetportal ein, wo ihn der Personalleiter seiner Wunschregionalgesellschaft in einem Begrüßungsvideo willkommen heißt und Informationen bezüglich der Regionalgesellschaft und zur Tätigkeit des Verkaufsleiters gibt. In einem weiteren Video berichtet ein berufserfahrener Verkaufsleiter aus seinem Berufsalltag und gibt persönliche Tipps zur Durchführung des Videointerviews.
Verkaufsleiter bei LIDL
Zum Aufgabenfeld des Verkaufsleiters gehört neben der aktiven Betreuung von 5-6 Filialen innerhalb einer Regionalgesellschaft auch die Planung und Organisation von Vertriebsaktivitäten. Außerdem trägt er die Verantwortung für die optimale Umsetzung aller geschäftlichen Vorgaben sowie eine hohe Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.
So eingestimmt geht es an die Beantwortung der Fragen. Zuvor kann sich der Bewerber anhand eines Probeinterviews beliebig lange mit dem Interview-Prozess vertraut machen und Licht-, Video- und Tonqualität seiner Aufnahme testen. Für die Beantwortung der Fragen erhält der Kandidat – anders als im Telefoninterview – eine angemessene Vorbereitungszeit. Das ist nur fair, denn die Antwortzeit ist begrenzt – die Antworten wollen also überlegt sein. Über einen ablaufenden Zeitindikator erhält der Bewerber eine visuelle Rückmeldung über die verbleibende Zeit. Aufgezeichnet werden nur die Antworten – während der Vorbereitungszeit bleibt die Webcam ausgeschaltet.
Die Fragen unterscheiden sich dagegen nicht von denen eines Telefoninterviews: Situationsfragen („Wie reagieren Sie, wenn Sie in einer Ihrer Filialen von einem Kunden bzgl. einer Beschwerde angesprochen werden?“), Fragen zum Bewerber (z.B. Erfahrungswerte bezüglich Teamarbeit/Werdegang) und zu den Beweggründen der Bewerbung werden gestellt. Auch Raum für weitere Anmerkungen über sich selbst und die Bewerbung erhält der Bewerber.
Ist das Interview beendet, erhält der Personalleiter der jeweiligen Regionalgesellschaft eine automatische E-Mail, die ihn über den Abschluss des Interviews durch den Bewerber informiert, das er dann nach objektiven und kompetenzbasierten Kriterien auswerten kann.
Was sind die Vorteile des zeitversetzten Videointerviews?
Ein Jobinterview zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort zu führen, spart Bewerbern wie Personalern Zeit. Rund 15 Minuten dauert ein Videointerview. Ein klassisches Telefoninterview ist dagegen drei Mal so lang. Weil die Einladung zum Videointerview gleichzeitig mit der Weiterleitung des Bewerbers an die Regionalgesellschaft erfolgt (und die Regionalgesellschaft nach Eingang der Online Assessment-Ergebnisse den Bewerber nicht erst noch für das Telefoninterview einladen muss), wird der Auswahlprozess um rund 6 Werktage verkürzt. Außerdem kann der Personalleiter, anders als im Telefoninterview, die Sozialkompetenz des Kandidaten anhand von Gestik und Mimik besser einschätzen und beurteilen und das Video zur effizienteren Bewertung beliebig oft ansehen.
Hauptziel für den Einsatz des zeitversetzten Videointerviews im Auswahlverfahren ist letztlich, neben Effizienz und Zeitersparnis, mehr angehende Verkaufsleiter einzustellen. Eine einjährige Pilot-Studie führte zu der Erkenntnis, dass im Vergleich zum klassischen Telefoninterview zwar ein kleinerer Prozentsatz der Teilnehmer zum Auswahltag eingeladen, jedoch letztendlich ein größerer Anteil eingestellt wurde.
Auch wenn das zeitversetzte Interview für Bewerber noch ungewohnt ist, die im Video zur Verfügung gestellten Informationen, der persönliche Eindruck vom Personalleiter und die Benutzerfreundlichkeit des Systems werden von einer Vielzahl der im Rahmen der Studie befragten Bewerber als sehr hilfreich empfunden.
Buchtipp:
Markus Valley: Das VideoTrainingsBuch. Der Multimedia-Ratgeber in Sachen Videos drehen und schneiden. Markus Valley 2014. ISBN 978-3000476068. 34,90 Euro