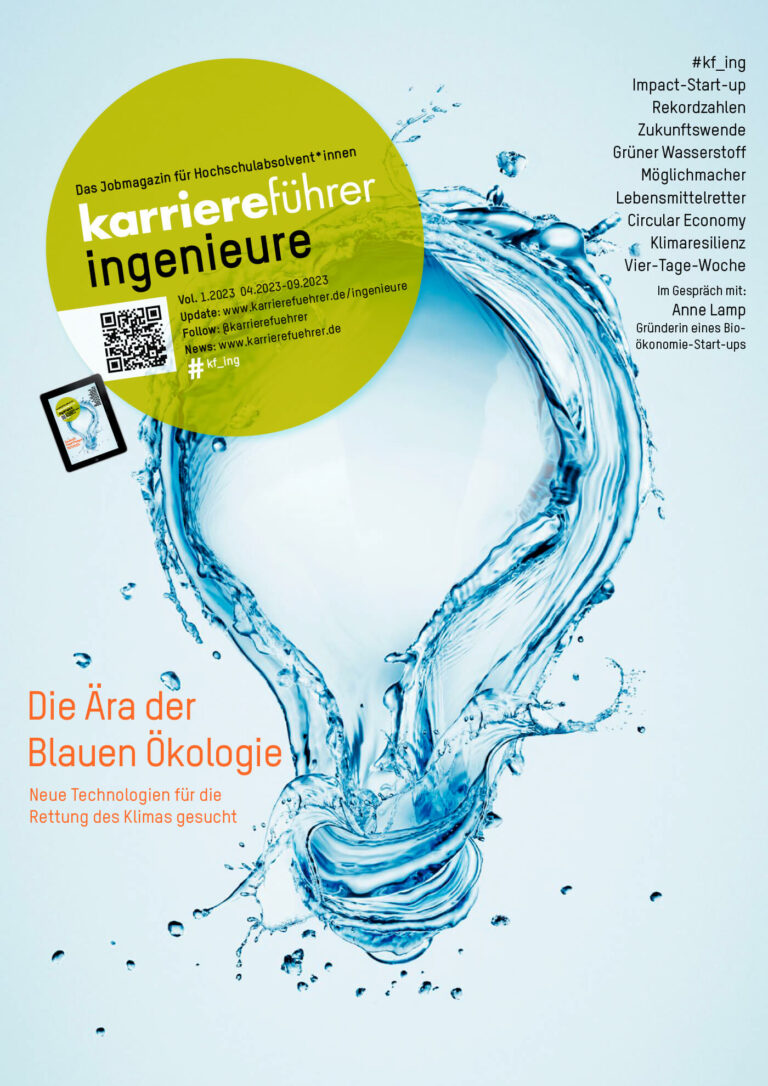Die Digitalisierung sorgt dafür, dass sich Unternehmen stärker denn je miteinander vernetzen. Es entstehen neue Partnerschaften und Geschäftsmodelle, auch Konkurrenten bauen unter dem Schlagwort „Coopetition“ strategische Zusammenschlüsse auf, um gemeinsam Vorteile zu generieren, ohne auf den Wettbewerb zu verzichten. In den Unternehmen gefragt sind daher Netzwerk-Expert*innen, die technisch und kulturell das Zeitalter der digitalen Kollaboration gestalten. Ein Essay von André Boße
Digitale Vernetzungstechniken sind auch im Alltag nicht mehr wegzudenken. Wenn sich große Gruppen auf einen Termin einigen wollen, nutzen sie Doodle. Geht es dann darum, innerhalb der Gruppe Aufgaben zu verteilen und die Erledigung dieser Aufgaben im Blick zu haben, greift man auf Produktivitätsdienste wie Trello oder Wunderlist zurück. Tools wie Slack bieten Gruppen die Möglichkeit, die Kommunikation innerhalb der Teams zu differenzieren und damit zu jeder Zeit passgenau diejenigen Adressanten zu erreichen, für die eine Nachricht bestimmt ist – ein großer Vorteil gegenüber Messenger-Gruppen wie WhatsApp, in denen alle immer alles erhalten. Online-Whiteboards von Anbietern wir Miro oder Figma ermöglichen ein gemeinsames und vernetztes Brainstorming – wobei anders als in der realen Welt nicht eine Person am Whiteboard steht und die anderen die Rollen der Zurufenden einnehmen: Bei den digitalen Diensten wird gemeinsame Kreativität gefördert. Das hat positive Effekte, weil alle mitgestalten können.
Die IT-Struktur muss an die Vernetzungstools angepasst werden, immer auch mit Blick auf die Sicherheit der unternehmenseigenen Daten und Zugriffe.
Wobei genau das auch zum Nachteil werden kann, denn wenn alle mitmachen können, bewahrheitet sich mitunter das Sprichwort von den vielen Köchen, die den Brei verderben. Entsprechend kommt es bei diesen kollaborativen Interface-Designs darauf an, die digitale Kollaboration so zu organisieren, dass das gemeinsame Arbeiten funktioniert, ohne, dass sich die vielen Akteure dabei gegenseitig im Weg stehen oder die eine Hand nicht mehr weiß, was die andere gerade macht. Dies gilt umso mehr dort, wo sich Kollaboration deutlich komplexer gestaltet, als dies in der Alltagswelt der Fall ist. Zum einen innerhalb von Unternehmen, mit ihren vielen Abteilungen und Hierarchien. Und mehr noch unternehmensübergreifend – sprich: Wenn verschiedene Unternehmen miteinander vernetzt zusammenarbeiten. Um vielschichtige Projekte zu organisieren, zum Beispiel in der Bauwirtschaft mit Hilfe der BIM-Methode (siehe dazu auch das Top-Interview sowie das Special in dieser Ausgabe). Oder auch, um mit Hilfe digitaler Tools komplizierte Lieferketten aufzustellen und zu kontrollieren.
Gefragt: Digitales Kollaborations-Know-how
In den Unternehmen kommt es daher darauf an, für diese digitalen Kollaborationen Know-how aufzubauen. Erstens in technischer Hinsicht: Die IT-Struktur muss an die Vernetzungstools angepasst werden, immer auch mit Blick auf die Sicherheit der unternehmenseigenen Daten und Zugriffe. Zweitens ist es genauso wichtig, dass sich die Unternehmen der digitalen Kollaboration auf Management-Ebene widmen. Schließlich ermöglichen die neuen Tools die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, darunter Geschäftspartnern oder auch Konkurrenten – und verändern damit im Sinne von Trends wie Agilität, Digital-Leadership und New Work innerhalb des Unternehmens die Arbeits- und Managementkultur.
„Coopetition“: Mit dem Wettbewerber kooperieren
Die Studie „CIO-Agenda 2023“, durchgeführt von den Fachmedien CIO, CSO und Computerwoche in Kooperation mit Lufthansa Industry Solutions, hat Unternehmen nach dem Grad ihrer digitalen Kooperationen befragt. Die Ergebnisse zeigen laut Whitepaper, dass die Zusammenarbeit mit Kunden, Beratungsunternehmen und System-Administratoren am häufigsten genannt werden. „Gleichzeitig hat die Neigung, sich mit direkten Wettbewerbern oder Unternehmen aus anderen Branchen punktuell zu vernetzen und einzelne Aktivitäten sowie Ressourcen zu bündeln, erkennbar zugenommen“, heißt es im Management-Summary der Studie. Dies lasse den Schuss zu, dass „Coopetition“, also die Kooperation mit Mitbewerbern, „im Zeitalter der Digitalisierung keine Marketingfloskel mehr sei, „sondern zum Bestandteil einer Strategie geworden ist, die im Zweifel die Überlebensfähigkeit des eigenen Unternehmens sichert“. Laut Befragung kooperieren 37,6 Prozent der befragten Unternehmen bereits jetzt auf digitaler Ebene mit Wettbewerbern – also Unternehmen aus der eigenen Branche. Weitere 35,3 Prozent planen eine solche Partnerschaft.
Christoph Kappes, IT-Experte und Internet-Stratege, beschreibt den Wandel in seinem Beitrag „Digitale Kollaboration“ in der Trendstudie „Hands-on Digital“, veröffentlicht vom Zukunftsinstitut, wie folgt: „Sie (die Tools zur digitalen Kollaboration, Anm. d. Red.) können die Verabschiedung von alten Hierarchien und „Command & Control“-Prinzipien zugunsten eines selbstbestimmten, freien und selbst organisierten Arbeitens unterstützen und helfen, Unternehmen beweglicher und anpassungsfähiger zu machen. Auch deshalb ist das Verständnis digitaler Kollaborationstools und ihrer Potenziale ein wichtiger Bestandteil heutiger und künftiger unternehmerischer Kompetenzen.“
Kappes schreibt weiter, die digitalen Kollaborationstools könnten dabei helfen, „Datensilos zu vermeiden, Informationen über die Grenzen von Organisationseinheiten hinweg zu tauschen und Prozesse transparenter zu machen“. Diese Transparenz helfe dabei, dass bestimmte Verhaltensweisen in Managementprozessen verschwinden, zum Beispiel eine, die es besonders häufig im mittleren Management zu finden gebe, wie Kappes schreibt: Diese „Mittelmanager“ könnten, „nun nicht mehr nach oben sagen ‚Alles im Lot‘ und nach unten ‚Die oben spinnen wieder, lasst uns einfach weitermachen‘.“ Damit förderten digitale Kollaborationstools das Change-Management in Unternehmen: „Schriftliche Inhalte fördern Kritik und Verbesserungen, und die Transparenz der Organisation und ihrer Interaktionen stellt die Weichen für die Einführung einer fehler toleranten Kultur.“
Gaia-X: Datenstruktur nach EU-Recht
Wie stark die Wirtschaftspolitik auf das Potenzial der digitalen Kollaboration zwischen verschiedenen Akteuren setzt, zeigt Gaia-X. Das von der EU geförderte Projekt verfolgt das Ziel, eine europäische Dateninfrastruktur für sichere digitale Geschäftsmodelle aufzubauen. Die Idee dazu entstand in den deutschen und französischen Wirtschaftsministerien, umgesetzt wird es von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Studie: Digitalisierung als Weg aus der Krise
Laut einer Studie des US-Beratungsunternehmens Hackett Group aus dem März 2023 wollen sich die Führungskräfte aus den Finanzbereichen der Unternehmen auf die digitale Transformation konzentrieren, um Krisen wie Rezessionen, Inflation, geopolitische Unruhen oder den Fachkräftemangel zu bewältigen. „Als Reaktion auf die Pandemie haben die Unternehmen den Einsatz digitaler Technologien beschleunigt, und dieser Trend setzt sich fort“, fasst Shawn Fitzgerald, Senior Research Director bei The Hackett Group, die Studienergebnisse in einer Pressemitteilung zusammen. Dabei liege der Schwerpunkt darauf, sicherzustellen, dass die Investitionen auch tatsächlich einen Mehrwert erbringen. Dies gelinge, in dem Kosten gesenkt und neue Business-Modelle entwickelt werden – wobei die Befragten ein Problem in der Umsetzung sehen: Nur acht Prozent der Befragten gaben an, dass es in ihrem Unternehmen konkrete Maßnahmen gebe, um das Know-how der Mitarbeitenden bei digitalen Themen wie Daten-Analyse oder Prozess-Design zu schulen.
„Gaia-X richtet sich an Unternehmen, die ihre vielfältigen Daten austauschen oder durch diese Mehrwerte schaffen und neue datengetriebene Geschäftsmodelle entwickeln wollen“, heißt es in der Selbstbeschreibung auf der Projekthomepage. Für die damit verbundenen Datentransfers stelle Gaia-X ein „gemeinsames Regelwerk für Zugangs- und Transportprotokolle, Dienste und Richtlinien bereit.“ Das Projekt ermögliche damit den Beteiligten einen „Datenaustausch, bei dem die Dateninhaber*innen stets ihre Datensouveränität behalten. Sie können damit jederzeit ihre Daten zur Nutzung von Dritten freigeben oder diese wieder entziehen.“
Gaia-X versteht sich damit als eine Art Ökosystem für Daten, in dem sich zwischen Unternehmen und Organisationen umfassende Kollaborationen verwirklichen lassen, ohne, dass sie von regulatorischen, organisatorischen und technischen Hürden oder Sicherheitsbedenken gebremst werden.
Business durchs Anbieten, Anfragen oder Organisieren von Daten
Welche Business-Möglichkeiten sich durch solche kollaborativen Infrastrukturen für Unternehmen ergeben, zeigt das White-Paper „Gaia-X und Geschäftsmodelle: Typen und Beispiele“ auf, veröffentlicht von Peter Kraemer, Dr. Crispin Niebel und Dr. Abel Reiberg vom Gaia-X-Hub Germany im Februar 2023. Dabei skizzieren die Autoren konkrete Business- Optionen für Unternehmen, verbunden mit Job-Profilen, die im Zuge dieser Modelle entstehen werden.
So könnten Akteure erstens zu Anbietern von Daten werden. Gerade in sehr speziellen Nischen, zum Beispiel der Zulieferer für die Automobilindustrie, sammelten Unternehmen im Zuge ihrer Produktion seltene Rohdaten, heißt es im White- Paper. Diese Daten könnten die Unternehmen häufig „ohne großen zusätzlichen Aufwand – abgesehen von der Sicherstellung ausreichender Datenqualität – anbieten und dabei stets die Kontrolle über ihre Verwendung behalten“, so die Autoren. Die Seltenheit der Daten mache diese besonders wertvoll und beschere dem Unternehmen „relativ hohe zusätzliche Einkünfte“, heißt es im White-Paper.
Gefragt sind bei diesem Geschäftsmodell Data-Mining- sowie Data-Vertriebs-Expert*innen, die ein Gespür dafür mitbringen, welche dieser Daten für andere Unternehmen eine herausragende Bedeutung haben könnten. Diese Daten müssen dann so für potenzielle Kunden aufbereitet werden, damit sie dort einen direkten Nutzen generieren.
Motive für Sharing-Economy sind vielfältig
Die Unternehmen in Deutschland nutzen verstärkt Daten im eigenen Unternehmen, sind aber zugleich zurückhaltender beim Teilen eigener Daten mit Dritten geworden. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Befragung von 602 Unternehmen ab 20 Beschäftigten aus allen Wirtschaftsbereichen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Ein weiteres Ergebnis: Unternehmen, die als Daten-Anbieter auftreten, tun dies aus unterschiedlichsten Motiven. 39 Prozent wollen damit helfen, bessere Lösungen etwa für gesellschaftliche Herausforderungen zu ermöglichen. Ein Fünftel (22 %) sagt, es sei zur Daten-Bereitstellung verpflichtet. 71 Prozent profitieren aber direkt vom Daten- Angebot: 35 Prozent erzielen damit Umsätze, 34 Prozent bekommen auf diese Weise selbst Daten von anderen und 30 Prozent gewinnen neue Kunden. Sechs Prozent geben an, dadurch Kosten zu senken. Zudem sagen erstmals mehr als die Hälfte der Unternehmen (51 %), die als Anbieter oder Empfänger Teil der Data-Sharing-Economy sind, dass dies sehr stark oder eher stark zu ihrem Geschäftserfolg beiträgt (2022: 43 %). Quelle und weitere Infos: www.bitkom.org
Zweitens skizzieren die Autoren des Gaia-X-Hub Germany in ihrem Report, wie Unternehmen als Daten-Konsumenten von der digitalen Kollaboration profitieren können. Akteure zum Beispiel, die im Bereich der KI-Entwicklung tätig sind, benötigen für die Deep Learning-Verfahren eine große Menge von Daten, die – mit Blick auf Künstliche Intelligenz in der Medizin – personenbezogen und damit sensibel sind.
In diesen Unternehmen werden daher Daten-Einkäufer*innen benötigt, die mit Daten-Anbietern sowie Spezialisten für die Daten-Analyse verhandeln – und dabei unter anderem sicherstellen, dass bei der Nutzung dieser Daten die rechtlichen Regulierungen eingehalten werden. Als ein drittes Geschäftsfeld beschreiben die Autoren des White-Papers die Rolle eines „Föderators“: Gemeint sind hier Unternehmen, die ihr Know-how zur Verfügung stellen, um bei digitalen Kollaborationen zwischen Akteuren mit unterschiedlichen Interessen zu vermitteln oder Datenräume zur Verfügung stellen und diese dann organisieren und betreuen. Diese Rolle sei, so die Autoren, besonders für Unternehmen oder Einrichtungen interessant, die zwar ein hohes Ansehen in Bezug auf ihre Neutralität und Vermittlungskompetenz besitzen, denen es jedoch bislang an „digitalen Kompetenzen fehlt, um im 21. Jahrhundert ausreichend relevant zu bleiben“.
Diese „Föderatoren“ benötigen auf allen Managementebenen mutige Köpfe, die erkennen, dass Organisationen auch ohne großes IT-Know-how in der Welt der Digitalen Kollaboration eine wichtige Rolle spielen können – zum Beispiel, wenn sie fachliches Wissen in die vernetzte Zusammenarbeit bringen. Die gewinnbringende Teilnahme an der digitalen Kollaboration ist also niedrigschwelliger als skeptische Stimmen denken.
Datenökonomie erschafft Synergien
Was zeigt: Eine erfolgreiche digitale Transformation ist kein Einzelkampf, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess.
Wichtig sei, so die Autoren des White-Papers, dabei die Erkenntnis, dass die genannten Geschäftsmodelle dynamisch und kombinierbar seien. Der Report nennt das Beispiel eines Unternehmens, das Rohdaten zum Verkauf anbietet, dann aber dank des internen Daten-Know-hows feststellt, „dass aus den Daten nicht nur Erkenntnisse gewonnen werden können, die für andere von Nutzen sind, sondern auch Erkenntnisse, die für das eigene Unternehmen relevant sind“.
Häufig werde dank des „Zusammenwirkens verschiedener Geschäftsmodelle Wertschöpfung überhaupt erst ermöglicht“, schreiben die Autoren. Damit sei in einer digitalen Wirtschaft praktisch jedes erfolgreiche Unternehmen in Bezug auf vor- oder nachgelagerte Wertschöpfungsschritte mit weiteren Unternehmen verknüpft und insofern Teil eines Daten-Netzwerks. Was zeigt: Eine erfolgreiche digitale Transformation ist kein Einzelkampf, sondern ein gemeinschaftlicher Prozess.
Buchtipp:
 Gaia-X ist eines der weltweit ambitioniertesten Projekte zur Schaffung einer vernetzten Dateninfrastruktur. Das Vorhaben zielt darauf, den Austausch sowie die wirtschaftliche Nutzung von Daten in einem sicheren, souveränen Umfeld zu ermöglichen. Hierzu sollen einheitliche technische und normative Standards gesetzt werden. Dadurch entsteht ein regulatorischer Rahmen, innerhalb dessen nicht nur das hohe Datenschutzniveau Europas gewahrt, sondern auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden können. Die Publikation verfolgt das Ziel, aus wissenschaftlicher Perspektive einen deskriptiven Überblick über Entwicklung, Struktur, Funktions- und Arbeitsweise des Projekts zu geben. Zudem soll sie über die bereits feststehenden Rahmenbedingungen der künftig unter dem Label Gaia-X laufenden Netzwerke sowie die an potentielle Interessenten gerichteten Anforderungen informieren. Christian Person, Moritz Schütrumpf: Das Projekt Gaia-X: Next Generation einer förderierten Dateninfrastruktur. Zentrum verantwortungsvolle Digitalisierung 2023, freier Download unter: https://zevedi.de/aktivitaeten/dokumente
Gaia-X ist eines der weltweit ambitioniertesten Projekte zur Schaffung einer vernetzten Dateninfrastruktur. Das Vorhaben zielt darauf, den Austausch sowie die wirtschaftliche Nutzung von Daten in einem sicheren, souveränen Umfeld zu ermöglichen. Hierzu sollen einheitliche technische und normative Standards gesetzt werden. Dadurch entsteht ein regulatorischer Rahmen, innerhalb dessen nicht nur das hohe Datenschutzniveau Europas gewahrt, sondern auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden können. Die Publikation verfolgt das Ziel, aus wissenschaftlicher Perspektive einen deskriptiven Überblick über Entwicklung, Struktur, Funktions- und Arbeitsweise des Projekts zu geben. Zudem soll sie über die bereits feststehenden Rahmenbedingungen der künftig unter dem Label Gaia-X laufenden Netzwerke sowie die an potentielle Interessenten gerichteten Anforderungen informieren. Christian Person, Moritz Schütrumpf: Das Projekt Gaia-X: Next Generation einer förderierten Dateninfrastruktur. Zentrum verantwortungsvolle Digitalisierung 2023, freier Download unter: https://zevedi.de/aktivitaeten/dokumente
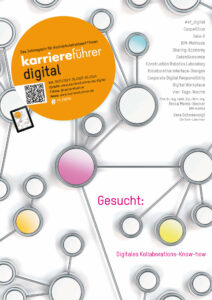



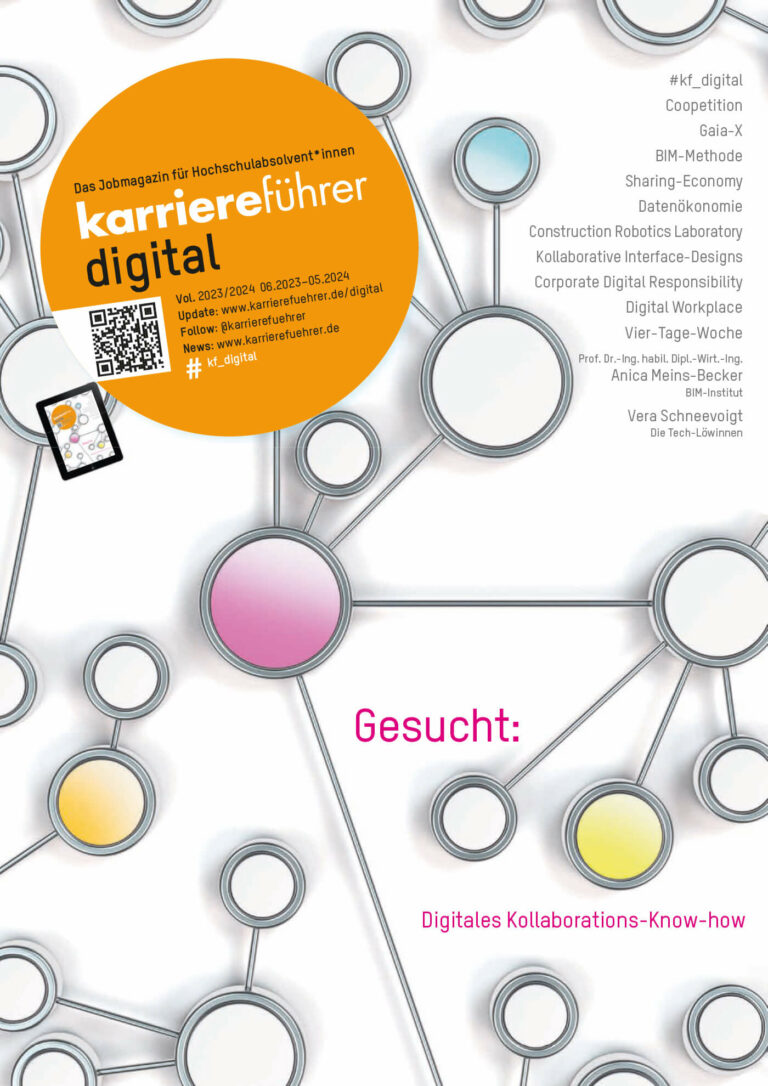
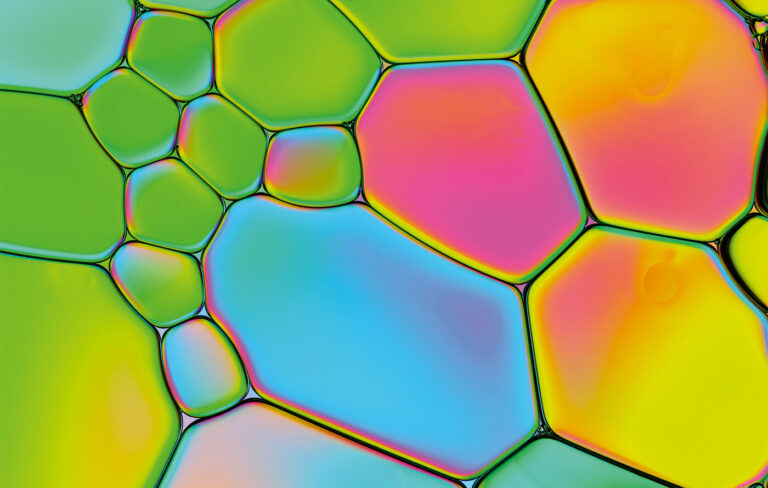
 Gaia-X ist eines der weltweit ambitioniertesten Projekte zur Schaffung einer vernetzten Dateninfrastruktur. Das Vorhaben zielt darauf, den Austausch sowie die wirtschaftliche Nutzung von Daten in einem sicheren, souveränen Umfeld zu ermöglichen. Hierzu sollen einheitliche technische und normative Standards gesetzt werden. Dadurch entsteht ein regulatorischer Rahmen, innerhalb dessen nicht nur das hohe Datenschutzniveau Europas gewahrt, sondern auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden können. Die Publikation verfolgt das Ziel, aus wissenschaftlicher Perspektive einen deskriptiven Überblick über Entwicklung, Struktur, Funktions- und Arbeitsweise des Projekts zu geben. Zudem soll sie über die bereits feststehenden Rahmenbedingungen der künftig unter dem Label Gaia-X laufenden Netzwerke sowie die an potentielle Interessenten gerichteten Anforderungen informieren. Christian Person, Moritz Schütrumpf: Das Projekt Gaia-X: Next Generation einer förderierten Dateninfrastruktur. Zentrum verantwortungsvolle Digitalisierung 2023, freier Download unter:
Gaia-X ist eines der weltweit ambitioniertesten Projekte zur Schaffung einer vernetzten Dateninfrastruktur. Das Vorhaben zielt darauf, den Austausch sowie die wirtschaftliche Nutzung von Daten in einem sicheren, souveränen Umfeld zu ermöglichen. Hierzu sollen einheitliche technische und normative Standards gesetzt werden. Dadurch entsteht ein regulatorischer Rahmen, innerhalb dessen nicht nur das hohe Datenschutzniveau Europas gewahrt, sondern auch neue datengetriebene Geschäftsmodelle entwickelt und umgesetzt werden können. Die Publikation verfolgt das Ziel, aus wissenschaftlicher Perspektive einen deskriptiven Überblick über Entwicklung, Struktur, Funktions- und Arbeitsweise des Projekts zu geben. Zudem soll sie über die bereits feststehenden Rahmenbedingungen der künftig unter dem Label Gaia-X laufenden Netzwerke sowie die an potentielle Interessenten gerichteten Anforderungen informieren. Christian Person, Moritz Schütrumpf: Das Projekt Gaia-X: Next Generation einer förderierten Dateninfrastruktur. Zentrum verantwortungsvolle Digitalisierung 2023, freier Download unter: 




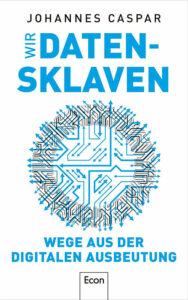 In den globalen Datengesellschaften zählen Informationen über Handeln, Denken und Fühlen der Menschen. Individualität wird massenhaft und systematisch ausgebeutet, wir werden zur Ressource einer digitalen Effizienzrevolution. Das ist gut fürs Geschäft der Datenkraken, die immer mächtiger werden. Und es nutzt Staaten, die Daten zur sozialen Steuerung und Kontrolle, bis hin zur Unterdrückung einsetzen. Johannes Caspar zeigt, dass Demokratie, Freiheit und Solidarität auf der Kippe stehen. Doch wir können etwas dagegen tun. Es gilt, Künstliche Intelligenz menschengerecht einzusetzen sowie soziale Plattformen und Dienste grundlegend zu demokratisieren. Informationelle Integrität für die Menschen und digitale Souveränität für demokratische Staaten müssen zentrale Werte werden. Der Autor diskutiert aktuelle EU-Regulierungsansätze zur Digitalisierung. Darüber hinaus entwirft er Wege, wie wir die Datenherrschaft künftig abstreifen können. Johannes Caspar: Wir Datensklaven. Econ 2023, 24,99 Euro
In den globalen Datengesellschaften zählen Informationen über Handeln, Denken und Fühlen der Menschen. Individualität wird massenhaft und systematisch ausgebeutet, wir werden zur Ressource einer digitalen Effizienzrevolution. Das ist gut fürs Geschäft der Datenkraken, die immer mächtiger werden. Und es nutzt Staaten, die Daten zur sozialen Steuerung und Kontrolle, bis hin zur Unterdrückung einsetzen. Johannes Caspar zeigt, dass Demokratie, Freiheit und Solidarität auf der Kippe stehen. Doch wir können etwas dagegen tun. Es gilt, Künstliche Intelligenz menschengerecht einzusetzen sowie soziale Plattformen und Dienste grundlegend zu demokratisieren. Informationelle Integrität für die Menschen und digitale Souveränität für demokratische Staaten müssen zentrale Werte werden. Der Autor diskutiert aktuelle EU-Regulierungsansätze zur Digitalisierung. Darüber hinaus entwirft er Wege, wie wir die Datenherrschaft künftig abstreifen können. Johannes Caspar: Wir Datensklaven. Econ 2023, 24,99 Euro
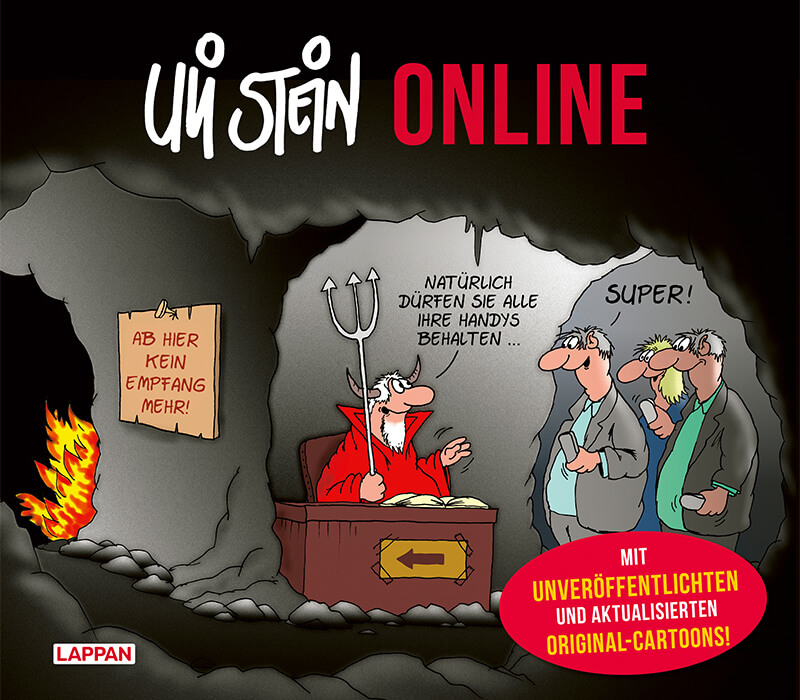 Uli Stein – ganz neu und doch ein Klassiker! Uli Steins Cartoons zum Thema Medien und Computer sind in der Digitalisierung angekommen und trotzdem ganz die Alten geblieben. Seine besten Medien-Cartoons haben ein Update bekommen und präsentieren sich aktuell und in Bestform. In diesem modernisierten Cartoonbuch sind Uli Steins Hunde, Katzen, Mäuse, Menschen und Pinguine in der digitalen Welt der Medien und des Internets angekommen. Steins Pointen zeigen, dass 99 Prozent aller Probleme vor dem Gerät sitzen. Uli Stein: Online. Lappan 2022, 12 Euro
Uli Stein – ganz neu und doch ein Klassiker! Uli Steins Cartoons zum Thema Medien und Computer sind in der Digitalisierung angekommen und trotzdem ganz die Alten geblieben. Seine besten Medien-Cartoons haben ein Update bekommen und präsentieren sich aktuell und in Bestform. In diesem modernisierten Cartoonbuch sind Uli Steins Hunde, Katzen, Mäuse, Menschen und Pinguine in der digitalen Welt der Medien und des Internets angekommen. Steins Pointen zeigen, dass 99 Prozent aller Probleme vor dem Gerät sitzen. Uli Stein: Online. Lappan 2022, 12 Euro
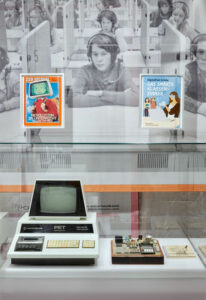 World Wide Web, Big Data, Künstliche Intelligenz – Die Digitalisierung hat in den letzten Jahrzehnten einen radikalen, alle Lebensbereiche umfassenden Wandel ausgelöst, dessen ambivalente Auswirkungen zunehmend Menschen in aller Welt betreffen. Mit mehr als 400 Objekten, Fotos und zahlreichen interaktiven Medienstationen beleuchtet das
World Wide Web, Big Data, Künstliche Intelligenz – Die Digitalisierung hat in den letzten Jahrzehnten einen radikalen, alle Lebensbereiche umfassenden Wandel ausgelöst, dessen ambivalente Auswirkungen zunehmend Menschen in aller Welt betreffen. Mit mehr als 400 Objekten, Fotos und zahlreichen interaktiven Medienstationen beleuchtet das 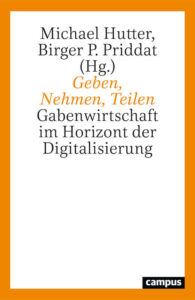 „Open source, file-sharing, crowdfunding, peer production“ – die Welt der digitalen Kommunikation ist voller Wirtschaftspraktiken, die dem Geben und Schenken näher sind als dem Marktkauf. Im Horizont der Digitalisierung wird eine Wirtschaftswissenschaft notwendig, die, um mögliche Entwicklungen einer global vernetzten Kooperationsgesellschaft zu reflektieren, neben dem Paradigma der jeweils abgeschlossenen Tauschhandlungen zwischen beliebigen Personen auch das Paradigma der endlos unabgeschlossenen Gabe zwischen miteinander verbundenen Personen gelten lässt. Michael Hutter, Birger P. Priddat (Hg.): Geben, Nehmen, Teilen. Campus 2023, 39 Euro
„Open source, file-sharing, crowdfunding, peer production“ – die Welt der digitalen Kommunikation ist voller Wirtschaftspraktiken, die dem Geben und Schenken näher sind als dem Marktkauf. Im Horizont der Digitalisierung wird eine Wirtschaftswissenschaft notwendig, die, um mögliche Entwicklungen einer global vernetzten Kooperationsgesellschaft zu reflektieren, neben dem Paradigma der jeweils abgeschlossenen Tauschhandlungen zwischen beliebigen Personen auch das Paradigma der endlos unabgeschlossenen Gabe zwischen miteinander verbundenen Personen gelten lässt. Michael Hutter, Birger P. Priddat (Hg.): Geben, Nehmen, Teilen. Campus 2023, 39 Euro
 Maximilian Krach, der Protagonist des Romans, hat alles, was sich ein im Internet sozialisierter junger Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen kann: teure Uhren, eine stattliche Anzahl Follower, eine so einfache wie geniale Geschäftsidee und einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Einzigartigkeit. Sebastian Hotz: Mindset. Kiepenheuer&Witsch 2023, 23 Euro
Maximilian Krach, der Protagonist des Romans, hat alles, was sich ein im Internet sozialisierter junger Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen kann: teure Uhren, eine stattliche Anzahl Follower, eine so einfache wie geniale Geschäftsidee und einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Einzigartigkeit. Sebastian Hotz: Mindset. Kiepenheuer&Witsch 2023, 23 Euro
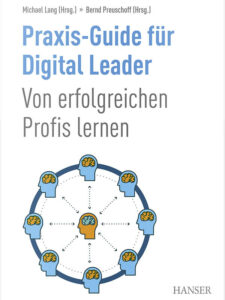 Die digitale Transformation eines Unternehmens ist kein Projekt mit einem definierten Anfang und einem definierten Ende, sondern sie verlangt ein ständiges Dranbleiben, eine ständige Bereitschaft zur Weiterentwicklung und zur Veränderung kombiniert mit einem Wissen, welche Chancen und Risiken die unterschiedlichen digitalen Möglichkeiten bieten, und vieles andere mehr. Eine Herausforderung für jeden, der die digitale Transformation eines Unternehmens starten oder weiterentwickeln will. In diesem Werk berichten Digital Leader, die allesamt selber erfolgreich die digitale Transformation eines Unternehmens begleitet haben bzw. diese noch begleiten, von ihren Erfahrungen, Strategien, Erfolgskonzepten, aber auch von Problemen, Hindernissen und Rückschlägen. Michael Lang, Bernd Preuschoff (Hg.): Praxis-Guide für Digital Leader. Hanser 2023, 59,99 Euro
Die digitale Transformation eines Unternehmens ist kein Projekt mit einem definierten Anfang und einem definierten Ende, sondern sie verlangt ein ständiges Dranbleiben, eine ständige Bereitschaft zur Weiterentwicklung und zur Veränderung kombiniert mit einem Wissen, welche Chancen und Risiken die unterschiedlichen digitalen Möglichkeiten bieten, und vieles andere mehr. Eine Herausforderung für jeden, der die digitale Transformation eines Unternehmens starten oder weiterentwickeln will. In diesem Werk berichten Digital Leader, die allesamt selber erfolgreich die digitale Transformation eines Unternehmens begleitet haben bzw. diese noch begleiten, von ihren Erfahrungen, Strategien, Erfolgskonzepten, aber auch von Problemen, Hindernissen und Rückschlägen. Michael Lang, Bernd Preuschoff (Hg.): Praxis-Guide für Digital Leader. Hanser 2023, 59,99 Euro
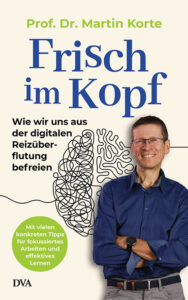 Tagsüber Online-Meetings, Bildschirmarbeit und am Abend Chatten, Shopping im Internet, Serien streamen. Wie wirkt sich die digitale Reizüberflutung, der wir uns tagtäglich aussetzen, auf unser Gehirn, unser Denken, unser Verhalten aus? In seinem neuen Buch resümiert der Neurobiologe und Erfolgsautor Prof. Dr. Martin Korte die neuesten Forschungsergebnisse und räumt dabei mit einigen Mythen auf. Darüber hinaus gibt er ganz konkrete Empfehlungen, wie unser Umgang mit den digitalen Technologien im Alltag aussehen muss, damit wir wieder konzentrierter, produktiver und kreativer arbeiten – und dabei frisch im Kopf bleiben. Martin Korte: Frisch im Kopf. DVA 2023, 24 Euro
Tagsüber Online-Meetings, Bildschirmarbeit und am Abend Chatten, Shopping im Internet, Serien streamen. Wie wirkt sich die digitale Reizüberflutung, der wir uns tagtäglich aussetzen, auf unser Gehirn, unser Denken, unser Verhalten aus? In seinem neuen Buch resümiert der Neurobiologe und Erfolgsautor Prof. Dr. Martin Korte die neuesten Forschungsergebnisse und räumt dabei mit einigen Mythen auf. Darüber hinaus gibt er ganz konkrete Empfehlungen, wie unser Umgang mit den digitalen Technologien im Alltag aussehen muss, damit wir wieder konzentrierter, produktiver und kreativer arbeiten – und dabei frisch im Kopf bleiben. Martin Korte: Frisch im Kopf. DVA 2023, 24 Euro