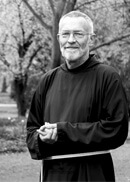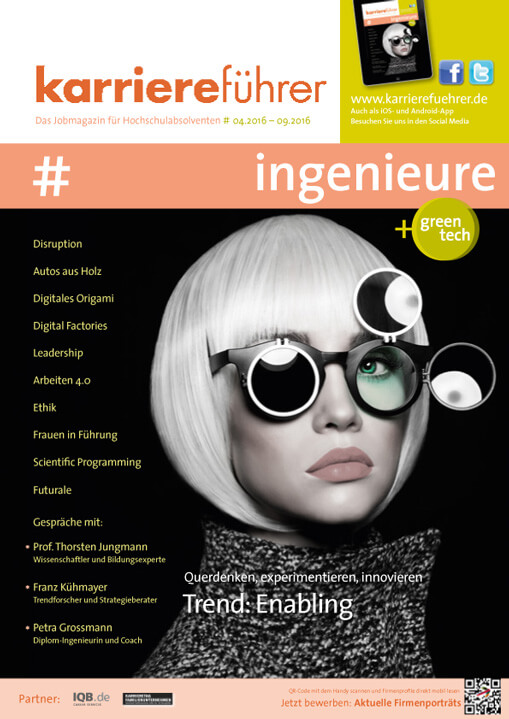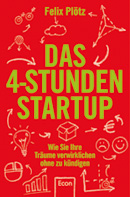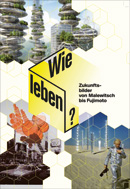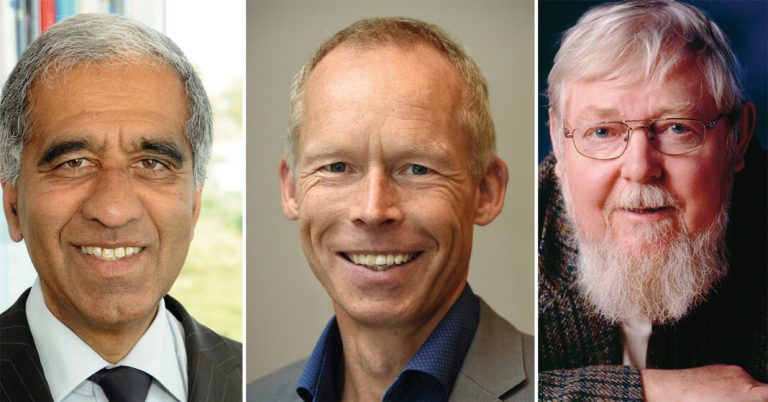Barbara Rojahn wollte nicht nur selbstständig und unabhängig arbeiten, sondern überhaupt Karriere machen – mitsamt Familie. Mit einer auf Frauen ausgerichteten Finanzberatung ist ihr das gelungen. Die Fragen stellte Christoph Berger
Frau Rojahn, Sie arbeiteten mehrere Jahre im Firmen- und Privatkundengeschäft einer deutschen Großbank. Wie kamen Sie dann zu dem Entschluss, als selbstständige und unabhängige Finanzberaterin arbeiten zu wollen? Der Entschluss kam nach der Geburt von drei Kindern. Mir war klar, dass bei den damaligen Kinderbetreuungsmöglichkeiten eine Tätigkeit als Angestellte in einer Bank oder einem Unternehmen nicht mehr möglich ist. Als Teilzeitangestellte ohne Karrierechancen wollte ich nicht arbeiten. Hinzu kam, dass ich die Tochter eines Unternehmers bin. Die Selbstständig- und Unabhängigkeit in der Beratung reizte mich sehr.Und wie kam es zur Fokussierung ganz auf Frauen? Diese Entscheidung fiel sehr spontan – sie war das Resultat eines Treffens mit Svea Kuschel in München. Svea Kuschel war zu dem damaligen Zeitpunkt eine der wenigen Frauenfinanzberaterinnen in Deutschland. Sie überzeugte mich von dem großen Potenzial bei dieser Zielgruppe. Ich nahm ihre Idee auf und war ziemlich schnell begeistert. Dieses Gefühl hält übrigens bis heute an. 1993 starteten Sie mit Ihrer Selbstständigkeit. Kümmerten sich damals schon viele Frauen um Anlageformen und Versicherungen? Damals kümmerten sich nur wenige Frauen um ihre Absicherung und um ihr Geld. Gerade die verheirateten Frauen glaubten, dass sie mit dem Beginn der Ehe lebenslang versorgt wären. Ältere Frauen erkannten meistens erst bei der Scheidung oder bei Tod des Ehepartners ihre wirkliche Situation. 1993 waren es vor allem die berufstätigen Frauen, die sich um ihre Altersvorsorge und um ihre Absicherung kümmerten. Übrigens: Die Frauen, die sich damals für eine eigene Altersvorsorge entschieden haben und inzwischen das Rentenalter erreicht haben, sind heute sehr froh, eine eigene Rente zu haben. Wie ist die Situation heute, hat sich in den letzten 23 Jahren diesbezüglich etwas verändert? Ja. Junge Frauen streben heute eher einen eigenen Beruf an und interessieren sich damit zwangsläufig und im Gegensatz zur Generation ihrer Eltern für die Absicherung von Berufsunfähigkeit und Altersvorsorge. Außerdem werden viele Frauen sowohl aktiv als auch passiv von ihren Müttern zur Selbstverantwortung angeregt: Entweder werden sie direkt aufgefordert, sich um die Finanzen zu kümmern oder sie haben mitbekommen, in welche Situation man geraten kann, wenn man es nicht tut. Was ist überhaupt der generelle Unterschied zwischen Frauen und Männern, wenn es um die Themen Altersvorsorge, Anlageverhalten und Absicherung geht? Für die meisten Männer sind der Aufbau einer Altersvorsorge und von Vermögen oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung ganz selbstverständliche Themen. Sie schließen sehr früh nach dem Start in ihr Berufsleben Verträge mit hohen monatlichen Beiträgen ab, weil sie nicht daran zweifeln, dass sie immer ein gutes Einkommen haben werden – ohne Unterbrechung. Frauen zögern mehr und sind vorsichtiger. Sie wissen nicht genau, wie sich ihr Berufsleben entwickeln wird. Die Themen bei Frauen und Männern sind also gleich, Männer sind jedoch bei der Umsetzung entschlossener. Sie selbst haben neben Ihrer Beratungstätigkeit nicht nur drei heute erwachsene Kinder großgezogen, sondern sind außerdem noch in zahlreichen Verbänden und Institutionen aktiv. Wie haben Sie alles miteinander vereint und sind allen Bereichen gerecht geworden? Mein Mann und meine Kinder haben mich bei all meinen Tätigkeiten immer unterstützt. Als die Kinder klein waren, hatte ich außerdem Au-pair-Mädchen aus der ganzen Welt. Zudem waren meine drei Kinder sehr selbstständig und haben zum Beispiel für die Schule selbst die Verantwortung übernommen. Hinzu kommt, dass ich ziemlich gut organisiert bin und viel Freude an den diversen Aktivitäten hatte und habe. Ich bin fest davon überzeugt, dass Kinder von arbeitenden und aktiven Müttern deutlich selbstständiger und mutiger sind als Kinder, deren Mütter 24 Stunden zuhause sind. Ihr Engagement vermittelt den Eindruck von großer Motivation und Leidenschaft. Was reizt Sie am Thema Finanzen? Ja, die Themen Finanzen und internationale Geld –und Währungspolitik sind meine Leidenschaften. Schon sehr früh habe ich mich für Aktien und andere Geldanlagen interessiert. Freunde und Freundinnen haben mich immer zu diesen Themen befragt. Das führte letztendlich auch dazu, dass ich 1992 die Ausbildung zur Finanzberaterin aufnahm. Noch heute halte ich gerne Vorträge und berate mit Leidenschaft meine Kundinnen. Welche Tipps haben Sie für Absolventinnen und Absolventen, die in die Finanzbranche einsteigen wollen? Das Thema Finanzen ist spannend, vielseitig und attraktiv. Wichtig sind aus meiner Sicht drei Dinge: Wie schnell bekommt man eigene Verantwortung? Gibt es Personen im Unternehmen, die von Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fähigkeiten überzeugt sind, die Sie fordern und fördern wollen? Und drittens: Welche Möglichkeiten der Weiterbildung gibt es? Natürlich ist auch die Freude an der Materie und täglichen Arbeit eine Grundvoraussetzung. Nur so ist man motiviert.Zur Person
Barbara Rojahn studierte Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Wien und Bonn. Sie arbeitete mehrere Jahre im Firmen- und Privatkundengeschäft einer Großbank und legte 1993 die Finanzberaterprüfung bei der Industrie- und Handelskammer ab. Seitdem arbeitet sie als selbstständige und unabhängige Finanzberaterin. Außerdem ist sie Versicherungsmaklerin und Finanzanlageberaterin und seit 2010 zertifizierte Testamentsvollstreckerin. Barbara Rojahn ist Mitglied bei den FinanzFachFrauen bundesweit, Mitglied im Bundesverband unabhängiger Finanzdienstleisterinnen sowie Mitglied im Verband Deutscher Unternehmerinnen. Als Co-Autorin hat sie bei verschiedenen Frauenfinanzbüchern mitgewirkt. Und sie ist Initiatorin von fünf Aktienclubs für Frauen in Stuttgart.






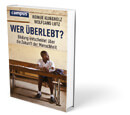
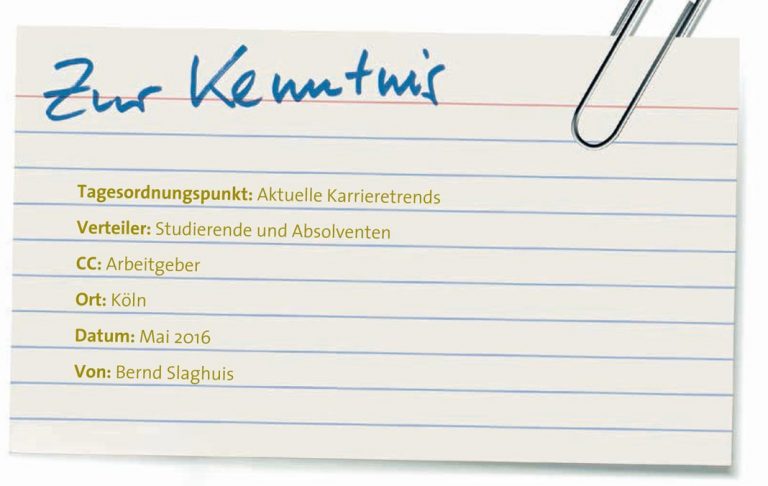
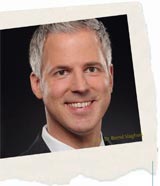


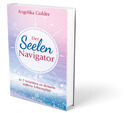

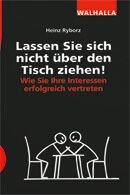

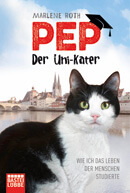
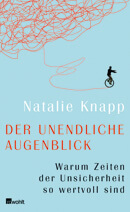 Anders denken ist das Credo von Dr. Natalie Knapp. Sie studierte Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie sowie Religionsgeschichte und promovierte über Heidegger. Heute arbeitet sie als freie Autorin und philosophische Beraterin in Berlin und ist u.a. Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis. Auch im Wirtschaftsleben sind philosophische Kompetenzen in einer Zeit gefragt, in der viele Faktoren die Wirtschaft zur Neuorientierung aufrufen. In ihrem Buch „Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ plädiert sie dafür, Umbruchsituationen nicht möglichst schnell hinter sich lassen zu wollen, sondern sie auf eine andere Art und Weise wertzuschätzen. Die Autorin ist derzeit auf Lesereise.
Anders denken ist das Credo von Dr. Natalie Knapp. Sie studierte Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie sowie Religionsgeschichte und promovierte über Heidegger. Heute arbeitet sie als freie Autorin und philosophische Beraterin in Berlin und ist u.a. Gründungsmitglied des Berufsverbandes für philosophische Praxis. Auch im Wirtschaftsleben sind philosophische Kompetenzen in einer Zeit gefragt, in der viele Faktoren die Wirtschaft zur Neuorientierung aufrufen. In ihrem Buch „Der unendliche Augenblick. Warum Zeiten der Unsicherheit so wertvoll sind“ plädiert sie dafür, Umbruchsituationen nicht möglichst schnell hinter sich lassen zu wollen, sondern sie auf eine andere Art und Weise wertzuschätzen. Die Autorin ist derzeit auf Lesereise.