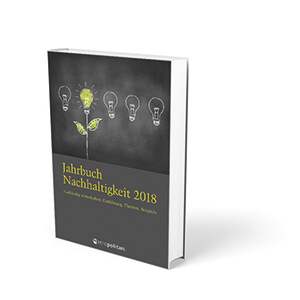Der Ärztemangel ist eklatant, sowohl in Praxen als auch in Kliniken. Ausweg aus Überlastung und Unzufriedenheit kann eine neue Einstellung zum Beruf sein: In Zeiten des demografischen Wandels und der Digitalisierung wird der Arzt zum Coach für die Patienten und zur modernen Führungskraft für sein Team. Nötige Skills sind emotionale Intelligenz und die Gabe, zuzuhören. Von André Boße
Wer in den Suchmaschinen den Begriff „Ärztemangel“ eingibt, wird staunen: Alleine im Sommer 2018 sind in Zeitungen und Magazinen Dutzende Beiträge erschienen, in denen der Ärztemangel nicht nur auf dem Land, sondern auch in den großen Kliniken der Städte beklagt wird. So berichtete der NDR, dass in der größten Klinik von Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin Operationen abgesagt werden mussten, weil nicht genügend Narkose-Ärzte im Dienst waren. Die Personaldecke sei so dünn, dass bereits ein Krankheitsfall den Dienstplan ins Wanken bringen würde, heißt es im Beitrag.
Umso überraschender eine Nachricht von der Bundesärztekammer, veröffentlicht Ende März dieses Jahres. In der heißt es: „Wie aus den Daten der Bundesärztekammer hervorgeht, waren im Jahr 2017 im Bundesgebiet 385.149 Ärztinnen und Ärzte ärztlich tätig. Dies waren gut 6500 mehr als im Vorjahr.“ Doch der Kommentar von Prof. Dr. med. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), zur Ärztestatistik zeigt, wie das mit dem Ärztemangel in Einklang zu bringen ist. „Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland steigt, aber wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach. Die Realität ist komplexer. Uns fehlen Arztstunden.“ Das Problem: Parallel zur leicht zunehmenden Zahl der Ärzte nehme in einer „Gesellschaft des langen Lebens“ der Bedarf an Ärzten weiter zu. Derzeit prognostiziert das Statistische Bundesamt bis zum Jahr 2040 eine Steigerung des Bevölkerungsanteils der über 67-Jährigen um 42 Prozent. Für das Statistikjahr 2016 meldet das Amt 19,5 Millionen Behandlungsfälle in den Krankenhäusern.
Demografischer Wandel
Aus der aktuellen BÄK-Statistik wird deutlich, dass der demografische Wandel auch die Ärzteschaft selbst betrifft. Der Anteil der unter 35-jährigen Ärzte sei zwar um 0,1 Prozentpunkte auf 18,9 Prozent gestiegen, aber gleichzeitig ist der Anteil der über 59-jährigen auf 18,4 Prozent angewachsen. Im Vorjahr waren es noch 17,9 Prozent. Während der Anteil der Krankenhausärzte, die jünger als 35 Jahre sind, bei 33,4 Prozent stagniert, erhöhte sich der Anteil der über 59-Jährigen um 0,3 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. Bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stagnierte der Anteil der unter 40-Jährigen bei 2,7 Prozent. Zugleich ist der Anteil der mindestens 60-Jährigen um 1,3 Prozentpunkte auf 33,9 Prozent gestiegen.
Quelle: www.bundesaerztekammer.de
Hinzu kommen rund eine Milliarde Arztkontakte jährlich in den Praxen. Das sei, so Montgomery, schon heute einfach zu viel: „Ein großer Teil unserer Ärzte arbeitet am Limit. Gleichzeitig sind gerade in der jungen Generation viele nicht mehr bereit, sich auf Kosten der eigenen Gesundheit aufzureiben“, sagte der BÄK-Präsident.
Keine Zeit für Soft Skills
Für Montgomery liegen die Ursachen des Ärztemangels klar auf der Hand: „Es handelt sich hier in erster Linie nicht um ein Verteilungs-, sondern um ein Kapazitätsproblem: Wir bilden zu wenig Ärzte aus.“ Was nicht am mangelnden Interesse junger Menschen liegt: „Das Studium der Medizin ist nach wie vor sehr begehrt“, sagt Silke Wüstholz, die ein Coaching für Ärzte anbietet. „Es gibt immer noch wesentlich mehr Bewerber als freie Studienplätze.“ Was auch zu einem Defizit bei den Ausbildungsinhalten führe. Denn solange an den Unis die Nachfrage das Angebot übersteige, gebe es ihrer Meinung nach keinen Grund, das Studium sinnvoll zu ergänzen – zum Beispiel um Seminare zu Themen wie Stressbewältigung oder Patientenpsychologie. „Für Veränderungen der Studieninhalte im Bereich der Soft Skills besteht keine Notwendigkeit, denn es läuft ja oberflächlich betrachtet wie von selbst.“
Die Folgen bekommen die Ärzte zu spüren, die heute in Kliniken und Praxen über Überlastung stöhnen. Und diese sei nicht eingebildet, wie die BÄK-Statistik zeigt. So heißt es darin: „Niedergelassene Vertragsärzte arbeiten schon jetzt durchschnittlich mehr als 50 Stunden pro Woche.“ In den Krankenhäusern sei es ähnlich: „Nach Erhebungen des Marburger Bundes sind viele Ärzte im Krankenhaus (40 Prozent) 49 bis 59 Stunden pro Woche im Einsatz, jeder fünfte hat sogar eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 60 bis 80 Stunden, inklusive aller Dienste und Überstunden.“ Zum Vergleich: Das Statistische Bundesamt beziffert die durchschnittliche Wochenarbeitszeit aller Erwerbstätigen in Deutschland auf 35,6 Stunden.
Wo arbeiten die Ärzte?
Laut der BÄK-Ärztestatistik 2017 arbeiten von den gut 385.000 Ärzten rund 40 Prozent in ambulanten, knapp 52 Prozent in stationären Bereichen. Gut 2,5 Prozent sind bei Behörden oder Körperschaften tätig. Bei den Fachrichtungen liegt die Innere Medizin mit 13,9 Prozent vorne. Es folgen die Allgemeinmedizin (11,3 Prozent), die Chirurgie (9,6 Prozent) und die Anästhesiologie (6,3 Prozent). Blickt man nur auf die Ärztinnen, so liegt dort auf Platz drei neben der Allgemein- und der Inneren Medizin die Frauenheilkunde und Geburtshilfe (6,8 Prozent). Masterstudiengang Medizin-Ethik-Recht Die Martin-Luther-Universität Halle- Wittenberg bietet den Masterstudiengang Medizin-Ethik-Recht an. Weitere Infos unter: www.mer.uni-halle.de/m_mel
Ärzte arbeiten also deutlich länger als der Durchschnitt. Und doch fehlt noch immer die Zeit für Gespräche mit den Patienten. „Viele Ärzte sehen sich als Getriebene im System“, sagt Coach Silke Wüstholz. Doch aus ihrer Arbeit mit Ärzten weiß sie, dass sich viele genau das am meisten wünschen: „Sich ausreichend Zeit nehmen zu können für ihre Patienten.“ Da das im Alltag nicht möglich ist, würden sie irgendwann gehetzt und ratlos wirken. „Zumal die ökonomischen und administrativen Aufgaben enorm viel Zeit in Anspruch nehmen.“ Hinzu kommen in den Kliniken die Unterbesetzung und immer komplexere Krankheitsbilder. „Ein Teufelskreis“, wie Silke Wüstholz sagt.
Ethik statt Geld
Wie aber lässt sich die Situation verbessern? Gedanken dazu macht sich seit einigen Jahren Marion Badenhop, Geschäftsführerin des Coaching- und Beratungsinstituts MB-Consulting. In ihrer Arbeit mit Medizinern bildet sie Ärzte zu Coaches aus, damit diese in ihrem Arbeitsalltag ihren Patienten auch einen psychologischen Mehrwert bieten. Was nach einer weiteren Mehrbelastung klingt, ist für Marion Badenhop ein Lösungsansatz, damit trotz Ärztemangel die Patienten eine bessere Behandlung erhalten und die Ärzte selbst in ihrem Beruf zufriedener sind. Dafür sei zusätzlich ein Umdenken an anderer Stelle erforderlich:
„Der Blick der Politik und Gesellschaft auf den Ärzteberuf muss wieder eine stärkere ethische Relevanz erhalten, nicht eine vorherrschend monetäre“, fordert sie. Sonst bleibe der holistisch betrachtete Mensch auf der Strecke. „Damit dies nicht passiert, braucht es Zeit – und keine zu knapp kalkulierten Fallpauschalen.“ So müsste es dem Arzt zum Beispiel möglich sein, mehr für die Prophylaxe seiner Patienten zu tun – und auch diese Arbeit abrechnen zu können. Wie diese Prophylaxe konkret aussehen kann?
Marion Badenhop stellt sich beispielsweise „Informationsstunden“ in der Praxis vor: „Gern auch in der Kleingruppe, in der ein Arzt über die neuen technischen, digitalen Möglichkeiten zur Gesundheitsvorsorge berichtet, unterstützende Apps vorstellt und in denen er auch erläutert, warum es in Zukunft wichtig sein wird, parallel zum Patientengespräch Big Data zu pflegen: Weil sich nämlich mit Hilfe dieser statistischen Vergleichsdaten Risiken frühzeitiger erkennen lassen. Das spart auch den Kassen Geld. Ebenso wird auf diese Weise eine virtuelle Medizin und Betreuung auf Distanz möglich.“
Arbeiten im Ausland
Nach der Ärztestatistik haben im vergangenen Jahr knapp 2000 Ärzte Deutschland verlassen. Die beliebtesten Auswanderungsländer seien dabei wie auch in den vergangenen Jahren: die Schweiz (641), Österreich (268) sowie die USA (84). Für etwas Entlastung in der Bilanz sorge die weiterhin recht hohe Zuwanderung von Ärzten aus dem Ausland. Der Studie zufolge ist die Zahl der in Deutschland gemeldeten Ärztinnen und Ärzte aus EU-Ländern und aus so genannten Drittländern im Jahre 2017 um gut 4000 Ärzte auf 50.809 gestiegen.
Nach diesem Konzept werde der Arzt verstärkt zu einem Vorsorge-Dienstleister, Medizin-Kommunikator und Gesundheits-Coach. Dafür sind Kompetenzen wichtig, die weit über die medizinische Ausbildung hinausgehen. „Erforderlich sind psychologisches Know-how und Fertigkeiten im Kontext Gesprächsführung und Coaching“, zählt Maren Badenhop Voraussetzungen auf. Es geht also darum, emotionale Intelligenz zu entwickeln und die Kunst des Zuhörens neu zu lernen.
Arzt als Führungskraft
Auch glaubt Marion Badenhop, dass es nicht reicht, den direkten Arztkontakt in der Sprechstunde als einzigen Ort der Behandlung zu betrachten. „Wir müssen den Praxis- oder Klinikaufenthalt ganzheitlich als Behandlung ansehen – angefangen beim Empfang über die Wartephase hinweg bis zum Arztgespräch und zur Verabschiedung.“ Es entlastet die Ärzte, wenn sie davon ausgehen dürfen, dass das gesamte Praxis- oder Klinikteam zu diesem Ansatz beiträgt. Es komme dann verstärkt auf Teamarbeit an. Der Arzt erhält eine Rolle als Führungskraft, wichtig werden die passenden Leadership-Skills: Er gibt seinem Team spezifische Verantwortung und Vertrauen – und darf dann darauf setzen, „dass dieses den Patienten empathisch durch die oft belastenden Praxis- oder Krankenhausaufenthalte begleitet“, so Badenhop.
Diese Empathie sei unabdingbar, denn: „Die Seele bleibt Fußgänger“, sagt die Coach-Ausbilderin. Zwar bieten die neuen technologischen Möglichkeiten der Medizin Chancen, sie würden aber auch die Unsicherheit bei Patienten schüren: „Automatisierte Mammographie-Analysen, OP-Roboter, digitale Patientenakten & Co. verbessern selbstredend die Patientenversorgung. Das Problem ist jedoch, dass sie datengepflegt werden müssen – und das kostet Zeit. Die wiederum versucht der Arzt im Patientengespräch einzusparen, indem er parallel zu den Angaben des Patienten in den Computer schreibt und schaut.“ Der Arzt dürfe jedoch nicht zu einem reinen Patienten-Daten- Manager werden – schon alleine deshalb, weil das gar nicht seinem Selbstbild entspricht. „Ärzte haben einen hohen Anspruch an sich“, sagt Coach Silke Wüstholz. „Sie möchten sehr gute Mediziner sein, wollen keine Fehler machen und keine Schwäche zeigen.“ Klar, dass da der Druck steige. Mit negativen Folgen:
Digital Health Accelerator
Im Januar 2018 präsentierten in Berlin vier Innovationsteams aus dem Pilotprojekt „Digital Health Accelerator“ des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung/Berlin Institute of Health (BIH) und zwei Startups aus der Charité – Universitätsmedizin Berlin ihre Digital-Health- Lösungen für den Klinikalltag. Die neuen Lösungen nutzen vor allem neue Bild- und Big-Data-Analyseverfahren sowie Sensorik für verbesserte Vorhersagen, Präventionskonzepte und personalisierte Behandlungsmöglichkeiten von schwerwiegenden Erkrankungen. Weitere Infos unter: www.bihealth.org Smart Hospital und Ethik Die Universitätsmedizin Essen hat ein neues Ethikgremium berufen, das sich dem kritischen Dialog rund um das „Smart Hospital“ widmen will. Weitere Infos unter: www.uk-essen.de
„In der Phase einer Überlastung wird das am schnellsten vernachlässigt, was einem guttäte. Sei es die Zeit mit Freunden, der Sport oder sonstige Hobbies“, so Silke Wüstholz. Als Coach rät sie den Ärzten, sich bei zu viel Stress professionelle Unterstützung außerhalb des medizinischen Umfelds zu holen. „In einem so anspruchsvollen Beruf wie dem des Arztes sollte es selbstverständlich sein, sich immer wieder selbst in einem vertraulichen Rahmen zu reflektieren.“ Bin ich noch der Arzt, der ich sein möchte? Achte ich genug auf mich selbst? Das seien die Kernfragen. Und um darauf Antworten zu finden, benötigt man eine Qualität, die Silke Wüstholz als Kernkompetenz betrachtet: ein hohes Maß an Selbstempathie.





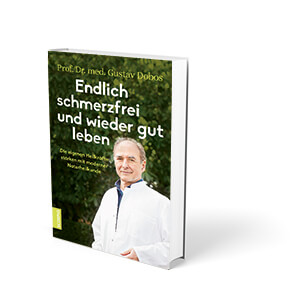 Dobos ist Autor verschiedener Bücher. Kürzlich erschienen ist sein Buch:
Dobos ist Autor verschiedener Bücher. Kürzlich erschienen ist sein Buch: 
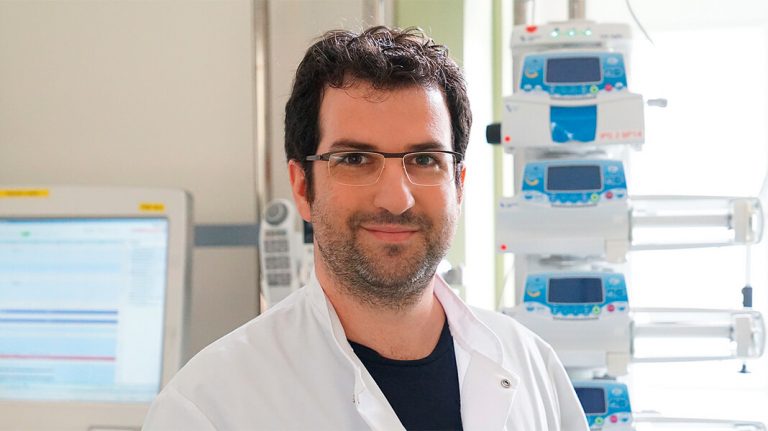
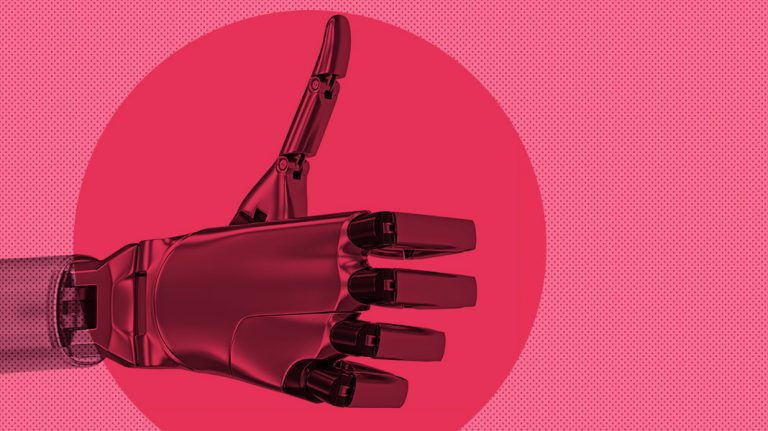
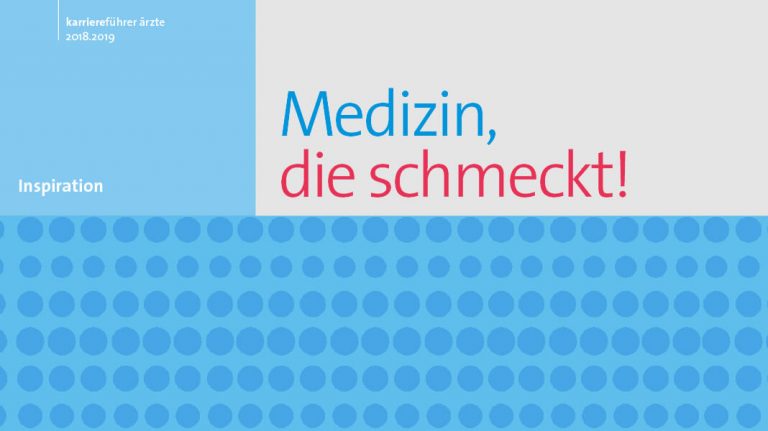
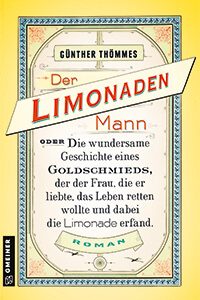 Seine Idee für ein medizinisches Produkt prägt heute eine Weltmarke. Und die Liebe verhalf ihm einst zu diesem Geniestreich. Mit kohlensäurehaltigem Wasser, auch Sodawasser genannt, gelang dem als Juwelier ausgebildeten Jacob Schweppe der Durchbruch. Ende des 18. Jahrhunderts revolutionierte sein Getränk die gesamte Lebensmittelindustrie. Doch vor allem die Geschichte hinter der Erfindung des Bitter Lemon arbeitet Günther Thömmes in seinem neuen historischen Roman auf. In Rückblenden erzählt, taucht der Leser in das Leben Schweppes und in eine ungewöhnliche Liebesgeschichte ein, aus der die Idee zur Herstellung von Bitter Lemon entstand. Doch kann seine Erfindung auch der Frau, die er liebt, das Leben retten? Und nebenbei auch noch einen Mann aus dem Weg räumen, der kein Mitleid verdient? Heute ist Jacobs Nachname weltbekannt, er selbst wurde jedoch – zu Unrecht – fast vergessen.
Seine Idee für ein medizinisches Produkt prägt heute eine Weltmarke. Und die Liebe verhalf ihm einst zu diesem Geniestreich. Mit kohlensäurehaltigem Wasser, auch Sodawasser genannt, gelang dem als Juwelier ausgebildeten Jacob Schweppe der Durchbruch. Ende des 18. Jahrhunderts revolutionierte sein Getränk die gesamte Lebensmittelindustrie. Doch vor allem die Geschichte hinter der Erfindung des Bitter Lemon arbeitet Günther Thömmes in seinem neuen historischen Roman auf. In Rückblenden erzählt, taucht der Leser in das Leben Schweppes und in eine ungewöhnliche Liebesgeschichte ein, aus der die Idee zur Herstellung von Bitter Lemon entstand. Doch kann seine Erfindung auch der Frau, die er liebt, das Leben retten? Und nebenbei auch noch einen Mann aus dem Weg räumen, der kein Mitleid verdient? Heute ist Jacobs Nachname weltbekannt, er selbst wurde jedoch – zu Unrecht – fast vergessen.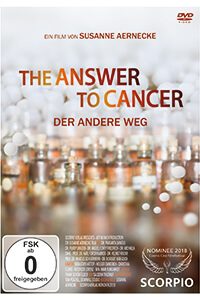 Die Filmemacherin Susanne Aernecke hat sich auf die Suche nach alternativen Krebsheilmethoden begeben. In Begegnungen mit Wissenschaftlern und Ärzten zeigt sich, dass nicht nur die asiatische Medizin, sondern auch die westliche Forschung in der Nano-Medizin ein neues Verständnis von Krebs entwickelt und nach Wegen aus der Sackgasse der bisherigen Therapien sucht. Zu sehen sind unter anderem Interviews mit Dr. Prasantha Banerji, Dr. Miguel Corty, Dr. Michaela Dane, Dr. Karl Forchhammer und Dr. Norbert Kriegisch. Es handelt sich um den ersten Dokumentarfilm über die Erfolge der Homöopathie bei der Krebstherapie mit Einblicken in den aktuellen Stand von Therapie und Forschung.
Die Filmemacherin Susanne Aernecke hat sich auf die Suche nach alternativen Krebsheilmethoden begeben. In Begegnungen mit Wissenschaftlern und Ärzten zeigt sich, dass nicht nur die asiatische Medizin, sondern auch die westliche Forschung in der Nano-Medizin ein neues Verständnis von Krebs entwickelt und nach Wegen aus der Sackgasse der bisherigen Therapien sucht. Zu sehen sind unter anderem Interviews mit Dr. Prasantha Banerji, Dr. Miguel Corty, Dr. Michaela Dane, Dr. Karl Forchhammer und Dr. Norbert Kriegisch. Es handelt sich um den ersten Dokumentarfilm über die Erfolge der Homöopathie bei der Krebstherapie mit Einblicken in den aktuellen Stand von Therapie und Forschung.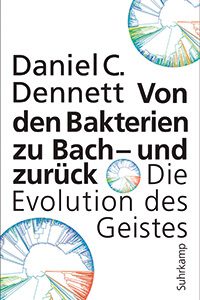 Was ist der menschliche Geist und wie ist er überhaupt möglich? Daniel C. Dennett ist der weltweit wohl bedeutendste Fürsprecher von Materialismus, Aufklärung und Wissenschaft. In seinem aktuellen Buch „Von den Bakterien zu Bach – und zurück – Die Evolution des Geistes“ wagt er einen Rundumschlag. Es handelt sich um eine Erzählung von den Ursprüngen des Lebens über die Geistesgrößen der Menschheit wie Johann Sebastian Bach, Marie Curie oder Pablo Picasso bis hin zur Künstlichen Intelligenz.
Was ist der menschliche Geist und wie ist er überhaupt möglich? Daniel C. Dennett ist der weltweit wohl bedeutendste Fürsprecher von Materialismus, Aufklärung und Wissenschaft. In seinem aktuellen Buch „Von den Bakterien zu Bach – und zurück – Die Evolution des Geistes“ wagt er einen Rundumschlag. Es handelt sich um eine Erzählung von den Ursprüngen des Lebens über die Geistesgrößen der Menschheit wie Johann Sebastian Bach, Marie Curie oder Pablo Picasso bis hin zur Künstlichen Intelligenz.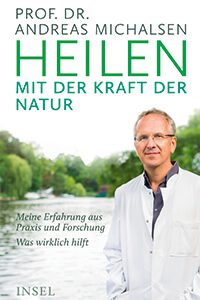 Die Schulmedizin grenzt die Naturheilkunde noch immer aus, dabei hat sich unsere Gesellschaft längst entschieden: Denn zwei Drittel aller Patienten wollen naturheilkundlich behandelt werden. In seinem Buch „Heilen mit der Kraft der Natur – Meine Erfahrung aus Praxis und Forschung – Was wirklich hilft“ erzählt Prof. Dr. med. Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für Naturheilkunde der Charité Berlin, warum er den konventionellen Pfad der Medizin verlassen hat und welches Potenzial der Natur er mit seinen Patienten täglich neu entdeckt.
Die Schulmedizin grenzt die Naturheilkunde noch immer aus, dabei hat sich unsere Gesellschaft längst entschieden: Denn zwei Drittel aller Patienten wollen naturheilkundlich behandelt werden. In seinem Buch „Heilen mit der Kraft der Natur – Meine Erfahrung aus Praxis und Forschung – Was wirklich hilft“ erzählt Prof. Dr. med. Andreas Michalsen, Chefarzt am Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für Naturheilkunde der Charité Berlin, warum er den konventionellen Pfad der Medizin verlassen hat und welches Potenzial der Natur er mit seinen Patienten täglich neu entdeckt.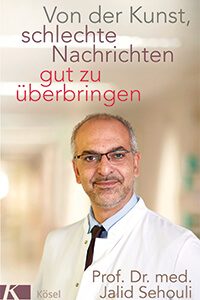 Jalid Sehouli, Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité, hat intensiv nach Leitlinien gesucht, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Denn dies ist eine hohe Kunst. In seinem Buch verbindet er hilfreiche Ratschläge für die Besprechung existenzieller Situationen mit Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis. Die lebensnotwendige Bedeutung von Patientengesprächen wird so spürbar und bietet jedem, der schwierige Nachrichten zu überbringen hat, Anregung.
Jalid Sehouli, Chefarzt für Gynäkologie an der Berliner Charité, hat intensiv nach Leitlinien gesucht, schlechte Nachrichten gut zu überbringen. Denn dies ist eine hohe Kunst. In seinem Buch verbindet er hilfreiche Ratschläge für die Besprechung existenzieller Situationen mit Geschichten aus seiner ärztlichen Praxis. Die lebensnotwendige Bedeutung von Patientengesprächen wird so spürbar und bietet jedem, der schwierige Nachrichten zu überbringen hat, Anregung.



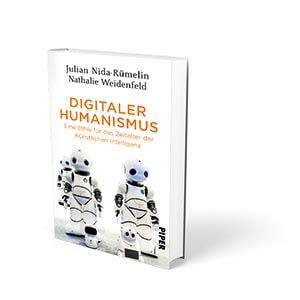 Die Bestseller-Autorin Dr. Nathalie Weidenfeld und ihr Mann, der Philosoph und ehemalige Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida- Rümelin, zeigen mit dem Buch „Digitaler Humanismus“ eine, so der Untertitel, „Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“. Mit einem Brückenschlag zwischen philosophischen Gedanken und Zukunftsszenarien legen die beiden Autoren einen Gegenentwurf zur Ideologie im Silicon Valley vor, wo die Künstliche Intelligenz zu einem Manna der Fortschrittsgläubigen zu werden droht – zumal bei einem reinen Blick auf die Nutzbarkeit fürs Business. Ingenieuren bietet das Buch Impulse, wie es gelingen kann, den technischen Fortschritt im ethischen Kontext zu betrachten.
Die Bestseller-Autorin Dr. Nathalie Weidenfeld und ihr Mann, der Philosoph und ehemalige Staatsminister Prof. Dr. Julian Nida- Rümelin, zeigen mit dem Buch „Digitaler Humanismus“ eine, so der Untertitel, „Ethik für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz“. Mit einem Brückenschlag zwischen philosophischen Gedanken und Zukunftsszenarien legen die beiden Autoren einen Gegenentwurf zur Ideologie im Silicon Valley vor, wo die Künstliche Intelligenz zu einem Manna der Fortschrittsgläubigen zu werden droht – zumal bei einem reinen Blick auf die Nutzbarkeit fürs Business. Ingenieuren bietet das Buch Impulse, wie es gelingen kann, den technischen Fortschritt im ethischen Kontext zu betrachten. 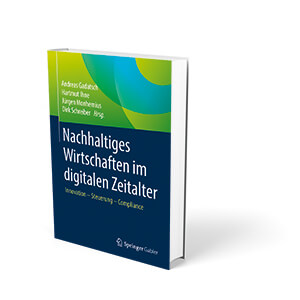 Das Fachbuch „Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter“ zeigt für die Begriffe Innovation, Steuerung und Compliance auf, wie sich Ökonomie, Technik und Umweltschutz mit der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft verbinden lassen. Unter anderem verdeutlicht Prof. Dr. Thomas Heupel in einem Kapitel, warum mit der Biokratie ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance erhält.
Das Fachbuch „Nachhaltiges Wirtschaften im digitalen Zeitalter“ zeigt für die Begriffe Innovation, Steuerung und Compliance auf, wie sich Ökonomie, Technik und Umweltschutz mit der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft verbinden lassen. Unter anderem verdeutlicht Prof. Dr. Thomas Heupel in einem Kapitel, warum mit der Biokratie ein neues Konzept der Nachhaltigkeit vor dem Hintergrund der Generationen Y und Z sowie der künftigen Megatrends eine Chance erhält.