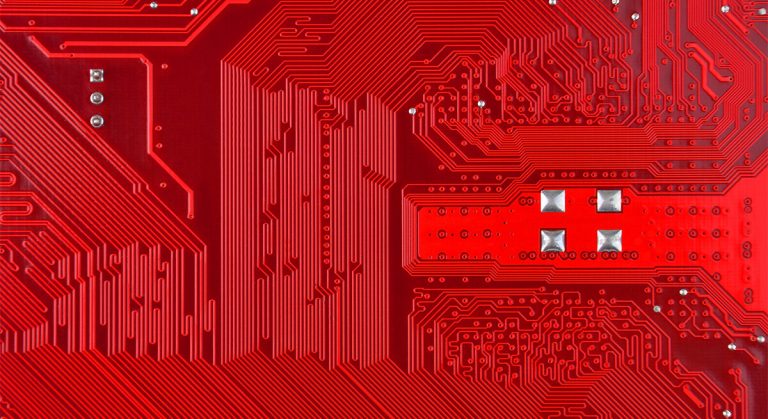Durch die Pandemie verstärken sich Businesstrends, die auch schon vorher zu beobachten waren. Zwar ist die Situation für Gesellschaft und Wirtschaft dramatisch. Doch zeichnet sich eine Zukunft ab, die zwar alles andere als normal sein wird, den Consultants aber eine Menge Möglichkeiten gibt, positiv auf die Perspektive ihrer Kunden einzuwirken. Ein Essay von André Boße
Es gibt ein recht altes, aber dennoch frisch klingendes Lied der Düsseldorfer Postpunk-Band Fehlfarben, geschrieben im Jahr 1982, aktueller denn je. „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht“, lauten die beiden eingängigsten Zeilen. Sie spuken einem in diesen Tagen durch den Kopf, wenn man die Nachrichten und Sondersendungen schaut, die Special-Texte in Zeitungen und Magazinen liest, Podcasts und Radio-Features hört: „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht.“ Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher, bringt es wie folgt auf den Punkt: Er werde in seiner Position als führender Vordenker derzeit häufig gefragt, wann Corona denn „vorbei sei“ und alles wieder zur Normalität zurückkehren werde. „Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.“
Der Andere war schon angelegt
Interessant ist, dass im Songtext der Band Fehlfarben auf die Zeilen „Keine Atempause, Geschichte wird gemacht“ eine dritte Kernzeile folgt: „Es geht voran!“ Gut, die Postpunks aus Düsseldorf hatten bei diesen Worten den ungebremsten Kapitalismus im Sinn, ihre Zeile ist wirtschaftskritisch zu verstehen. Aber weil Kunst zum flexiblen Denken anregt, darf man sie im Jahr 2020 auch ein wenig anders deuten: Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass sich die Welt – und zwar auch die überhitzte Wirtschaftswelt – zunächst zurückgezogen hat, in einen historischen Shutdown. Dieser hat der globalen Ökonomie zunächst einmal eine kaum schätzbare Menge an Geld entzogen. Sinnbildlich dafür stand der Moment, als eine Tonne Öl in den USA einen Minuspreis besaß: Wer sie loswerden wollte, musste dafür bezahlen. Das „schwarze Gold“ wurde kurzzeitig zum „schwarzen Pech“: Eine stärkere Metapher dafür, wie radikal die Wirtschaft wankte, ist kaum vorstellbar. Diese Pandemie führt also (auch) in eine wirtschaftliche Krise, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Was also sollte da noch „voran gehen“?
Lage der Unternehmensberatungen
Die Consultingbranche stellt zwar fest, dass der Bedarf an Beratung heute und in naher Zukunft groß sein werde. Dennoch spürt auch diese Branche die kurzfristigen Folgen der Krise. Laut Index des Branchenverbandes BDU bekommen die Personalberatungen den Corona-Effekt besonders zu spüren, „hier machen sich die Einschränkungen der persönlichen Kontakte zu den Kunden am stärksten bemerkbar“. Virtuelle Beratung werde zwar angeboten, treffe aber besonders bei der Suche nach Fach- und Führungskräften noch auf wenig Akzeptanz. Laut Umfrage bei den Consultingunternehmen laufen mehr als die Hälfte der Projekte auch in der Krise weiter, in den Bereichen Sanierungs- und IT-Beratung sind es sogar dreiviertel der Projekte.
Horx stellt dazu eine Frage: „Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso verändern wollte?“ „Die Wirtschaft nach Corona“ hat das Zukunftsinstitut, dessen Gründer Matthias Horx ist, ein „White Paper“ betitelt, in dem die Trendforscher beschreiben, warum dieses Virus und der Umgang der Menschen mit ihm für einen historischen Umbruch sorgen werden. Die These: Dass der Staat versucht, mit Begriffen wie der „Bazooka“ oder der Devise „Whatever it takes“ versucht hat, den Status Quo wiederherzustellen, der noch Januar/Februar 2020 Gültigkeit hatte, war eine notwendige erste Rettung. Diese Rettung trug zunächst die Verheißung in sich, dass auf sie eine Wiederauferstehung folgt. Doch so einfach sei es nicht, heißt es im „White Paper“ des Zukunftinstituts: „Auf die ‚Whatever it takes!‘-Phase folgt nicht automatisch das ‚Comeback‘. Vielmehr initiiert Corona einen langwierigen Prozess der Erneuerung: Die 2020er-Jahre werden zum Jahrzehnt der Resilienz.“
Comeback der Resilienz
„Resilienz“ – das ist als Begriff ein guter alter Bekannter. In den Fokus geriet er ab etwa 2010, als sich die verschiedenen Krisen zu einer Art „Superkrise“ manifestierten. „Angesichtes einer raschen Abfolge gravierender Krisen kann der Aufstieg des Begriffs nicht überraschen“, hieß es 2017 in einer Studie der Bertelsmann Stiftung zur „Ökonomischen Resilienz“. „Wenn ökonomische Schocks offenbar unvermeidbar sind, dann sollte die Fähigkeit einer Volkswirtschaft zu ihrer Bewältigung in den Blick genommen werden.“
Interessanterweise geriet der Begriff auf dem Wechsel von den 10er- in die 20er- Jahre etwas in den Schatten: Die Digitalisierung wurde zu einem Treiber, der seinerseits das Versprechen in sich trug, viele der Krisen Geschichte werden zu lassen, zumal ihre Methoden wie Big Data und Künstliche Intelligenz dazu beitragen sollten, Probleme zu lösen, die kein Mensch zu lösen vermag. Eine nahtlose globale Logistik, passgenaue und entmaterialisierte Vertriebsmodelle über 3D-Drucker, die Vorteile der Plattformökonomie – die Weltwirtschaft schien sich zu einem reibungs- und risikolosen Uhrwerk zu entwickeln. Sogar das Potenzial, das (auch weiterhin) größte Problem zu lösen, wurde ihr zugesprochen: das der Erderwärmung.
„Manything goes“: Berater bewerten Potenziale
Eine Pandemie jedoch hatte niemand auf dem Zettel. Bis auf wenige, die auf der Suche nach möglichen Rissen der Zivilisation auch an solche Virus-Szenarien gedacht haben. Mit viel Wucht taumelt die Weltwirtschaft (und mit ihr die Weltgesellschaft) also „zurück nach vorne“, in ein neues Zeitalter der Resilienz. Was bedeutet das für die Unternehmen und ihre Berater? Wer gewinnt, wer verliert? Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig? Eines sei gewiss, heißt es im „White Paper“ des Zukunftsinstituts. „Die Krise und ihre tiefen Verwerfungen eröffnen neue Möglichkeitsräume. Es ist daher auch die Zeit des ‚Manything goes‘.“ Nicht zu verwechseln übrigens mit dem „Anything goes“ aus der Epoche der Postmoderne, als alles möglich schien – und letztlich der Neoliberalismus entstand, der mit seinem überdeutlichen Fokus auf den Kapitalismus dafür sorgte, dass sich Wirtschaft und Gesellschaft entkoppeln.
Situation im Mittelstand: Beratung fürs Bauchgefühl
Das besonders auf den Mittelstand fokussierte Marktforschungsunternehmen Stakeholder Insights hat sich in einer Studie den Problemen und Perspektiven kleinerer und mittelgroßer Unternehmen gewidmet. Dabei haben die Autoren herausgefunden, dass die Corona-Krise in diesem Segment das „unternehmerische Bauchgefühl geschädigt“ habe. Dies habe wie ein Schock gewirkt, sodass es nun darauf ankomme, die Zukunft neu zu erobern: „Der von der Krise erzwungene Stillstand kann genutzt werden, um grundsätzliche Fragen zu stellen, um Strategien zu prüfen und Unternehmen auf eine vielleicht neue Zukunft vorzubereiten.“ Unternehmen könnten nun diesen Schritt aus einer Kraft tun – „aber auch Mitarbeiter zurate holen oder externe Dienstleister hinzuziehen.“
Corona hingegen zeigt, wie stark das Soziale und das Ökonomische aneinander gekoppelt sind. Daher: Es geht nicht alles, aber: „Die nächsten Monate werden zum Fenster der Möglichkeiten, und ihre Weichenstellungen werden die kommenden Jahre nachhaltig prägen, in Gesellschaft und Wirtschaft wie in jedem einzelnen Unternehmen.“ Das erfordere, so die Autoren vom Zukunftsinstitut, eine „neue Qualität an unternehmerischer Vor-Sicht und unternehmerischem Mut.“ Wobei die Schreibweise von „Vor-Sicht“ kein Druckfehler ist, sondern ein Wortspiel mit Aussage: Lange Zeit hieß es, die Politik fahre beim Kampf gegen die Pandemie „auf Sicht“. Für die Unternehmen kommt es nun jedoch darauf an, einen scharfen analytischen Blick für das zu entwickeln, was kommen mag. Das ist nicht einfach, weshalb Consultants hier besonders gefragt sein werden: Mit ihren Methoden verfügen sie über das Potenzial, die Möglichkeiten, die sich in der Post-Corona-Ökonomie ergeben, zu benennen und zu bewerten.
Klar ist aber auch: Die Methoden der Berater müssen sich an diese historische Situation anpassen. So komplex die Gemengelage, die sich aus der Pandemie ergibt, auch sein mag: Aus Sicht der Chief-Consultants von der Boston Consulting Group (BCG) stellen sich Manager überall auf der Welt zunächst die gleichen, recht simplen Fragen: „Wie lassen sich meine zukünftigen Umsätze vorhersagen? Wie soll ich meine Investitionen verteilen? Wann wird wieder alles normal sein?“ Die BCG-Experten machen den Unternehmen allerdings keine Hoffnungen, dass sich schnelle Antworten auf diese verständlichen Fragen finden lassen. Stattessen setzen die Berater auf eine Vielzahl von Szenarios, die es möglich machen, das einzuschätzen, was die Zukunft bereithalten wird.
Gute Sicht auf neue Zukunft
Auf der Zeitachse müssen Unternehmen damit rechnen, dass die große Unsicherheit anhalten wird, solange die Staaten auf der Erde damit beschäftigt sind, gegen katastrophale Auswirkungen auf das Gesundheitssystem zu kämpfen. Die eigentliche Zukunft beginne erst dann, wenn ein Impfstoff gefunden, produziert und verteilt werden kann. Wobei dieses Morgen nicht mehr viel mit dem zu tun haben werde, was man sich noch Anfang 2020 als Zukunft im Kopf vorstellte. „Wir rechnen mit dramatischen Veränderungen in allen Bereichen, vom Handel über die Lieferketten, von Geschäftsmodellen bis hin zu Gewohnheiten und Bedürfnissen von Kunden“, heißt es im BCG-Papier „COVID-19: Win the Fight, Win the Future“. Die Szenarien der Boston Consulting Group bestätigen, dass Prä-Corona-Trends durch die Pandemie verstärkt werden – und sich damit manifestieren. Neue Strukturen für Home-Office und Digital-Meetings, eine neue Work- Life-Balance, die das Arbeits- und Familienleben stärker mischt, einen noch stärkeren Trend zum Online-Handel, krisensichere Lieferketten, flexible Produktionslinien und Standorte – alle diese Entwicklungen sind nicht neu, werden von der Pandemie aber entscheidend vorangetrieben.
Generation Y trotzt der Krise
Die Manager der „Generation Y“ sind besonders gut für die aktuelle Corona-Krise gerüstet. Ortsunabhängiges Arbeiten sowie die virtuelle Kommunikation mit Kunden und Kollegen, welche die Corona-Krise derzeit mit sich bringt, sind für junge Führungskräfte selbstverständlicher als für die älteren Manager-Generationen, wie das Manager-Barometer von Odgers Berndtson zeigt. So erwarten 40 Prozent der jungen Manager – auch in Nicht-Krisenzeiten – umfangreiche Homeoffice-Möglichkeiten und flexible Arbeitszeiten von ihrem Arbeitgeber, während dies nur für knapp 20 Prozent der „Babyboomer“ wichtig ist. Zudem sehen die Vertreter der „Generation Y“ deutlich größere Chancen durch die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI) als ältere Manager.
Quelle: www.odgersberndtson.com
Retooling: Unternehmen benötigen neue Werkzeuge
Wie darauf reagieren? Die Consultants der Beratungsgesellschaft Bain & Company schlagen Beratern vor, den Unternehmen den Sinn eines „Retoolings“ zu vermitteln, sprich: den Umgang mit anderen Werkzeugen anzuraten. Das beginne schon mit dem Blick auf den Kunden: Bain prognostiziert das Ende des „Durchschnittskunden“, an seine Stelle treten Kunden mit sehr klaren Grundbedürfnissen, die gefunden, analysiert und befriedigt werden müssten. Auch gehe es darum, die Resilienz und die Reaktionsgeschwindigkeit des Unternehmens zu erhöhen, in dem die Digitalisierung aller Prozesse weiter vorangetrieben und neue Partnerschaften gefunden werden – wohlgemerkt auch Partnerschaften, die weit über den Aufkauf anderer Unternehmen hinausgehen, zum Beispiel mit staatlichen Behörden oder direkt dem Kunden.
Optimistisch betrachtet kann diese Pandemie auf diese Art zu einem Treiber einer neuen Konnektivität werden: Sektoren und System erkennen in der Krise ihre gegenseitige Abhängigkeit und reagieren darauf, in dem sie kooperieren. Nicht überraschend, dass das Zukunftsinstitut die Konnektivität schon vor Corona zum „wirkungsmächtigsten Megatrend unserer Zeit“ gekürt hat: „Das Prinzip der Vernetzung dominiert den gesellschaftlichen Wandel und eröffnet ein neues Kapitel in der Evolution der Gesellschaft. Digitale Kommunikationstechnologien verändern unser Leben grundlegend, reprogrammieren soziokulturelle Codes und lassen neue Lebensstile und Verhaltensmuster entstehen“, definieren die Trendforscher. Wie Individuen werden auch Unternehmen in der Post-Corona-Zeit diese „neuen Verhaltensmuster“ entwickeln müssen. Die gute Nachricht ist: Consultants, die sich schon vor der Pandemie mit der Zukunft beschäftigt haben, wissen bereits jetzt, worauf es dabei in dieser aktuellen Extremsituation besonders ankommt.
Buchtipp: Die Zukunft nach Corona
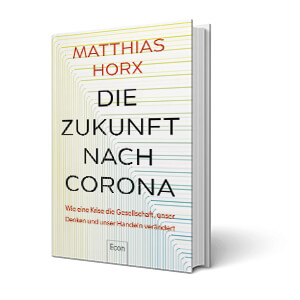 Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf neue Umwelten, andere Bedingungen eingestellt. Deshalb hat unsere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erleben wir selbst eine Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. Das Virus verändert unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, wie wir arbeiten, fühlen und denken. Die Krise fungiert wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen. Der Zukunftsforscher Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Krise: Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, Staaten, Familien, Unternehmen auf die Herausforderung? Welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft, und wie können wir sie in Zuversicht verwandeln? Geht alles nach ein paar Monaten wieder seinen alten Gang? Oder erleben wir jetzt einen Kulturwandel, einen Big Shift, in dem alles seine Richtung ändert, und eine völlig neue Zukunft entsteht? Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, die Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und er kommt damit zu überraschenden Ergebnissen. Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Ullstein eBooks 2020, 14,99 Euro
Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf neue Umwelten, andere Bedingungen eingestellt. Deshalb hat unsere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erleben wir selbst eine Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. Das Virus verändert unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, wie wir arbeiten, fühlen und denken. Die Krise fungiert wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen. Der Zukunftsforscher Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Krise: Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, Staaten, Familien, Unternehmen auf die Herausforderung? Welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft, und wie können wir sie in Zuversicht verwandeln? Geht alles nach ein paar Monaten wieder seinen alten Gang? Oder erleben wir jetzt einen Kulturwandel, einen Big Shift, in dem alles seine Richtung ändert, und eine völlig neue Zukunft entsteht? Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, die Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und er kommt damit zu überraschenden Ergebnissen. Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Ullstein eBooks 2020, 14,99 Euro
Christine Radomsky: Willkommen in der Welt der Digital Natives. Redline Verlag 2019. 17,99 Euro





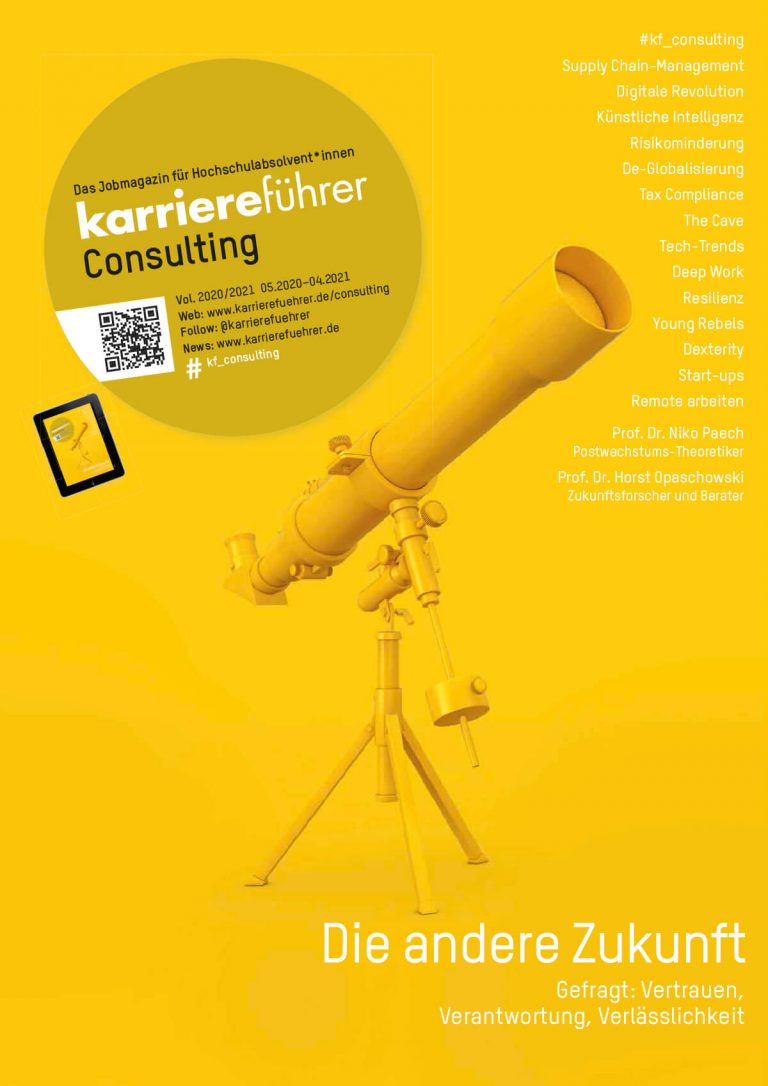
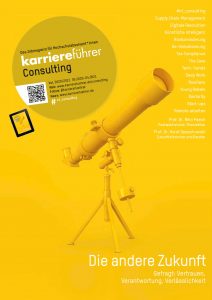

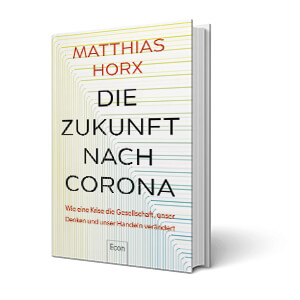 Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf neue Umwelten, andere Bedingungen eingestellt. Deshalb hat unsere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erleben wir selbst eine Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. Das Virus verändert unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, wie wir arbeiten, fühlen und denken. Die Krise fungiert wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen. Der Zukunftsforscher Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Krise: Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, Staaten, Familien, Unternehmen auf die Herausforderung? Welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft, und wie können wir sie in Zuversicht verwandeln? Geht alles nach ein paar Monaten wieder seinen alten Gang? Oder erleben wir jetzt einen Kulturwandel, einen Big Shift, in dem alles seine Richtung ändert, und eine völlig neue Zukunft entsteht? Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, die Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und er kommt damit zu überraschenden Ergebnissen. Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Ullstein eBooks 2020, 14,99 Euro
Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf neue Umwelten, andere Bedingungen eingestellt. Deshalb hat unsere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erleben wir selbst eine Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. Das Virus verändert unseren Alltag, unsere Kommunikationsformen, wie wir arbeiten, fühlen und denken. Die Krise fungiert wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen. Der Zukunftsforscher Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Krise: Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, Staaten, Familien, Unternehmen auf die Herausforderung? Welche Rolle spielt die Angst vor der Zukunft, und wie können wir sie in Zuversicht verwandeln? Geht alles nach ein paar Monaten wieder seinen alten Gang? Oder erleben wir jetzt einen Kulturwandel, einen Big Shift, in dem alles seine Richtung ändert, und eine völlig neue Zukunft entsteht? Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, die Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und er kommt damit zu überraschenden Ergebnissen. Matthias Horx: Die Zukunft nach Corona. Ullstein eBooks 2020, 14,99 Euro
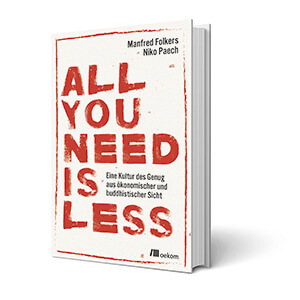 Das aktuelle von Buch von Niko Paech und Manfred Folkers: All you need is less. Oekom 2020, 20 Euro
Das aktuelle von Buch von Niko Paech und Manfred Folkers: All you need is less. Oekom 2020, 20 Euro