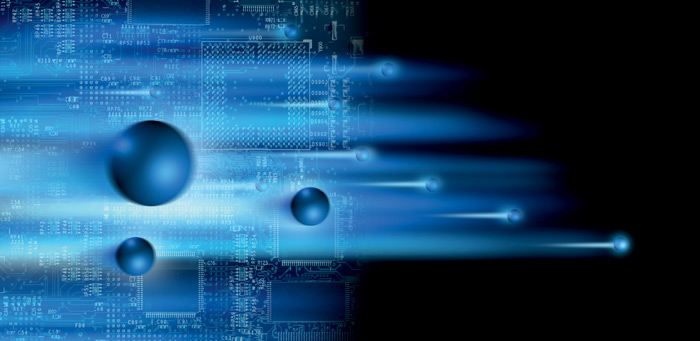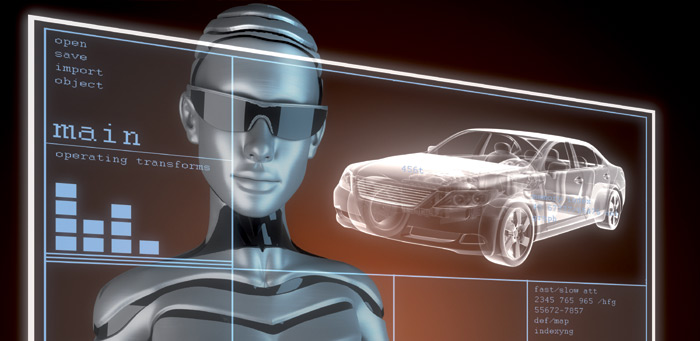In der Medizin wird seit Jahrzehnten an Therapiemethoden zur Bekämpfung von Krebs geforscht. Für einen führenden Medizingerätehersteller hat Brunel ein spezielles Embedded System entwickelt, das Medizinern neue Möglichkeiten bei der Behandlung bietet. Von Robert Uhde, für Brunel
Ziel jeder Strahlentherapie ist es, mit energiereicher Strahlung die Tumorzellen im Körper zu zerstören. Doch obwohl dabei versucht wird, ausschließlich den Krebs zu treffen, ist es letztlich nicht vermeidbar, dass auch gesundes Gewebe oder Organe angegriffen werden. Die Protonentherapie ist dazu eine Alternative, da sie diese Bereiche ausspart und Tumore gezielter mit positiv geladenen Wasserstoffkernen behandelt. Dadurch lassen sich Nebenwirkungen reduzieren. Für einen führenden Hersteller medizinischer Geräte und Software für die Strahlentherapie hat Brunel Communications, ein Entwicklungszentrum für Embedded Systems mit Sitz am Standort Hildesheim, ein Auswertungssystem zur Erfassung der exakten Position des Protonenstrahls entwickelt: „Mit unserer Messwertverarbeitung werden die vorliegenden Daten unmittelbar vor der Anwendung noch einmal überprüft, um die verschiedenen Parameter über eine zentrale Steuerung gegebenenfalls noch einmal nachjustieren zu können“, beschreibt Francisco Matesanz, Leiter von Brunel Communications, das grundlegende Prinzip des eingebetteten Systems. Für eine optimierte Ausrichtung wird der Protonenstrahl zunächst durch eine Ionisationskammer geleitet, in der zwei um neunzig Grad versetzte Goldfolien angeordnet sind. „Dabei werden kleinste Ströme mit maximal 500 Nanoampere erzeugt, um so die genauen X- und Y-Koordinaten des Protonenstrahls erfassen und anschließend digitalisieren zu können“, erklärt Matesanz. „Zur Filterung der Ströme haben wir eine spezielle Hardware basierend auf einem Xilinx Virtex-6-FPGA entwickelt, in dem eine System-on-Chip-Plattform mit drei eingebetteten Prozessoren implementiert wurde.“ Diese integrierten Schaltkreise, in die logische Schaltungen programmiert werden können, erlauben neben einem geringeren Kosten- und Energieverbrauch vor allem die Miniaturisierung des eingebetteten Systems. Das anspruchsvolle Projekt wurde 2011 gestartet und ist inzwischen formal abgeschlossen. Zu der eigentlichen Softwareprogrammierung kamen dabei noch weitere Arbeitsschritte: „In enger Absprache mit der Elektronikentwicklung haben wir zunächst den genauen Funktionsumfang der Software definiert und eine entsprechende Architektur entwickelt“, berichtet Matesanz. Erst dann erfolgte die eigentliche Implementierung in der vorgesehenen Programmiersprache. „Parallel dazu haben wir mit der Hardware-Entwicklung sowie der Umsetzung der Schaltungen in ein Layout begonnen. Nach ausführlichen Tests konnte die Software schließlich in die Elektronik integriert und beides im Zusammenspiel unter realitätsnahen Situationen ausführlich getestet werden.“ Eine Aufgabe für Spezialisten Die Ausgliederung der Entwicklungsarbeit an einen externen Dienstleister bot dem Hersteller den Vorteil, kurzfristig und für eine befristete Zeit auf eine komplette Entwicklungsorganisation inklusive der dazu erforderlichen technischen Infrastruktur zurückgreifen zu können. Seitens Brunel waren dabei rund zwanzig Mitarbeiter beteiligt, darunter Hardware- und Software- Entwickler, Test- und Verifikationsingenieure sowie Projektleiter. Zu den größten Herausforderungen für das Team zählten insbesondere das Messen von sehr kleinen Strömen in einem stark gestörten EMV-(Elektromagnetische Verträglichkeit)Umfeld sowie die Verarbeitung der Datenströme in Echtzeit. „Darüber hinaus mussten die verschiedenen digitalen Funktionen in einem komplexen System-on-Chip integriert werden“, erklärt Matesanz. Ein weiterer Baustein war die ausführliche Dokumentation sämtlicher Entwicklungsschritte. „Damit ist sichergestellt, dass die Maßnahmen jederzeit nachvollziehbar sind und unser Auswertesystem den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen zur Entwicklung von medizinischen Produkten genügt.“ Um die verschiedenen Aufgaben zu bewältigen, sollten die Mitarbeiter neben konzeptionellem Denken insbesondere ein hohes Bewusstsein für sicherheitsrelevante Projekte sowie die Fähigkeit zum prozessgeführten Arbeiten mitbringen. Zudem war ein umfangreiches Know-how bei der Entwicklung von hochkomplexen Designs der Hardwarebeschreibungssprache VHDL und bei echtzeitfähigen Software- Applikationen sowie beim Design von aufwendigen analogen Schaltungen und bei der normenbasierten Dokumentenerstellung gefordert. Nicht zu vergessen die Teamfähigkeit: „Bei einer Projektgröße von 20 Mitarbeitern sind regelmäßige Projektmeetings und gemeinsame Besprechungen der weiteren Entwicklungsschritte an der Tagesordnung“, erklärt Matesanz. Um das Projekt erfolgreich umsetzen zu können, achtete Brunel darauf, dass die Teams sowohl mit erfahrenen Mitarbeitern als auch mit hochmotivierten Hochschulabsolventen besetzt waren. Die Absolventen sollten dabei ähnliche Voraussetzungen wie die langjährigen Mitarbeiter mitbringen und gute technische Kenntnisse in den geforderten Fachrichtungen haben. Matesanz fügt aber auch an: „Fehlende Berufserfahrung kann bei uns in vielen Fällen durch Fachpraktika oder andere Qualifikationen ersetzt werden.“ Das Endprodukt hat bereits das Marketing- Approval. Die Zulassung der behördlichen Lebensmittelüberwachung und der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA zur Betreibung der Anlage wird noch für dieses Jahr erwartet.Filmtipp Medizininformatiker und Biochemiker Thomas Kühne ist Experte für Informationstechnologie in der Medizin. Er erklärt, was er sich unter der Medizin der Zukunft vorstellt!