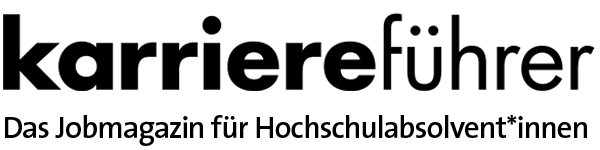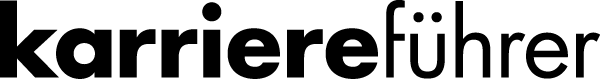Interview mit Dr. Liane Koker
Für ihre Dissertation zu „Künstlichen Akkommodationssystemen“ erhielt die Ingenieurin Liane Koker 2012 den mit 10.000 Euro dotierten Bertha-Benz-Preis. Ihr Arbeitgeber ist das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), aktuell ist die Forscherin in Elternzeit. Im Interview berichtet sie über problematische Rollenbilder sowie über die Aussichten, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Dr. Liane Koker, geboren 1980 in Magdeburg, begann 2000 ein Mechatronikstudium an der Berufsakademie in Karlsruhe, das sie drei Jahre später als Diplom-Ingenieurin abschloss. 2004 setzte sie ihren akademischen Werdegang mit einem Maschinenbaustudium an der damaligen Universität Karlsruhe (TH) – heute KIT – fort. Ihre Diplomarbeit verfasste sie als GEARE-Stipendiatin („Global Engineering Alliance for Research and Education“) an der Purdue Universität in Indiana. Ihre Dissertation erarbeitete sie am KIT am Institut für Angewandte Informatik (IAI). Für diese Arbeit erhielt sie 2012 den Bertha- Benz-Preis. Liane Koker ist verheiratet und seit Januar 2013 Mutter einer Tochter.
Frau Dr. Koker, Sie sind als Forscherin auf der Suche nach einem künstlichen Akkommodationssystem. Können Sie kurz erklären, was genau Sie machen?
Das künstliche Akkommodationssystem ist ein aktives Implantat, das die Akkommodation mechatronisch wiederherstellt – also die Fähigkeit des Menschen, verschieden weit entfernte Objekte scharf zu sehen. Die künstliche Linse hat einen Durchmesser von circa neun Millimetern und ist ein hochkomplexes Mikrosystem. Die große Herausforderung ist die Integration aller Komponenten in einen sehr begrenzten und anatomisch vorgegebenen Bauraum. Das Implantat sollte zudem eine wartungsfreie Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten vorweisen sowie biokompatibel und biostabil sein. Es darf also den Körper weder schädigen noch durch diesen in seiner Funktion beeinträchtigt werden. Wir arbeiten dabei tatsächlich an der Grenze des technisch Realisierbaren.
Was sind Ihrer Ansicht nach die Gründe dafür, dass es noch immer wenige Ingenieurinnen bis in Führungspositionen schaffen?
Ich denke, hier kommen weiterhin die tief in der Gesellschaft verwurzelten Rollenbilder zum Tragen. Die Mutter eines einjährigen Mädchens sagte mir neulich: „Ich weiß gar nicht, was ich meiner Kleinen später für neues Spielzeug kaufen soll. Die große Schwester hat ja schon alles – Puppenstube, Kinderküche und so weiter. Wäre das zweite Kind ein Junge geworden, hätte ich eine Werkbank kaufen können.“ Sicherlich hätte diese Mutter nichts dagegen, wenn ihre Tochter später einmal den Wunsch äußert, Ingenieurin zu werden. Aber aufgrund der selbstverständlichen Ausrichtung ihres Umfelds kommen viele Mädchen gar nicht erst auf diese Idee.
War Ihr familiäres Umfeld anders?
Für mich als Tochter einer Ingenieurin war immer klar, dass Frauen arbeiten gehen und ebenso die freie Berufswahl haben wie Männer. Darum habe ich mich durch die Sprüche mancher Lehrer wie „Frauen gehören an den Herd“ auch nicht beirren lassen. Andere Mädchen sind vielleicht leichter zu beeinflussen. Deshalb beteilige ich mich gern an Veranstaltungen des KIT, in denen Ingenieurinnen, Physikerinnen oder Informatikerinnen jungen Mädchen ihre Berufsbilder vorstellen, um den vorgeprägten Rollenbildern eine Alternative entgegenzuhalten und Mut zur freien Berufswahl zu machen.