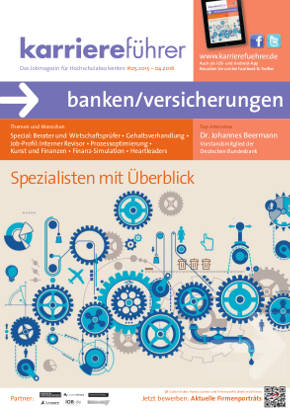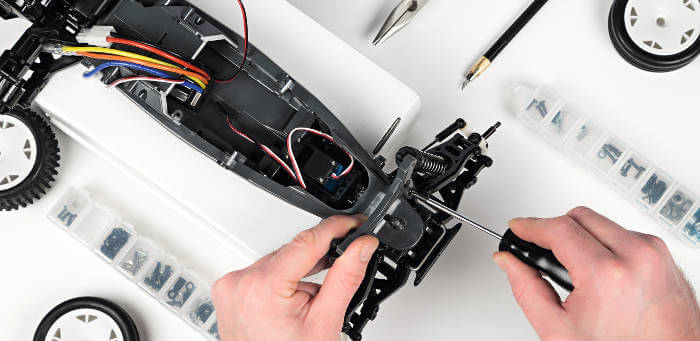Je komplexer eine Materie ist, desto gefragter sind Experten. Für die Finanzbranche ist das Chance und Gefahr zugleich: Die Unternehmen müssen aufpassen, sich nicht im Spezialistentum zu verlieren. Denn Vertrauen gewinnt man nur durch Mitarbeiter, die ihr Know-how im Sinne der Kunden anwenden können. Hier liegt die Chance für Einsteiger: Gefragt sind Spezialisten mit Bodenhaftung. Von André Boße
Die Finanzbranche differenziert sich weiter. Im Wettbewerb um die Kunden positionieren sich viele Banken mit spezifischen Schwerpunkten, um aus Kundensicht zum Spezialisten für bestimmte Geschäfte zu werden. Damit dies gelingt, ist mehr notwendig als Hochglanzbroschüren und eine hübsch formulierte Internetseite. Die Finanzunternehmen benötigen Mitarbeiter, die sich tatsächlich und täglich als Spezialisten erweisen, ohne dabei die gesamte Branche und die Bedürfnisse des Kunden aus dem Blick zu verlieren. Gefragt sind Experten, die auf ihrem Gebiet absolute Kenner sind – sich dann jedoch nicht im Fachjargon verlieren und die Kunden links liegen lassen. Erfolgreiche Spezialisten verfügen daher über das Talent, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren und im Sinne ihrer Kunden zu nutzen. Und genau solche Typen sind in der Finanzbranche mehr denn je gefragt: Sie sorgen dafür, dass private und geschäftliche Kunden den Spezialisten wieder vertrauen.
Mitarbeiter machen den Unterschied
Die Bandbreite der spezialisierten Finanzunternehmen ist groß. So gibt es zum Beispiel Banken für diverse Kundengruppen: für junge Familien und nachhaltig denkende Bürger, für Sportler und Priester. Hier kommt es darauf an, sich in die Lebenswelt der jeweiligen Klientel einzudenken: Welche Phasen gibt es, wenn die Familie wächst? Und welche Themen stehen wann an der Tagesordnung? So sollte man jungen Eltern noch nicht mit einem Kinderkonto kommen, wenn der Nachwuchs erst ein paar Monate alt ist und nachts kaum schläft. Steht das Kind dagegen vor der Einschulung, ist dieses Thema plötzlich sehr präsent.
Spezialisten in Grün
Der Öko-Boom setzt sich auch in der Finanzbranche durch: Banken mit nachhaltigen Geschäftsmodellen setzen darauf, Kunden und Nachwuchskräfte zu gewinnen, die einen besonderen Wert auf ethische und ökologische Geldgeschäfte legen. Das Nachhaltigkeitsportal Utopia. de hat die grüne Bilanz der Anbieter in diesem speziellen Segment getestet, ein Ranking erstellt und vier Banken empfohlen: die GLS Bank, die UmweltBank, die EthikBank sowie die Triodos Bank.
Quelle: www.utopia.de/ratgeber/gruenes-banken-brevier-alternative-bankinstitute
Neben diesen Banken gibt es eine Reihe von Finanzunternehmen, die sich auf bestimmte Teilaspekte der Branche fokussieren. Dazu zählt zum Beispiel die Baader Bank, eine der führenden Investment-Banken, die institutionelle Anleger beim Handel mit Finanzinstrumenten unterstützt und für Unternehmen Finanzierungslösungen entwickelt. Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, bei dem Vertrauen besonders wichtig ist. „Die Mitarbeiter sind das Aushängeschild eines Unternehmens, denn mit fachlicher Kompetenz allein gewinnt die Bank dieses Vertrauen nicht “, weiß Rainer Merklinghaus, Head of Human Resources and Company Organisation.
„An den Erfolg der Zusammenarbeit glaubt der Kunde heute erst dann, wenn er spürt, dass der Bankberater seine Expertise und Erfahrung mit unternehmerischem Handeln im Sinne des Klienten kombiniert.“ Damit das funktioniert, arbeiten Einsteiger bei der Bank aus dem Münchener Raum von Beginn an intensiv mit den erfahrenen Mitarbeitern zusammen. „Im täglichen operativen Geschäft arbeiten Nachwuchskräfte in kleinen Teams eng mit Senior-Kollegen zusammen“, so der Personalchef.
Erfahrungsaustausch unter Spezialisten
Das Wissensmanagement stellt daher bei spezialisierten Häusern eine wichtige Herausforderung dar. Bei der Baader Bank werden von der Dokumentation von Best-Practice-Lösungen bis hin zu internen Wikis Quellen erstellt, die auch den jungen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. „Die erworbenen Kenntnisse werden dann nach einer meist kurzen Lernphase direkt angewendet“, so Merklinghaus. „Die neuen Kollegen übernehmen schnell eigenverantwortlich einzelne Aufgaben und wachsen in kurzer Zeit in die Position hinein, die sie zukünftig ausfüllen werden.“ Mit Blick auf den Handel mit Wertpapieren gewinne dabei die IT immer mehr an Bedeutung, erklärt der Experte:
Die Bank betreut mehr als 700.000 Wertpapiere im börslichen und außerbörslichen Handel. Hier sind innovative Technologien gefragt, wobei das Institut mit Blick auf den Ideenreichtum der Nachwuchskräfte offen für neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge ist. „Dabei“, so Rainer Merklinghaus, „sind Vorschläge für kleine Effizienzverbesserungen im Tagesgeschäft der Bank genauso wertvoll wie neue Strategien durch innovative Ansätze aus Wissenschaft und Technik.“
Wer möglichst dicht am Handel mit Wertpapieren einsteigen möchte, für den ist die Deutsche Börse ein interessanter Arbeitgeber. Bekannt ist das Unternehmen vor allem als Träger der öffentlich-rechtlichen Frankfurter Wertpapierbörse, also dem wichtigsten deutschen Handelsplatz mit einem Umsatzanteil von fast 90 Prozent. Darüber hinaus ist die Gruppe mit ihren mehr als 3800 Mitarbeitern international präsent und organisiert weltweit Märkte für Investoren, die Kapital anlegen, und Unternehmen, die Kapital aufnehmen. „Wir sorgen mit unseren Dienstleistungen und Systemen dafür, dass diese Märkte funktionieren und alle Teilnehmer gleiche Chancen erhalten“, heißt es in der Unternehmensbeschreibung. Gesucht werden dafür Risiko-Manager und Compliance-Officer, die sich auf die strengen regulatorischen Aspekte des Wertpapierhandels spezialisieren.
Ebenfalls gefragt sind Softwareentwickler, denn eine Hochleistungs-IT ist heute die Grundlage des Wertpapierhandels und damit ein „integrativer Bestandteil unseres Unternehmens“, so Jessica Erk, Head of Apprenticeship & Recruiting Germany der Deutschen Börse.
Global den Handel organisieren
Gearbeitet wird im Unternehmen häufig projektorientiert. Wer daher in ein Unternehmen wie die Deutsche Börse einsteigt, sollte sich auf einen Job einstellen, der von den Mitarbeitern eine gewisse Beweglichkeit verlangt. „Durch unsere internationale Ausrichtung und Strategie werden insbesondere im Hinblick auf Führungspositionen Eigenschaften wie Mobilität, Flexibilität und Mehrsprachigkeit an Bedeutung gewinnen“, sagt Jessica Erk. Daher lege die Deutsche Börse bei der Auswahl und Entwicklung des Personals immer größeren Wert auf diese kulturellen Fähigkeiten.
„Wer in einer projektorientierten Organisation Erfolg haben will, sollte dauerhaft stabile soziale Netzwerke aufbauen, sich schnell in neue Aufgabengebiete einarbeiten und den Spagat zwischen Teamfähigkeit und Durchsetzungsvermögen meistern können“, bringt die Personalverantwortliche die Anforderungen auf den Punkt.
Zwei Berufswege, ein Trainee-Team
Dass die Unternehmen der Finanzbranche heute IT und Beratung nicht mehr als zwei vollkommen unterschiedliche Bereiche betrachten, zeigt der Blick auf einen traditionellen Spezialisten, die Bausparkasse Schwäbisch Hall. Das Unternehmen ist seit mehr als 80 Jahren am Markt und fest in der genossenschaftlichen Finanzgruppe der Volks- und Raiffeisenbanken verankert. Aus dieser Organisation ergeben sich Werte und eine Unternehmenskultur, die von allen Einsteigern weitergetragen werden soll – ob im Beratergeschäft oder in der IT-Abteilung.
Daher durchlaufen alle Trainees das gleiche Programm, unabhängig davon, welchen fachlichen Hintergrund sie aus dem Studium mitbringen oder in welchem Bereich sie später arbeiten. „Wir legen Wert darauf, dass auch im IT-Bereich Führungskräfte und Projektleiter das Tagesgeschäft von Schwäbisch Hall kennen“, sagt Richárd Kovács, Referent im Personalmarketing.
„Wir erreichen mit diesem Einstiegsprogramm, dass in der gesamten Unternehmensgruppe eine gemeinsame Kultur entsteht. Im Projektgeschäft bringt uns das dann erhebliche Vorteile.“ Durch diese Vielfalt in den Trainee-Teams erfahren die IT-Einsteiger, wie ihre Entwicklungen im Alltagsgeschäft der Bausparkasse zum Einsatz kommen – zum Beispiel, wenn es darum geht, IT-Lösungen für den klassischen Bausparvertrag oder die Riester-geförderte Eigenheimrente zu entwickeln.
Eine noch speziellere Art von Immobiliengeschäften wickelt die Deutsche Pfandbriefbank ab. Das Institut mit Sitz in München ist eine Spezialbank für die Immobilienfinanzierung sowie die öffentliche Investitionsfinanzierung. Auf den Kapitalmärkten ist das Institut gemessen am ausstehenden Volumen zudem der größte Ausgeber von Pfandbriefen, also Anleihen, die in der Regel von Grundstücken und Immobilien gedeckt werden. Die Deutsche Pfandbriefbank ist das Nachfolgeinstitut der im Zuge der Bankenkrisenotverstaatlichten Hypo Real Estate.
„Aktuell ist die Privatisierung des Konzerns – neben unserem operativen Kern- und Tagesgeschäft – unser wichtigstes Projekt“, sagt Gabriele Rappensperger, Leiterin Personal. Eine spannende Phase bei der Bank, die den Einsteigern in der ersten Phase einen Rundumblick auf die unterschiedlichen Abteilungen einer Immobilienbank gibt. „Innerhalb des Bereichs Credit Risk Management übernehmen Nachwuchskräfte rasch Aufgaben im Rahmen der Kreditbearbeitung und erwerben Kenntnisse in der Erstellung von Kreditvorlagen, der Umsetzung von Transaktionen und der Beurteilung von Kreditrisiken“, beschreibt Rappensperger die Herausforderungen für junge Einsteiger.
Leistungsträger mit einigen Jahren Berufserfahrung und Potenzial werden gefördert, sich zum Immobilienmanager weiterzuqualifizieren. Dann geht es noch tiefer in die Materie, von Immobilieneigenschaften und Wertermittlungsverfahren bis hin zu Kenntnissen in Finanzierungs- und Refinanzierungsprozessen. Aber gerade die Geschichte der Hypo Real Estate zeigt: Spezialisten dürfen sich nicht in ihrem Fachgebiet verlieren. Die besten Experten sind die, die auch wissen, was links und rechts ihres Spezialgebiets geschieht.
Aufteilung des Marktes
Laut der Strategieberatung Bain kommt es im Bankensektor zu einer stärkeren Fokussierung der Geschäftsmodelle. Die Berater gehen davon aus, dass sich der Markt künftig in globale Universalbanken, Regionalinstitute und Spezialisten aufteilen wird. Letztere würden sich über individuelle Wettbewerbsvorteile wie einen besonderen Kundenzugang oder Skaleneffekten im Produktionsprozess positionieren.
Zudem werde das Bankengeschäft zu einer ganz normalen Industrie – mit geringeren Renditen und weniger Risiken. Insgesamt sei der Strukturwandel mit dem Umbruch in der Stahlindustrie im vergangenen Jahrhundert vergleichbar. Am Ende des Prozesses würden weniger, fokussiertere und renditestärkere Häuser stehen.
Quelle: www.bain.de