Zu wenig unternehmerisches Denken, zu viel Angst vor neuer Technik, zu starre Strukturen: Jörg Offenhausen findet klare Worte, wenn es darum geht, zu erklären, warum sich der Rechtsmarkt mit technischen Innovationen schwertut. Als Geschäftsführer des German Legal Tech Hubs arbeitet er daran, das zu ändern – indem er Anwälte und Anwältinnen mit Start-ups verbindet, nach dem Motto: Problem sucht Lösung. Die Fragen stellte André Boße.
Herr Offenhausen, Sie haben in einem Interview gesagt, dass es Anwälten und Anwältinnen, die mit Legal Tech nichts am Hut haben wollen, wie Videotheken ergehen wird – sprich: Die werden irgendwann verschwinden. Ja, so hart muss man es formulieren. Was machen Anwälte zum großen Teil? Sie reproduzieren immer wieder ähnliche Dinge. Und alle Dinge, die ähnlich und reproduzierbar sind – die sind anfällig für Automatisierungen. Es gibt in den Kanzleien bestimmte Bereiche, da wird es in der nächsten Zeit keine bahnbrechenden technischen Entwicklungen geben, zum Beispiel in der individuellen Rechtsberatung. Dennoch müssen sich Kanzleien jetzt mit der Automatisierung beschäftigen. Wobei ich davon ausgehe, dass viele Anwälte sehr genau wissen, dass einige Geschäftsmodelle nicht länger aufgehen werden. Welche zum Beispiel? Wenn ein Mandant anruft und sagt, er möchte gerne einen Arbeitsvertrag haben – dann füllt der Anwalt den Arbeitsvertrag aus und erstellt eine Rechnung von 500 Euro. Ich denke, insgeheim weiß man, dass es so nicht weitergehen wird, weil die Technik die Erstellung solcher Verträge wesentlich effektiver gestalten wird. Wenn man als Kanzlei da nicht mitgeht, diese Effektivität also nicht anbietet, dann wird der Markt das nicht mehr annehmen. Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz im Bereich Legal Tech? Noch hat die KI ein Grundproblem – und zwar die KI-Halluzination: Wenn die KI etwas nicht weiß, dann denkt sie sich etwas aus. Wobei das Ausgedachte so gut klingt, dass man glauben könnte, es sei richtig. Ist es aber nicht. Es kommen falsche Ergebnisse heraus, und wir als Anwälte haften für falsche Ergebnisse. Das ist natürlich eine Gefahr. Ich denke daher, dass die Diskussion über KI in Kanzleien noch weit in die Zukunft führt. In zehn, 20 Jahren werden wir anders darüber reden. Mich interessieren jedoch die technischen Entwicklungen mehr, mit denen man heute etwas machen kann. Für die es bereits Anwendungsfälle gibt. Und das ist primär bei der Verbesserung des Workflows der Fall. Wenn es um Arbeiten geht, die alle nerven, die aber trotzdem erledigt werden müssen.Zur Person
Jörg Offenhausen ist Geschäftsführer des German Legal Tech Hubs. Als Rechtsanwalt ist er Managing Partner der Wirtschaftskanzlei activelaw und dort auch als Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht tätig. Aus seiner Arbeit kennt Jörg Offenhausen die Innovationshemmnisse von Mittelstand, Konzernen und Kanzleien aus erster Hand. Er gründete eigene erfolgreiche Legal Start-ups und trat im Vorstand der Anwaltskammer Celle für die digitale Transformation der juristischen Arbeit ein.
Mich interessieren die technischen Entwicklungen mehr, mit denen man heute etwas machen kann. Für die es bereits Anwendungsfälle gibt.Von welchem konkreten Anwendungsfall können Sie in naher Zukunft profitieren? Ich komme aus dem Arbeits-, Handels- und Gesellschaftsrecht. Wenn ich mich mit Mandanten treffe, dann unterhalten wir uns für rund zwei Stunden. Danach setze ich mich hin und erstelle aus meinem fachlichen Wissen heraus und aus dem, was ich im Gespräch erfahren habe, einen Vertrag. Der Vorgang dauert insgesamt vielleicht 15 Stunden – wobei die eigentliche, geistige Wertschöpfung nur in den ersten beiden Stunden stattgefunden hat. Im Mandantengespräch. Genau. Danach habe ich den Vertrag im Kopf schon fertig. Auf das „Zusammenstückeln“, das danach ansteht, hat eigentlich niemand Lust. Ich auch nicht. An dieser Stelle kann die Technik übernehmen: Ich nenne diesem System die zentralen Stellschrauben, von denen ich im Gespräch erfahren habe, und dann übernimmt die Technik die Arbeit des Zusammenstückelns. Das würde uns Zeit und Nerven sparen … … und dem Mandanten würde es Geld sparen. Ja, und den Unternehmen mit ihren Rechtsabteilungen übrigens auch. Man darf nicht vergessen: Es gibt einen Fachkräftemangel. Wenn solche Arbeiten wegfallen, können die Arbeitskräfte, die wir haben, sinnvoller eingesetzt werden. Ich denke, es sollte in diesem Bereich generell darauf ankommen, dass Juristen sich fragen: Was an meiner Arbeit macht mir eigentlich keine Freude? Hat man das definiert, welche Arbeit man gerne loswerden würde, kann man in den Austausch mit anderen gehen, um herauszufinden: Geht es denen genauso? Heißt die Antwort ja – dann gibt es einen Markt für eine Lösung, die den Anwälten diese Arbeit abnimmt.
Unsere Aufgabe ist es also, die Start-ups mit dem Bedarf zusammenzuführen – auch, damit nicht am Bedarf vorbei entwickelt wird. Denn es kommt schon auch vor, dass Entwickler eine App vorstellen, die etwas kann, was Anwälte gar nicht benötigen.An dieser Stelle kommen die Start-ups ins Spiel, die sich darauf verstehen, Lösungen für Probleme zu entwickeln. Wobei wir unsere Aufgabe beim German Legal Tech Hub darin sehen, die genannten Akteure in Kontakt zu bringen, sprich die Anwälte, die sich eine Innovation wünschen, und die Tech-Anbieter, die diesen Wunsch erfüllen können. Unsere Aufgabe ist es also, die Start-ups mit dem Bedarf zusammenzuführen – auch, damit nicht am Bedarf vorbei entwickelt wird. Denn es kommt schon auch vor, dass Entwickler eine App vorstellen, die etwas kann, was Anwälte gar nicht benötigen. Start-ups denken progressiv. Der Rechtsmarkt, so heißt es häufig, sei eher konservativ. Stimmt das in Ihren Augen noch? Ja, man muss sagen, dass die Branche weiterhin sehr konservativ ist. Und durchaus auch innovationsfeindlich. Das liegt aber nicht an den Persönlichkeiten der Anwälte, sondern an der Struktur der Kanzleien. Es gilt in Deutschland weiterhin das Fremdbesitzverbot sowie das Verbot von Beteiligungen. Das führt dazu, dass kein Wagniskapital in die Anwaltschaft fließt. Es ist nicht möglich, dass ein Investor an den Einnahmen des Anwalts beteiligt ist; es gibt auch keine Gewinnbeteiligungen.
Ja, man muss sagen, dass die Branche weiterhin sehr konservativ ist. Und durchaus auch innovationsfeindlich. Das liegt aber nicht an den Persönlichkeiten der Anwälte, sondern an der Struktur der Kanzleien.Angenommen, ein junger Anwalt würde sagen: „Ich möchte gerne etwas Neues auf die Beine stellen, ein neues Kanzleikonzept, mit digitaler Automatisierung, und dafür brauche ich 500.000 Euro“ – dann kann er entweder zu anderen Anwälten gehen, um dort einzusteigen, oder zu einer Bank. Dort hört er dann: „500.000 Euro, aha, was haben Sie denn als Sicherheiten?“ – „Keine.“ – „Oh, dann wird das aber schwierig.“ Und warum sind die Partner der Kanzleien nicht innovationsfreudig? Anwaltskanzleien sind in der Regel als Personengesellschaften organisiert, ähnlich einer GbR. Das bedeutet steuerlich, dass am Ende des Jahres die Gewinne den einzelnen Partnern zugerechnet werden. Will ein Partner Investitionen tätigen, dann muss das in einer großen Runde besprochen werden. Und dort trifft er unter Umständen auf andere Partner, die schon ein wenig älter sind und sagen: „In zehn Jahren, wenn sich die Innovation rechnet, bin ich gar nicht mehr dabei, warum wollen wir jetzt Geld investieren?“ Es wird also nicht unternehmerisch gedacht. Zu wenig, und um es noch einmal klarzustellen: Das liegt eher an strukturellen Problemen als an den Einstellungen der Anwälte. Das beginnt schon bei der universitären Ausbildung, die ich für nicht mehr zeitgemäß halte. Es gibt viel zu wenig betriebswirtschaftliche Inhalte. Und auch zu wenig Inhalte, die sich mit den Möglichkeiten von Legal Tech beschäftigen. Viele Anwälte wissen daher zu wenig über Betriebswirtschaft und digitale Lösungen. Und dann hören sie von allen Seiten: „Die Digitalisierung ändert alles, ihr müsst was machen!“ So entstehen Ängste, denn Angst bekommt man dann, wenn man nicht richtig prognostizieren kann, was auf einen zukommt, oder wenn man sogar eine negative Prognose für die Zukunft hat. Umso wichtiger sind Orte, an denen die Leute miteinander sprechen. Orte, an denen sich auch die junge Generation mit ihren Ideen einbringen kann und an denen man merkt: Ich bin mit meinem Problem ja gar nicht allein, also finden wir gemeinsam eine Lösung!
German Legal Tech Hub
Ob KI-basierte Vertragsgestaltung, Prozessoptimierung oder Cybersecurity: Legal Tech-Lösungen versprechen neue Effizienz auf dem Rechtsmarkt. Um die Potenziale heben zu können, benötigen die Kanzleien einen Überblick über die Lösungen, der sich durch einen Austausch mit Startups, Wissenschaft und anderen Unternehmen ergibt. Der German Legal Tech Hub hat es sich zur Aufgabe gemacht, als branchenübergreifende Plattform diese Brücken zwischen den diversen Legal Tech-Interessierten zu bauen. germanlegaltechhub.com




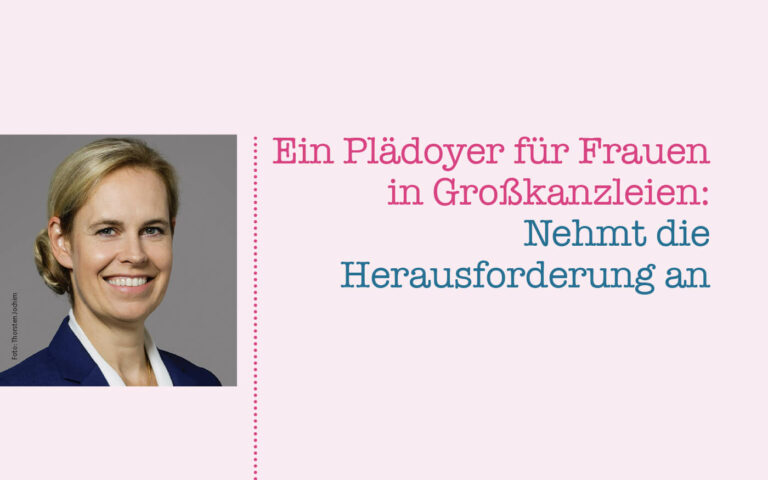





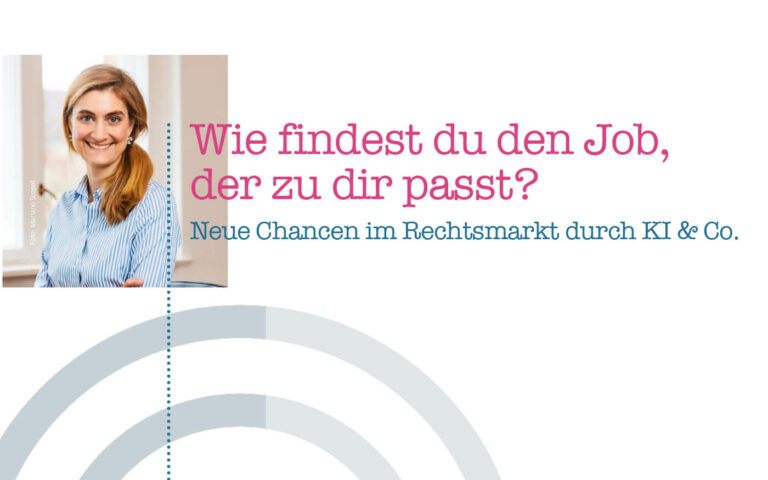
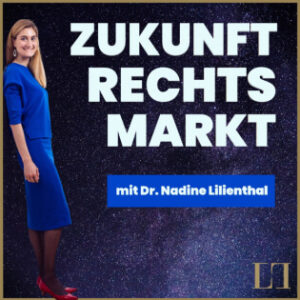 In ihrem
In ihrem 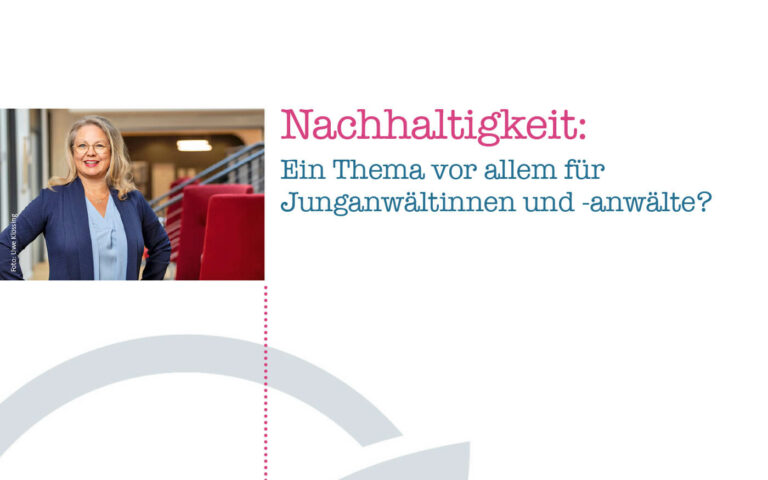
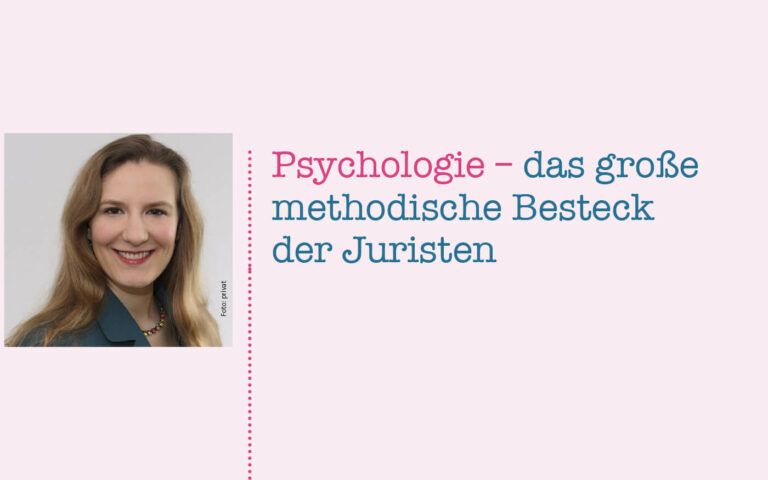
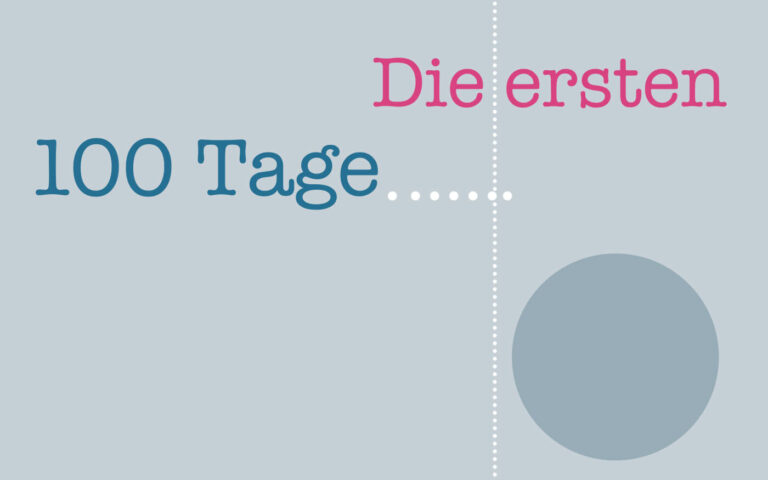



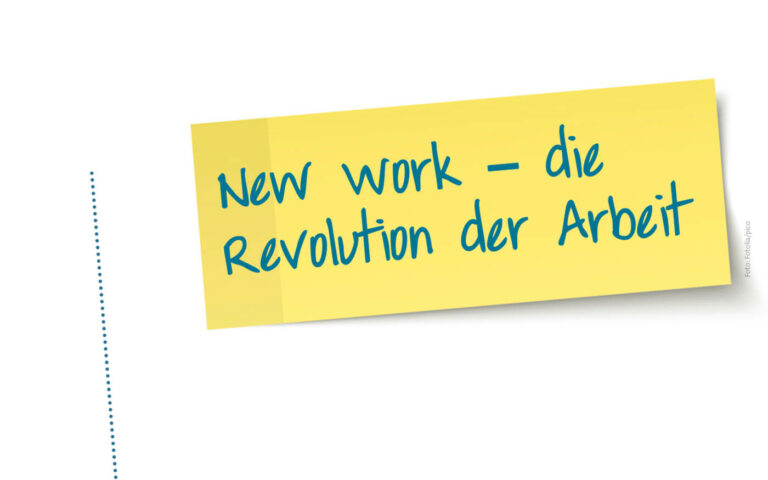

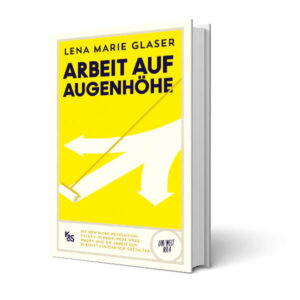 „Arbeit auf Augenhöhe“ (Kremayr & Scheriau 2022)
„Arbeit auf Augenhöhe“ (Kremayr & Scheriau 2022)
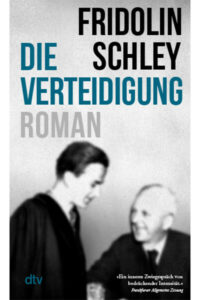 Ein sprachmächtiger Roman über die Frage nach Gut und Böse
Ein sprachmächtiger Roman über die Frage nach Gut und Böse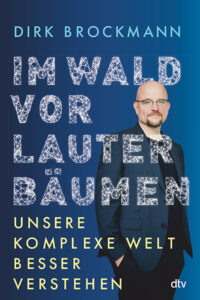 In einer vernetzten Welt müssen wir vernetzt denken. Nur so können wir Zusammenhänge, grundlegende Gemeinsamkeiten, universelle Muster und Regeln erkennen. Und auf diese Weise vielschichtigen Phänomenen wie Pandemien, Klimakatastrophen, Artensterben, Verschwörungserzählungen begegnen. Der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann nimmt die Welt als Ganzes in den Blick. Er sucht nach Ähnlichkeiten zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen, macht Verbindungen sichtbar und liefert damit so ungewöhnliche wie aufschlussreiche Perspektiven. Eine Denkanleitung, die Komplexität einfach verständlich macht. Dirk Brockmann. Im Wald vor lauter Bäumen. Unsere komplexe Welt besser verstehen. dtv 2023, 14 Euro
In einer vernetzten Welt müssen wir vernetzt denken. Nur so können wir Zusammenhänge, grundlegende Gemeinsamkeiten, universelle Muster und Regeln erkennen. Und auf diese Weise vielschichtigen Phänomenen wie Pandemien, Klimakatastrophen, Artensterben, Verschwörungserzählungen begegnen. Der Komplexitätsforscher Dirk Brockmann nimmt die Welt als Ganzes in den Blick. Er sucht nach Ähnlichkeiten zwischen natürlichen und gesellschaftlichen Prozessen, macht Verbindungen sichtbar und liefert damit so ungewöhnliche wie aufschlussreiche Perspektiven. Eine Denkanleitung, die Komplexität einfach verständlich macht. Dirk Brockmann. Im Wald vor lauter Bäumen. Unsere komplexe Welt besser verstehen. dtv 2023, 14 Euro
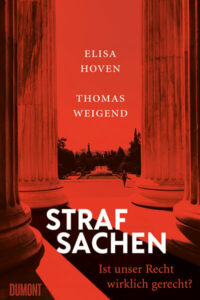 Das Strafrecht polarisiert , fasziniert und empört wie kaum ein anderes Thema. Immer wieder gibt es Straftaten, die uns verunsichern, da sie unsere grundlegenden Regeln und Werte infrage stellen. Diese Verunsicherung wächst, wenn es zum Prozess kommt: Die Urteile der Gerichte sind für viele Bürger und Bürgerinnen häufig nicht nachvollziehbar. Elisa Hoven und Thomas Weigend greifen in ihrem Buch spektakuläre und prominente Fälle auf, die verwundert, besorgt oder empört haben. Anhand des „Ku’ Damm-Raser-Falls“ diskutieren sie, ob Raser Mörder sind. Der Fall der Gruppenvergewaltigung von Mülheim wiederum stellt die Gerichte sowie Leser und Leserinnen vor die Frage, ob und wie ein zwölfjähriger Vergewaltiger bestraft werden sollte. Und im Kapitel über den „Fall Kristina Hänel“ beleuchten die Autoren kritisch das Gesetz, das Informationen über Schwangerschaftsabbrüche verbot . Stets analysieren sie, warum die Gerichte so und nicht anders geurteilt haben, und fragen, ob das juristisch wie ethisch vertretbar ist. Dabei zeigen sie die Grenzen und Bedingungen unseres Rechtssystems auf. Elisa Hoven und Thomas Weigend. Strafsachen. Ist unser Recht wirklich gerecht? DuMont 2023, 23 Euro
Das Strafrecht polarisiert , fasziniert und empört wie kaum ein anderes Thema. Immer wieder gibt es Straftaten, die uns verunsichern, da sie unsere grundlegenden Regeln und Werte infrage stellen. Diese Verunsicherung wächst, wenn es zum Prozess kommt: Die Urteile der Gerichte sind für viele Bürger und Bürgerinnen häufig nicht nachvollziehbar. Elisa Hoven und Thomas Weigend greifen in ihrem Buch spektakuläre und prominente Fälle auf, die verwundert, besorgt oder empört haben. Anhand des „Ku’ Damm-Raser-Falls“ diskutieren sie, ob Raser Mörder sind. Der Fall der Gruppenvergewaltigung von Mülheim wiederum stellt die Gerichte sowie Leser und Leserinnen vor die Frage, ob und wie ein zwölfjähriger Vergewaltiger bestraft werden sollte. Und im Kapitel über den „Fall Kristina Hänel“ beleuchten die Autoren kritisch das Gesetz, das Informationen über Schwangerschaftsabbrüche verbot . Stets analysieren sie, warum die Gerichte so und nicht anders geurteilt haben, und fragen, ob das juristisch wie ethisch vertretbar ist. Dabei zeigen sie die Grenzen und Bedingungen unseres Rechtssystems auf. Elisa Hoven und Thomas Weigend. Strafsachen. Ist unser Recht wirklich gerecht? DuMont 2023, 23 Euro
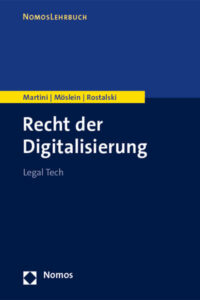 Die Digitalisierung hinterlässt ihre Spuren im Recht, etwa in der Vertragsgestaltung, bei Fragen der Strafzumessung oder im Verwaltungshandeln und ist damit Gegenstand der juristischen Ausbildung. Ausgehend von einer begrifflichen Klärung erörtert das Lehrbuch anhand der drei großen Hauptrechtsgebiete (Öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafrecht) die Schnittstellen, an denen Recht und Digitalisierung sich treffen, etwa Grundrechte mit Digitalisierungsbezug, Fragen des Datenschutzes, Digitalisierung des Verwaltungshandelns, Automatisierter Vertragsschluss, digitale Inhalte und (Rechts-)Dienstleistungen, Eigentum an Daten und digitalen Token, strafrechtlicher Schuldbegriff und Straftatenahndung. Zahlreiche Beispiele sowie Wiederholungs- und Vertiefungsfragen am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Verständnis. Mario Martini, Florian Möslein, Frauke Rostalski: Recht der Digitalisierung: Legal Tech (Nomoslehrbuch). Nomos 2023, 28,90 Euro
Die Digitalisierung hinterlässt ihre Spuren im Recht, etwa in der Vertragsgestaltung, bei Fragen der Strafzumessung oder im Verwaltungshandeln und ist damit Gegenstand der juristischen Ausbildung. Ausgehend von einer begrifflichen Klärung erörtert das Lehrbuch anhand der drei großen Hauptrechtsgebiete (Öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafrecht) die Schnittstellen, an denen Recht und Digitalisierung sich treffen, etwa Grundrechte mit Digitalisierungsbezug, Fragen des Datenschutzes, Digitalisierung des Verwaltungshandelns, Automatisierter Vertragsschluss, digitale Inhalte und (Rechts-)Dienstleistungen, Eigentum an Daten und digitalen Token, strafrechtlicher Schuldbegriff und Straftatenahndung. Zahlreiche Beispiele sowie Wiederholungs- und Vertiefungsfragen am Ende eines jeden Kapitels erleichtern das Verständnis. Mario Martini, Florian Möslein, Frauke Rostalski: Recht der Digitalisierung: Legal Tech (Nomoslehrbuch). Nomos 2023, 28,90 Euro
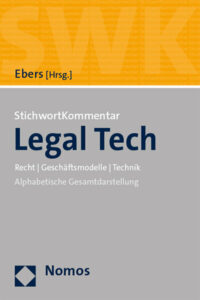 Die IT-basierte Optimierung rechtlicher Handlungsfelder ist Gegenwar t und Zukunft der (juristischen) Berufe. Was bedeutet das konkret für die eigene Beratungs- und Entscheidungssituation, wann kann oder muss ich welche Technik einsetzen? Antwor ten liefert der neue Stichwort-Kommentar Legal Tech. Auf knapp 1.400 Seiten und in 96 Stichworten erklär t er die rechtlichen, technischen und ökonomischen Aspekte von Legal Tech. Er geht auf die entscheidenden rechtlichen Aspekte des Einsatzes von Legal Tech-Anwendungen unter Einbeziehung aller betroffenen Rechtsgebiete ein, erläutert die Legal Tech-Tools in technischer Hinsicht – verständlich und fallbezogen – und stellt die verschiedenen Geschäftsmodelle in ökonomischer Hinsicht dar. Das Werk ist das ideale Arbeitsmittel für alle, die sich mit den praktischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Aspekten von Legal Tech ver traut machen oder ihre Kenntnis vertiefen möchten. Martin Ebers: StichwortKommentar Legal Tech. Recht | Geschäftsmodelle | Technik. Alphabetische Gesamtdarstellung. Nomos 2023, 149 Euro
Die IT-basierte Optimierung rechtlicher Handlungsfelder ist Gegenwar t und Zukunft der (juristischen) Berufe. Was bedeutet das konkret für die eigene Beratungs- und Entscheidungssituation, wann kann oder muss ich welche Technik einsetzen? Antwor ten liefert der neue Stichwort-Kommentar Legal Tech. Auf knapp 1.400 Seiten und in 96 Stichworten erklär t er die rechtlichen, technischen und ökonomischen Aspekte von Legal Tech. Er geht auf die entscheidenden rechtlichen Aspekte des Einsatzes von Legal Tech-Anwendungen unter Einbeziehung aller betroffenen Rechtsgebiete ein, erläutert die Legal Tech-Tools in technischer Hinsicht – verständlich und fallbezogen – und stellt die verschiedenen Geschäftsmodelle in ökonomischer Hinsicht dar. Das Werk ist das ideale Arbeitsmittel für alle, die sich mit den praktischen, rechtlichen, wirtschaftlichen und technischen Aspekten von Legal Tech ver traut machen oder ihre Kenntnis vertiefen möchten. Martin Ebers: StichwortKommentar Legal Tech. Recht | Geschäftsmodelle | Technik. Alphabetische Gesamtdarstellung. Nomos 2023, 149 Euro
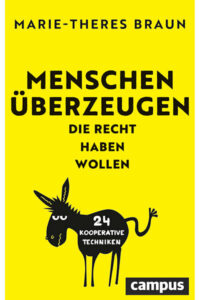 Wie begeistere ich Kritikerinnen und Kritiker für meine Ideen? Wie hole ich Menschen ins Boot, die stur auf ihren Überzeugungen beharren? Und warum eskalieren viele Diskussionen offline und online so schnell? Marie-Theres Braun zeigt anhand von realen Geschichten aus Beruf und Alltag, wie viel Macht hinter kooperativen Strategien steckt. Sie erklärt den Hintergrund von Gesprächs-Sackgassen und verrät rhetorische Methoden, mit denen wir unser Gegenüber überzeugen und uns in Diskussionen behaupten können. Die Schritt-für-Schritt-Techniken verhelfen selbst konfliktscheuen Menschen zu mehr Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft. Die Kommunikationsexpertin erläutert mitreißend, wie wir auch schwierige Menschen „knacken“ und zu einer positiven Gesprächskultur finden. Marie-Theres Braun. Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. 24 kooperative Techniken. Campus Verlag 2023, 24 Euro
Wie begeistere ich Kritikerinnen und Kritiker für meine Ideen? Wie hole ich Menschen ins Boot, die stur auf ihren Überzeugungen beharren? Und warum eskalieren viele Diskussionen offline und online so schnell? Marie-Theres Braun zeigt anhand von realen Geschichten aus Beruf und Alltag, wie viel Macht hinter kooperativen Strategien steckt. Sie erklärt den Hintergrund von Gesprächs-Sackgassen und verrät rhetorische Methoden, mit denen wir unser Gegenüber überzeugen und uns in Diskussionen behaupten können. Die Schritt-für-Schritt-Techniken verhelfen selbst konfliktscheuen Menschen zu mehr Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft. Die Kommunikationsexpertin erläutert mitreißend, wie wir auch schwierige Menschen „knacken“ und zu einer positiven Gesprächskultur finden. Marie-Theres Braun. Menschen überzeugen, die Recht haben wollen. 24 kooperative Techniken. Campus Verlag 2023, 24 Euro
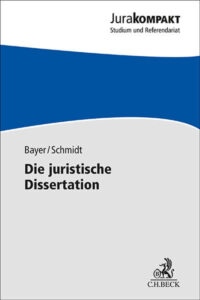 Dieses Buch soll Lust darauf machen, sich der Herausforderung einer juristischen Dissertation zu stellen und beantwortet die Fragen, die im Laufe eines Promotionsprozesses aufkommen, zum Beispiel: „Wann ist der passende Zeitpunkt für eine Promotion – nach dem ersten oder nach dem zweiten Examen?“ „Soll ich in meiner Dissertation gendern?“ „Wie läuft das Promotionsverfahren ab?“ Oder: „Wie finde ich einen Verlag?“ Die Antworten kommen aus der Praxis. Denn die Autorin und der Autor des Buches haben mit 300 Promovierenden aus 15 juristischen Fakultäten gesprochen und ihre Antworten zusammengefasst. Herausgekommen ist ein Buch, das kein dogmatischer Ratgeber sein soll. Auch die wertvollen Hinweise von Betreuungspersonen und anderen Doktorandinnen und Doktoranden soll das Buch nicht ersetzen, sondern ergänzen um den Erfahrungsschatz anderer Doktorandinnen und Doktoranden. Daria Bayer/Jan-Robert Schmidt. Die juristische Dissertation. C.H. Beck 2023, 12,90 Euro
Dieses Buch soll Lust darauf machen, sich der Herausforderung einer juristischen Dissertation zu stellen und beantwortet die Fragen, die im Laufe eines Promotionsprozesses aufkommen, zum Beispiel: „Wann ist der passende Zeitpunkt für eine Promotion – nach dem ersten oder nach dem zweiten Examen?“ „Soll ich in meiner Dissertation gendern?“ „Wie läuft das Promotionsverfahren ab?“ Oder: „Wie finde ich einen Verlag?“ Die Antworten kommen aus der Praxis. Denn die Autorin und der Autor des Buches haben mit 300 Promovierenden aus 15 juristischen Fakultäten gesprochen und ihre Antworten zusammengefasst. Herausgekommen ist ein Buch, das kein dogmatischer Ratgeber sein soll. Auch die wertvollen Hinweise von Betreuungspersonen und anderen Doktorandinnen und Doktoranden soll das Buch nicht ersetzen, sondern ergänzen um den Erfahrungsschatz anderer Doktorandinnen und Doktoranden. Daria Bayer/Jan-Robert Schmidt. Die juristische Dissertation. C.H. Beck 2023, 12,90 Euro 