KI ein Zukunftsthema? Ja, aber eines, mit dessen Umsetzung heute begonnen werden muss. Deutschland hat hier dringenden Nachholbedarf: Studien zeigen, dass viele Talente ins Ausland gehen. Auch, weil die mittelständischen Unternehmen, die Deutschland stark machen, das KI-Thema weiter skeptisch betrachten. Die Strategie muss daher lauten, Künstliche Intelligenz in die Umsetzung zu bringen. Und zwar jetzt. Ein Essay von André Boße
Digitale Technologien, denen der gesellschaftliche Durchbruch gelingt, benötigen eine niedrigeschwellige Durchfahrt, durch die die Anwendenden bequem eine neue Welt erreichen können. Das gesamte Internet war für die meisten ein abstrakter Kosmos, bis die Suchmaschinen kamen und alle sofort den konkreten Nutzen entdeckten. Amazon eröffnete der Masse die Möglichkeiten des E-Shoppings, Facebook erschloss den Kosmos der sozialen Netzwerke. Ende 2022 erlebte die digitale Welt einen neuen Moment aus dieser Kategorie: Das US-Unternehmen Open AI, ein strategischer Partner des Microsoft-Konzerns, der hier viel Geld investiert, stellte ChatGPT der Allgemeinheit zur Verfügung.
Dabei handelt es sich um eine sehr einfach zu bedienende Anwendung, mit deren Hilfe jeder Interessierte ausprobieren konnte, wozu die Künstliche Intelligenz in der Lage ist, wenn es um das Verfassen von Texten geht. Wer sich auch nur ein wenig für Zukunftstechnologien interessierte, experimentierte mit diesem Chatbot-Interface, das mit Hilfe von Machine Learning-Methoden darauf trainiert ist, alle möglichen Textgattungen zu entwerfen: Gedichte und Geschichten, Definitionen und Fachartikel, Briefe und Entschuldigungsschreiben für die Schule.
KI für jeden – ChatGPT macht es möglich
Der wahre Nutzwert von ChatGPT? Na ja, 99 Prozent der Anfragen hätte man auch mit einer konventionellen Suchmaschine machen können. Aber darum ging es nicht. Bedeutsamer ist, dass die KI-Anwendung mit dem Launch von ChatGPT nun ihren „Moment für die Masse“ hatte: War KI zuvor ein Thema der nahen Zukunft, ist sie nun niedrigschwellig für alle erlebbar. Was dazu führte, dass sich die breite Gesellschaft endlich einigen Fragen widmete, die zuvor schon in Fachkreisen behandelt wurden: Welche Folgen hat eine KI, die vollautomatisiert Texte verfasst, die sonst von Menschen geschrieben werden mussten, für die Arbeitswelt? Für Jurist*innen und Journalist*innen, für Sacharbeiter*innen und Lehrer*innen?
KI in der Logistik
Der Digitalisierungsdienstleister Arvato zeigt in seinem Whitepaper „KI in der Logistik“ auf, welche Anwendungen für diese Branche zentral sind und welche positiven Effekte sie mit sich bringen. So steigere der Einsatz von KI-Systemen nicht nur die Effizienz der logistischen Prozesse, auch lasse sich CO2 einsparen, was die Logistikunternehmen an das Ziel heranführt, schon bald klimaneutral zu wirtschaften. Erreicht werde dies, so die Studie, unter anderem durch die Wahl des passenden Fahrzeugs und die Optimierung etwa der Lieferrouten auf Basis von Echtzeitdaten und Verkehrsanalysen; dies führe zu kürzeren Strecken sowie zu weniger Verkehr und Verzögerungen.
Wobei das Verfassen von Texten nur der Anfang sein wird: ChatGPT ist ein Indiz dafür, dass es möglich ist, jegliche standardisierbaren Aufgaben von einer KI übernehmen zu lassen. Sofort ergeben sich die typischen sorgenvollen Fragen: Bedeutet das das Ende der menschlichen Arbeit? Und was soll der Mensch denn dann tun?
Menschen werden nicht ersetzt, sondern benötigt
Beschäftigt man sich tiefgehender mit dem Thema, zeigt sich, dass eine andere Frage viel bedeutsamer ist: Wo bekommen wir die Menschen her, die wir benötigen, um die KI in Anwendung zu bringen? Die Stiftung Neue Verantwortung, ein gemeinnütziger Think Tank, der gesellschaftliche Aspekte des technologischen Wandels untersucht, hat Ende 2022 eine empirische Studie vorgelegt, die akademische Karrierepfade im Bereich der KI untersucht. Der Abschlussbericht trägt den Titel „Deutschland als KI-Standort: Destination oder Drehscheibe“ – das Papier beschäftigt sich also vor allem damit, welche Möglichkeiten die Bundesrepublik jungen KIExpert* innen gibt, ob diese im Land dauerhafte Anstellungen finden oder hier in erster Linie Zwischenstationen einlegen.
Wie zentral die Position Deutschlands bei diesem Thema auf dem globalen Arbeitsmarkt ist, zeigt die von der Bundesregierung ins Leben gerufene „Nationale Strategie für Künstliche Intelligenz“, die erstmals 2018 definiert wurde und seitdem stetig weiterentwickelt wird. Auf der Homepage wird ein zentrales Ziel der Strategie sehr eindeutig formuliert: „Deutschland soll zum attraktiven Standort für die klügsten KI-Köpfe der Welt werden.“
Zwischenzeugnis für KI-Strategie
Die Studie der Stiftung Neue Verantwortung stellt dieser Strategie gut vier Jahre später nun eine Art Zwischenzeugnis aus – auch auf Basis des Geldes, das die Politik in die Umsetzung der Strategie gesteckt hat. Denn: „Dass die Bundesregierung für dieses Vorhaben zunächst drei Milliarden und später im Rahmen des Zukunftspakets weitere zwei Milliarden Euro veranschlagte, unterstreicht, welches Potenzial sie in dieser Schlüsseltechnologie sieht“, heißt es im Data Brief, den die Autor*innen zu den Studienergebnissen verfasst haben.
Wobei die KI-Expert*innen die grundsätzliche Ansicht der Strategie als absolut positiv bewerten: Die Einsatzgebiete von KI seien so vielfältig, dass zahlreiche Wirtschaftszweige auf sie setzen. „Dabei“, so heißt es, „geht es nicht um eine spezielle Erfindung, sondern eine Basistechnologie, die der international bekannte KI-Forscher Andrew Ng gerne mit der Bedeutung der Elektrizität vergleicht.“ Es liege daher auf der Hand, dass die „Entwicklung und Implementierung einer so grundlegenden Technologie mit so gewaltigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Potenzialen, aber auch Risiken, die besten Talente erfordert“.
Hier zur Uni, woanders Karriere machen
Wie gut das gelingt, zeigen die Ergebnisse der Studie. Der Ansatz der Untersuchung war es, zu schauen, wer in Deutschland im KI-Bereich promoviert – und wohin es die Doktorand*innen nach der Promotion verschlägt. Sprich: Wo machen sie Karriere? Was sich dabei laut der Datenanalyse zeigt: „Deutschland ist als Promotionsstandort im Bereich KI international attraktiv.“ 53 Prozent der KI-Doktorand*innen an deutschen Universitäten habe ihren ersten universitären Abschluss nicht in Deutschland, sondern im Ausland gemacht. Zum Vergleich verweist die Studie auf den fächerübergreifenden Anteil von internationalen Doktorand*innen, dieser liege bei rund zwölf Prozent. „Im KI-Bereich gibt es also relativ gesehen deutlich mehr internationale Doktorand*innen als an deutschen Universitäten insgesamt“, heißt es in der Studie.
Neues Geschäftsmodell: AIaaS
Für Unternehmen, die erfolgreich eigene KI-Systeme implementiert haben, wird es zum Geschäftsmodell, diese als Dienstleistung an andere Unternehmen zu verkaufen. Artificial Intelligence as a Service nennt sich dieses Geschäftsmodell, kurz: AIaaS. Ein Anbieter auf diesem Feld ist Lufthansa Industry Solutions, eine IT-getriebene Tochter des Luftfahrtkonzerns. „AIaaS bezieht sich auf schlüsselfertige KI-Tools von der Stange, mit denen Unternehmen von KI einfach profitieren können“, heißt es in einem Whitepaper des Konzepts, das damit KI-Technologie, die Geschäftsprozesse automatisieren und beschleunigen könne, für jeden zugänglich mache: „Durch Programmierschnittstellen (APIs) können Anwender die Leistung von KI nutzen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen“, heißt es im Whitepaper.
Wohin aber zieht es die promovierten KI-Expert* innen nach der Uni? Die Daten zeigen, dass 63 Prozent von ihnen auch drei Jahre nach der Promotion noch in Deutschland tätig sind. Von denjenigen, die aus dem Ausland für die Promotion nach Deutschland kamen, seien es lediglich 54 Prozent; die anderen ziehe es in erster Linie in die USA, nach Großbritannien oder in die Schweiz. Auch hier bringt ein Vergleich eine wichtige Erkenntnis: Daten aus den USA zeigten, dass dort selbst fünf Jahre nach dem Abschluss der Promotion noch 82 Prozent der im Bereich KI Graduierten im Land tätig sind.
Deutschland bei KI-Jobs eine „Mittelmacht“
Das Fazit der Autor*innen: Deutschland ist im globalen Wettbewerb um die besten Köpfe der KI eine „Mittelmacht“, die Nachwuchswissenschaftler*innen anziehe und ausbilde, dann aber viele ihrer besten Talente – auch die in Deutschland geborenen – an die global führenden KI-Standorte verliert. Bei diesem Ergebnis von einem „Brain-Drain“ zu sprechen, also davon, dass Deutschland die Talente wegbrechen, wäre vielleicht zu dramatisch.
Dennoch zeigt sich: Im Bereich KI übertrifft die Attraktivität der akademischen Bildung diejenige des aktuellen Arbeitsmarktes. „Viele der Personen, die Deutschland nach Abschluss ihrer Dissertation verlassen haben, arbeiten heute für ein US-amerikanisches Big-Tech- Unternehmen wie Alphabet (Google & DeepMind), Meta oder Amazon“, heißt es in der Studie. Und weiter: „Deutsche Universitäten und Forschungsinstitutionen sind ein wichtiger Teil des KI-Talentpools, in dem die großen Tech-Firmen fischen.“ Wobei sich diese großen Tech-Firmen eben hauptsächlich in den USA befinden.
Es ist daher Aufgabe der Politik, der Think- Tanks und der Wirtschaft, zusammen mit den potenziellen Arbeitgebern konkrete Anwendungsfälle zu erarbeiten und diese in Projekten umzusetzen.
Stärke nutzen: KI im Mittelstand
Nun wird auch eine finanzstarke Strategie der Bundesregierung nicht dafür sorgen, dass in Deutschland reihenweise neue Tech-Konzerne entstehen, die den Talenten Karrieremöglichkeiten geben. Die Tendenz der KI-Initiativen und der deutschen Wirtschaft geht daher dahin, die Stärken der Bundesrepublik zu nutzen – und dort für attraktive Job-Profile und Berufsfelder zu sorgen. Ins Spiel kommen hier die mittelständischen Unternehmen, laut eines Whitepapers der Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte „die wahren Erfolgsträger der deutschen Wirtschaft“.
Good-Practice-KI-Beispiele aus der M+E-Industrie
Derzeit entwickeln nur wenige Unternehmen eigene KI-Anwendungen oder erproben die Technologie in Pilotprojekten. Sebastian Terstegen, Experte des ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft, sagt dazu: „Das ifaa möchte mit Good-Practice-Beispielen die Akzeptanz für KI erhöhen und Hemmschwellen abbauen, KI im eigenen Unternehmen anzuwenden.“ Eine neue ifaa- Praxisbroschüre stellt daher Anwendungsbeispiele aus kleinen und mittleren Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie vor.
Jedoch betrachte man dort die KI weiterhin ambivalent: „Für mittelständische Unternehmen stellen sich neben der ganz allgemeinen Frage, was KI eigentlich genau ist, auch die Anschlussfragen, ob KI eine optionale oder im Wettbewerbskampf überlebensnotwendige Technologie ist, wie KI im Mittelstand umgesetzt werden kann, wie hoch die strategische Bedeutung von KI ist und ob es bereits Referenzprojekte ‚in der Gegenwart gibt‘.“ Als größte Risiken würden die für die Deloitte-Studie befragten Unternehmen aus dem Mittelstand Probleme mit den Daten, einen zu hohen Aufwand im Vergleich zum Ertrag sowie einen mangelnden Durchblick bei dem, was die KI eigentlich macht, betrachten.
Bei diesen Punkten zeigt sich, worauf es bei diesem Thema ankommt: auf Aufklärungsarbeit in den Unternehmen. Es ist für KI-Talente wenig motivierend, bei einem Arbeitgeber einzusteigen, der KI-Systeme grundsätzlich in Frage stellt oder zumindest die immensen Chancen nicht erkennt. Zwar kann die junge Generation mit ihrem Wissen und ihrem Enthusiasmus dafür sorgen, dass die Unternehmen anders auf die Zukunftstechnologien schauen. Doch wirkt es bereits mittelfristig demotivierend, ständig gegen Windmühlen kämpfen zu müssen – zumal mit dem Wissen, dass es anderswo Unternehmen gibt, in denen man diese Überzeugungsarbeit nicht leisten muss.
Es ist daher Aufgabe der Politik, der Think- Tanks und der Wirtschaft, zusammen mit den potenziellen Arbeitgebern konkrete Anwendungsfälle zu erarbeiten und diese in Projekten umzusetzen. Erstens, um den Unternehmen die Sorgen zu nehmen. Und zweitens, um möglichst schnell aus einem Zukunftsthema eines der Gegenwart zu machen. Denn klar ist, dass sich Deutschland die Abwanderung der Talente nicht länger leisten kann.
Buchtipp
 Selbstfahrende Autos, optimiertes Online-Shopping, Logistiklösungen, Chatbots oder automatisierte Fertigungsprozesse – die Liste der Anwendungen von KI ist lang, und sie wird mit jedem Tag länger. Umso wichtiger ist es, den Entwicklungen ein strukturelles Gerüst zu bieten, das mit festen Standards für Sicherheit und Systematik sorgt. Vergleichbarkeit und Transparenz sind vonnöten, um KI-Anwendungen besser in den Alltag zu integrieren. Analog zum „Nutriscore“ bei Lebensmitteln soll daher mit dem Konzept der „AI=MC²“-Bezeichnung eine Lösung zur eindeutigen Klassifizierung von KI-Produkten installiert werden. AI=MC² (AI Methods, Capabilities and Criticality Grid) ist auch zentraler Gegenstand der Normungsroadmap KI des DIN, deren zweite Ausgabe im Dezember 2022 erschienen ist. Es besteht aus den drei Dimensionen KI-Methoden, KI-Fähigkeiten und Kritikalität einer KI-Lösung und ist das ideale Werkzeug, um Potenziale und Risiken einer KI-Anwendung zu analysieren und zu bewerten. Das Buch erläutert die Grundlagen und Zusammenhänge und das Vorgehen innerhalb des AI-MC²-Grids. Taras Holoyad, Thomas Schmid, Wolfgang Hildesheim (Hrsg.): Künstliche Intelligenz managen und verstehen: Der Praxis-Wegweiser für Entscheidungsträger, Entwickler und Regulierer. Beuth 2023, 29,90 Euro
Selbstfahrende Autos, optimiertes Online-Shopping, Logistiklösungen, Chatbots oder automatisierte Fertigungsprozesse – die Liste der Anwendungen von KI ist lang, und sie wird mit jedem Tag länger. Umso wichtiger ist es, den Entwicklungen ein strukturelles Gerüst zu bieten, das mit festen Standards für Sicherheit und Systematik sorgt. Vergleichbarkeit und Transparenz sind vonnöten, um KI-Anwendungen besser in den Alltag zu integrieren. Analog zum „Nutriscore“ bei Lebensmitteln soll daher mit dem Konzept der „AI=MC²“-Bezeichnung eine Lösung zur eindeutigen Klassifizierung von KI-Produkten installiert werden. AI=MC² (AI Methods, Capabilities and Criticality Grid) ist auch zentraler Gegenstand der Normungsroadmap KI des DIN, deren zweite Ausgabe im Dezember 2022 erschienen ist. Es besteht aus den drei Dimensionen KI-Methoden, KI-Fähigkeiten und Kritikalität einer KI-Lösung und ist das ideale Werkzeug, um Potenziale und Risiken einer KI-Anwendung zu analysieren und zu bewerten. Das Buch erläutert die Grundlagen und Zusammenhänge und das Vorgehen innerhalb des AI-MC²-Grids. Taras Holoyad, Thomas Schmid, Wolfgang Hildesheim (Hrsg.): Künstliche Intelligenz managen und verstehen: Der Praxis-Wegweiser für Entscheidungsträger, Entwickler und Regulierer. Beuth 2023, 29,90 Euro





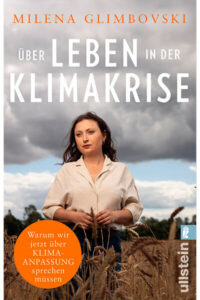 Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente
Gesellschaft zu schaffen. Milena Glimbovski: Das Leben in der Klimakrise. Ullstein Buchverlage 2023. 14,99 Euro. Milena Glimbovski veröffentlicht zudem den Podcast „
Ansteigende Temperaturen, massive Dürre, extreme Wetterphänomene – die Klimakrise ist längst auch in Deutschland angekommen. Die Trinkwasserversorgung ist nicht mehr sicher, die Landwirtschaft hat es so schwer wie nie zuvor, der Meeresspiegel steigt. Doch selbst wenn die politisch Verantwortlichen die große Katastrophe noch abwenden können: Viele klimatische Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Milena Glimbovski, Aktivistin und Gründerin des ersten Unverpackt-Ladens in Berlin, stellt in ihrem Buch konkrete Maßnahmen vor, die wir politisch, aber auch privat umsetzen müssen, um eine klimaresiliente
Gesellschaft zu schaffen. Milena Glimbovski: Das Leben in der Klimakrise. Ullstein Buchverlage 2023. 14,99 Euro. Milena Glimbovski veröffentlicht zudem den Podcast „
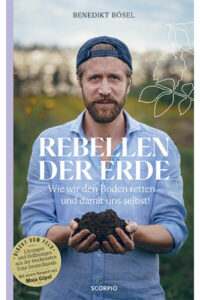 Nachdem Benedikt Bösel vor sechs Jahren den elterlichen Bauernhof in Brandenburg mit 3.000 Hektar Land und Forst übernommen hatte, wollte er den Beweis antreten, dass es möglich ist, zerstörte Nährstoffkreisläufe wieder zu schließen und damit nicht nur Extremwetterereignissen und Ernteausfällen zu trotzen, sondern auch das Mikroklima günstig zu beeinflussen. In seinem Buch berichtet der Landwirt des Jahres 2022 über seine weltweite Suche nach alternativen Landnutzungsmodellen und von seinen Erfolgen. Benedikt Bösel: Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten – und damit uns selbst! Scorpio Verlag 2023. 26 Euro
Nachdem Benedikt Bösel vor sechs Jahren den elterlichen Bauernhof in Brandenburg mit 3.000 Hektar Land und Forst übernommen hatte, wollte er den Beweis antreten, dass es möglich ist, zerstörte Nährstoffkreisläufe wieder zu schließen und damit nicht nur Extremwetterereignissen und Ernteausfällen zu trotzen, sondern auch das Mikroklima günstig zu beeinflussen. In seinem Buch berichtet der Landwirt des Jahres 2022 über seine weltweite Suche nach alternativen Landnutzungsmodellen und von seinen Erfolgen. Benedikt Bösel: Rebellen der Erde. Wie wir den Boden retten – und damit uns selbst! Scorpio Verlag 2023. 26 Euro
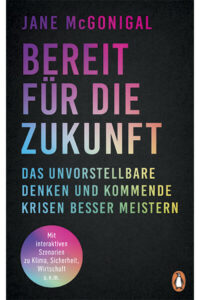 Die Zukunft ist unberechenbar, doch wir können uns auf sie vorbereiten, ganz gleich, welche Herausforderungen sie für uns bereithält. Das ist die These von Jane McGonigal, Spieleentwicklerin und zugleich eine der einflussreichsten Zukunftsforscherinnen. Die Forschungsleiterin am Institute for the Future in Palo Alto/Kalifornien zeigt in ihrem Buch „Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern“, wie wir die richtigen Fähigkeiten entwickeln können: ein Denken, das auf unvorhergesehene Herausforderungen schneller reagiert; die Inspiration, heute die richtigen Weichen für unser Leben in der Zukunft zu stellen; die Kreativität, Probleme auf nie dagewesene Weise zu lösen. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Wir aber können uns auf das vorbereiten, was heute noch niemand kommen sieht. Jane McGonigal Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern. Penguin Verlag. 24 Euro
Die Zukunft ist unberechenbar, doch wir können uns auf sie vorbereiten, ganz gleich, welche Herausforderungen sie für uns bereithält. Das ist die These von Jane McGonigal, Spieleentwicklerin und zugleich eine der einflussreichsten Zukunftsforscherinnen. Die Forschungsleiterin am Institute for the Future in Palo Alto/Kalifornien zeigt in ihrem Buch „Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern“, wie wir die richtigen Fähigkeiten entwickeln können: ein Denken, das auf unvorhergesehene Herausforderungen schneller reagiert; die Inspiration, heute die richtigen Weichen für unser Leben in der Zukunft zu stellen; die Kreativität, Probleme auf nie dagewesene Weise zu lösen. Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen. Wir aber können uns auf das vorbereiten, was heute noch niemand kommen sieht. Jane McGonigal Bereit für die Zukunft. Das Unvorstellbare denken und kommende Krisen besser meistern. Penguin Verlag. 24 Euro 


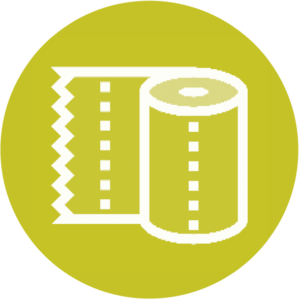


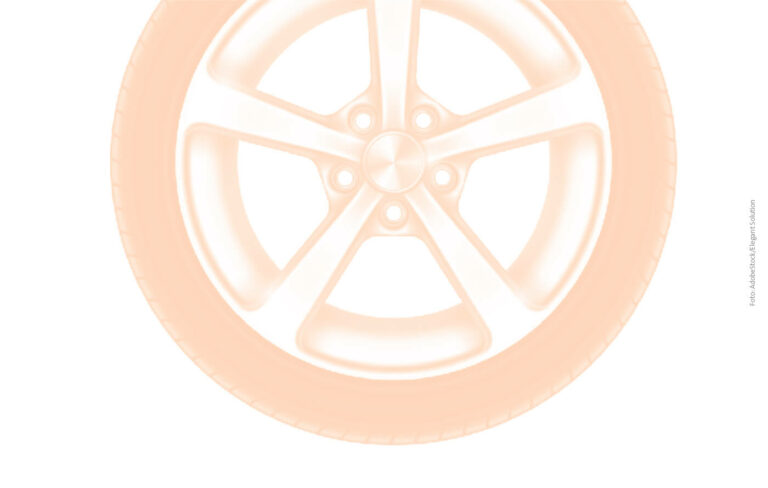


 Als Teil der Bau-Familie übernimmst Du Verantwortung für die Verwirklichung einer resilienten, nachhaltigen und innovativen Lebenswelt. Gemeinsam schaffen wir neue Räume für unsere Gesellschaft, verpassen unserer Infrastruktur ein zukunftsfestes Update, erschließen neue Möglichkeiten der Energiegewinnung und sorgen im öffentlichen wie privaten Sektor dafür, dass das Herz unserer Wirtschaft im Takt bleibt. Wir schaffen Werte, die bleiben und versetzen – wenn es sein muss – auch Berge. Dabei bist Du als Bauingenieur:in Kopf und Herz des Aufbruchs in eine neue Zukunft des Bauens. Denn der Strukturwandel im Bauwesen beginnt mit Dir.
Auch in Zeiten konjunktureller Unsicherheit stehen Bauingenieur:innen langfristig nur vor der Wahl, welcher Arbeitgeber für sie der richtige ist. Der demografische Wandel spielt Dir als zukünftigem/r Bauingenieur:in in die Karten, denn rund 50 Prozent der Ingenieurinnen und Ingenieure im Bauwesen haben das 50. Lebensjahr überschritten und ein Generationswechsel steht an. Bauingenieur:innen gehören daher zu den gefragtesten Fachexpert:innen und der Bedarf an Absolvent:innen ist enorm. Dir stehen alle Wege offen – sowohl in den Unternehmen der Bauwirtschaft als auch im öffentlichen Sektor. Eine zunehmende Spezialisierung und Diversifizierung der Aufgabengebiete, die Digitalisierung der Branche und der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Technologien eröffnen dabei eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten schon im Studium aber auch im späteren Berufsleben.
Als Teil der Bau-Familie übernimmst Du Verantwortung für die Verwirklichung einer resilienten, nachhaltigen und innovativen Lebenswelt. Gemeinsam schaffen wir neue Räume für unsere Gesellschaft, verpassen unserer Infrastruktur ein zukunftsfestes Update, erschließen neue Möglichkeiten der Energiegewinnung und sorgen im öffentlichen wie privaten Sektor dafür, dass das Herz unserer Wirtschaft im Takt bleibt. Wir schaffen Werte, die bleiben und versetzen – wenn es sein muss – auch Berge. Dabei bist Du als Bauingenieur:in Kopf und Herz des Aufbruchs in eine neue Zukunft des Bauens. Denn der Strukturwandel im Bauwesen beginnt mit Dir.
Auch in Zeiten konjunktureller Unsicherheit stehen Bauingenieur:innen langfristig nur vor der Wahl, welcher Arbeitgeber für sie der richtige ist. Der demografische Wandel spielt Dir als zukünftigem/r Bauingenieur:in in die Karten, denn rund 50 Prozent der Ingenieurinnen und Ingenieure im Bauwesen haben das 50. Lebensjahr überschritten und ein Generationswechsel steht an. Bauingenieur:innen gehören daher zu den gefragtesten Fachexpert:innen und der Bedarf an Absolvent:innen ist enorm. Dir stehen alle Wege offen – sowohl in den Unternehmen der Bauwirtschaft als auch im öffentlichen Sektor. Eine zunehmende Spezialisierung und Diversifizierung der Aufgabengebiete, die Digitalisierung der Branche und der verstärkte Fokus auf Nachhaltigkeit und innovative Technologien eröffnen dabei eine Vielzahl von Wahlmöglichkeiten schon im Studium aber auch im späteren Berufsleben.

 Weiterbildende berufsbegleitende Zertifikatsstudiengänge Fassade, Ausbau oder Holzbau an der Technischen Hochschule Augsburg:
Weiterbildende berufsbegleitende Zertifikatsstudiengänge Fassade, Ausbau oder Holzbau an der Technischen Hochschule Augsburg:



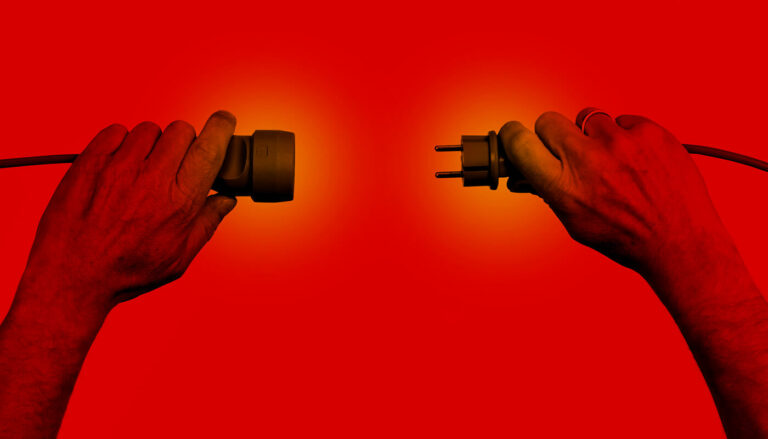
 Selbstfahrende Autos, optimiertes Online-Shopping, Logistiklösungen, Chatbots oder automatisierte Fertigungsprozesse – die Liste der Anwendungen von KI ist lang, und sie wird mit jedem Tag länger. Umso wichtiger ist es, den Entwicklungen ein strukturelles Gerüst zu bieten, das mit festen Standards für Sicherheit und Systematik sorgt. Vergleichbarkeit und Transparenz sind vonnöten, um KI-Anwendungen besser in den Alltag zu integrieren. Analog zum „Nutriscore“ bei Lebensmitteln soll daher mit dem Konzept der „AI=MC²“-Bezeichnung eine Lösung zur eindeutigen Klassifizierung von KI-Produkten installiert werden. AI=MC² (AI Methods, Capabilities and Criticality Grid) ist auch zentraler Gegenstand der Normungsroadmap KI des DIN, deren zweite Ausgabe im Dezember 2022 erschienen ist. Es besteht aus den drei Dimensionen KI-Methoden, KI-Fähigkeiten und Kritikalität einer KI-Lösung und ist das ideale Werkzeug, um Potenziale und Risiken einer KI-Anwendung zu analysieren und zu bewerten. Das Buch erläutert die Grundlagen und Zusammenhänge und das Vorgehen innerhalb des AI-MC²-Grids. Taras Holoyad, Thomas Schmid, Wolfgang Hildesheim (Hrsg.): Künstliche Intelligenz managen und verstehen: Der Praxis-Wegweiser für Entscheidungsträger, Entwickler und Regulierer. Beuth 2023, 29,90 Euro
Selbstfahrende Autos, optimiertes Online-Shopping, Logistiklösungen, Chatbots oder automatisierte Fertigungsprozesse – die Liste der Anwendungen von KI ist lang, und sie wird mit jedem Tag länger. Umso wichtiger ist es, den Entwicklungen ein strukturelles Gerüst zu bieten, das mit festen Standards für Sicherheit und Systematik sorgt. Vergleichbarkeit und Transparenz sind vonnöten, um KI-Anwendungen besser in den Alltag zu integrieren. Analog zum „Nutriscore“ bei Lebensmitteln soll daher mit dem Konzept der „AI=MC²“-Bezeichnung eine Lösung zur eindeutigen Klassifizierung von KI-Produkten installiert werden. AI=MC² (AI Methods, Capabilities and Criticality Grid) ist auch zentraler Gegenstand der Normungsroadmap KI des DIN, deren zweite Ausgabe im Dezember 2022 erschienen ist. Es besteht aus den drei Dimensionen KI-Methoden, KI-Fähigkeiten und Kritikalität einer KI-Lösung und ist das ideale Werkzeug, um Potenziale und Risiken einer KI-Anwendung zu analysieren und zu bewerten. Das Buch erläutert die Grundlagen und Zusammenhänge und das Vorgehen innerhalb des AI-MC²-Grids. Taras Holoyad, Thomas Schmid, Wolfgang Hildesheim (Hrsg.): Künstliche Intelligenz managen und verstehen: Der Praxis-Wegweiser für Entscheidungsträger, Entwickler und Regulierer. Beuth 2023, 29,90 Euro