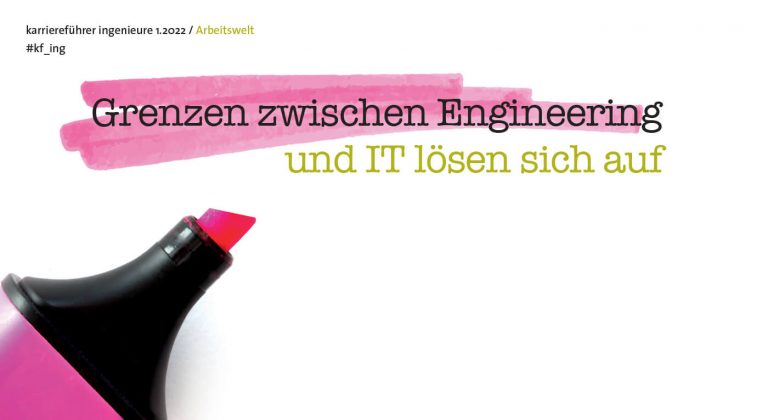Technische Unternehmen sind in einer Weltwirtschaft tätig, die von Unsicherheiten und Komplexität geprägt wird. An knappen Rohstoffen und überlasteten Lieferketten zeigt sich: Die Netzwerkökonomie stößt an ihre Grenzen. Ingenieur*innen stehen zusammen mit dem Management vor der Aufgabe, eine nachhaltige Vernetzung zu gestalten – die auch beinhaltet, auf regionale Verbindungen zu setzen oder sich sogar gezielt zu entnetzen.
Wer zuletzt eine neue Schallplatte kaufen, einen Fußboden verlegen und ein Auto kaufen wollte, musste gleich dreimal ungewöhnlich lange Wartezeiten einkalkulieren. Der Grund: eine außergewöhnliche Knappheit an Kunststoffgranulat, ein Basis-Werkstoff, der für Vinyl-Platten und Vinyl-Fußböden genauso benötigt wird wie für die Produktion einiger Kunststoffteile im Auto. Ähnliche Materialknappheiten gibt es bereits seit einigen Monaten bei digitalen Elementen wie Chips und Halbleitern, aber auch bei Rohstoffen wie Papier und Pappe, die benötigt werden, um technische Produkte verpacken zu können. Denn was nützt die schönste technische Innovation, wenn man sie nicht genügend geschützt in die Logistik bringen kann?
Die Auftragsbücher sind voll. Der Materialmangel erlaubt es den Unternehmen aber nicht, ihre Produktion entsprechend hochzufahren.
Ende 2021 hatte der Materialmangel in der deutschen Industrie seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht: „81,9 Prozent der Firmen klagten über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Das ist ein neuer Rekordwert“, hieß es zum Jahreswechsel in einer Pressemeldung zu einer Umfrage des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo). „Die Situation in der Industrie ist paradox“, wird Klaus Wohlrabe, der für das ifo die Umfragen verantwortet, in dieser Nachricht zitiert. „Die Auftragsbücher sind voll. Der Materialmangel erlaubt es den Unternehmen aber nicht, ihre Produktion entsprechend hochzufahren.“
Materialmangel bestimmt Produktion
Zwar vermeldete das ifo zu Beginn des neuen Jahres eine gewisse Entspannung, doch gerade in den technischen Unternehmen war die Knappheit auch im Frühjahr 2022 noch eklatant: Bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen klagten laut ifo-Meldung von Ende Januar 89,6 Prozent der befragten Unternehmen über Materialmangel, im Maschinenbau waren es 80,6 Prozent der Unternehmen, die von Problemen berichteten, in der Autoindustrie 77,9 Prozent. Die Folge des Mangels sei ein Auftragsstau in den Unternehmen, berichtet das ifo: Die deutsche Industrie könnte mit den aktuellen Auftragsbeständen so lange produzieren wie nie zuvor. Die Aufträge reichten laut der Umfrage für viereinhalb Monate „Das gab es noch nie, seit wir diese Frage im Jahr 1969 zum ersten Mal gestellt haben“, wird Timo Wollmershäuser, Leiter der ifo Konjunkturprognosen, in der Pressemeldung zitiert. Die Auftragseingänge der vergangenen Monate hätten die Unternehmen nicht wie gewohnt abarbeiten können, weil ihnen wichtige Vorprodukte und Rohstoffe gefehlt haben. „Sollten sich die Engpässe in den kommenden Monaten auflösen, könnte die Produktion in der deutschen Industrie durchstarten“, so Wollmershäuser.
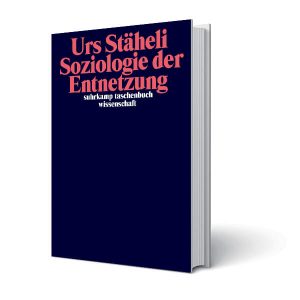 „Soziologie der Entnetzung“
„Soziologie der Entnetzung“
Im privaten Leben wird erkennbar, wie sehr das Dogma der ständigen Erreichbarkeit Energie kostet und wie gut es tut, die digitale Vernetzung zumindest zeitweise zu kappen. Aber auch in den Unternehmen sowie in der Weltgesellschaft zeigen sich die Grenzen der Netzwerkgesellschaft: Wird die Konnektivität zum Selbstzweck, werden Verbindungen oberflächlich. Und nimmt man funktionierende Vernetzungen als selbstverständlich, erlebt man in der globalisierten Welt böse Überraschungen. Ausgehend von solchen Krisendiagnosen denkt der Soziologieprofessor Urs Stäheli von der Uni Hamburg in seinem Buch über die Grenzen der Vernetzung nach. Urs Stäheli: Soziologie der Entnetzung. Suhrkamp 2021. 28 Euro
Was aber, wenn die Knappheit – trotz gegenteiliger Prognosen – mal mehr, mal weniger dramatisch bestehen bleibt? Wenn der Mangel an Rohstoffen und Vorprodukten chronisch wird? Dass es so kommen könnte, ist in der von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägten Welt (abgekürzt VUKA) der Gegenwart nicht ausgeschlossen. Klar, der zentrale Auslöser für die gravierenden Probleme der globalen Lieferkette war das pandemische Corona-Virus. Es sorgte dafür, dass die globale Nachfrage nach Energie oder Indus trieprodukten im Jahr 2020 dramatisch zurückging und zeitgleich digitale Branchen wie Streaming- und Meeting- Dienste oder auch der Online-Handel explodierten – wobei letzterer Trend die Papierknappheit verschärfte (siehe Kasten oben). Hinzu kamen extreme Vorsichtsmaßnahmen im wichtigen Exportland China, wo immer wieder von heute auf morgen Häfen unter strikte Lockdowns gestellt wurden. Containerschiffe konnten über Tage nicht abgewickelt werden.
Unsicherheiten im globalen Netzwerk
Jedoch ist und war Covid-19 längst nicht das einzige Problem. Die Weltwirtschaft bekam zuletzt die Querlage eines Tankers im Suezkanal genau so zu spüren wie Handelskonflikte und den Protektionismus einiger Staaten – der Brexit ist hier das prominenteste Beispiel. Und selbst falls Corona tatsächlich zu einem endemischen Problem wird, mit dessen Folgen die Wirtschaft genauso wie die Gesellschaft zu leben lernt, türmt sich am Horizont bereits das nächste Mega-Problem auf: Die Regularien im Kampf gegen die Klimakrise werden dafür sorgen, dass die Organisation der Weltwirtschaft auf weitere harte Proben gestellt und strukturelle Veränderungen erfahren wird. Schon heute ist abzusehen, dass zum Beispiel Maßnahmen gegen den enorm großen CO2-Fußabdruck der Containerschifffahrt die weltweite Logistik unter Druck setzen werden.
Klar ist, dass die digitale Konnektivität in der Pandemie deutlich an Dynamik gewonnen hat. Erkennbar ist das an der veränderten Arbeit in den Unternehmen mit Video-Calls statt persönlicher Meetings, mit deutlich weniger Dienstreisen, dafür intensivem Homeoffice und einem größeren Stellenwert von Plattformen und virtuellen Teams. Die Trendforscher*innen vom Zukunftsinstitut bezeichnen in ihrer Definition der „Megatrends 2022“ das Internet sogar als das „Betriebssystem“ der gegenwärtigen Gesellschaft, also als „führendes Kommunikationsmedium für eine stetig steigende Zahl von Menschen und Maschinen – und ein elementares Werkzeug für Industrien, Organisationen und Individuen“. So entstehe eine „Netzwerkökonomie“, die dafür sorge, dass sich die Position der Unternehmen verändere: „Unter vernetzten Vorzeichen können sich Unternehmen nicht mehr als isolierte Einheiten verstehen, sondern nur noch als Knotenpunkte innerhalb größerer Netzwerke, als veränderbare Teile größerer Business Ecosystems.“
Die Trendforscher*innen legen den Unternehmen nahe, sich in diesem Umfeld nicht weiter als selbstreferenzielle Einzelkämpfer zu betrachten, sondern nach Partnerschaften zu suchen: „Immer wichtiger wird die Kompetenzvernetzung mit anderen Unternehmen sowie mit externen Expertinnen und Experten. Es gilt, die interne und externe Anschlussfähigkeit zu erhöhen, die Schnittstellen zur Umwelt zu vervielfältigen und Beziehungen zu pflegen.“ Ist also die ständige Weitervernetzung von technischen Unternehmen und den dort tätigen Ingenieur*innen das Allheilmittel, um der Komplexität der Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden? Nach dem Motto: viel hilft viel?
Durch die Erfahrungen der Pandemie und andere Krisen ist an die Stelle einer ,Netzwerkeuphorie‘ eine ,Ernüchterungsphase‘ getreten.
Nachhaltige Netzwerkkontakte
Die oben beschriebenen Netzwerkprobleme der Welt im Zuge wackeliger und stockender Lieferketten bieten ein Gegenargument aus der Praxis: Vernetzung stößt spätestens dann an ihre Grenzen, wenn sie nicht nur digital existiert, sondern echte Produkte ins Spiel kommen, die gefertigt, transportiert und zusammengebaut werden müssen. Und diese realen, analogen Produkte werden auch in der digitalen Zukunft eine zentrale Rolle spielen, schließlich müssen auch autonome durchdigitalisierte Autos, 3D-Drucker und Roboter gebaut werden. Selbst der Quantencomputer, der in der Lage sein könnte, die Digitalisierung auf ein neues Level zu heben, ist eine Konstruktion auf Basis von Materialien. Es ist daher ein sinnvoller Ansatz, bei der Entwicklung, Herstellung und Anwendung von Technik auf eine smarte Vernetzung zu setzen. Eine kluge Konnektivität mit Weitsicht – die zum Beispiel zur Entscheidung führt, dass der Halbleiterhersteller aus der Region trotz höherer Preise der nachhaltigere Netzwerkkontakt ist als der günstige Lieferant aus Übersee.
Problem bei der Wellpappe
Der vermeinte Toilettenpapiermangel zu Beginn der Pandemie hat sich zu einem Running Gag entwickelt. Die Knappheit an Papier und Pappe dagegen ist auch zwei Jahre nach dem Auftauchen des Corona-Virus noch aktuell. Für produzierende Unternehmen besonders problematisch sind der stockende Nachschub und die hohen Preise von Wellpappe, einem Material, dessen Wert häufig erst dann auffällt, wenn es knapp wird. Eine so noch nie erlebte Kostenexplosion auf der Rohstoffseite bringe die ganze Branche der Wellpappen-Industrie in Bedrängnis, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes der Wellpappenindustrie VDW. „Der für unsere Industrie besonders wichtige Preis für altpapierbasiertes Wellpappenrohpapier ist von September 2020 bis Oktober 2021 um 62,3 Prozent in die Höhe geklettert“, wird der VDW-Geschäftsführer Dr. Oliver Wolfrum zitiert. Bei bestimmten für die Industrie relevanten Papiersorten zeige die Kurve noch steiler nach oben, meldet der Verband: So habe sich etwa Wellenstoff den Daten von EUWID (Europäischer Wirtschaftsdienst GmbH) zufolge von September 2020 bis November 2021 um 83,3 Prozent verteuert.
Die Trendforscherin Nina Pfuderer geht in einem Aufsatz für den „Zukunftsreport 2022“ des Zukunftsinstituts so weit, die Suche nach „Strategien und Taktiken“ vorzuschlagen, „die eine Entnetzung innerhalb der Vernetzung ermöglichen“. Kann das für technische Unternehmen gelingen, in denen Ingenieur*innen an Innovationen und Zukunftstechniken arbeiten, auf Basis neuester digitaler Technologien wie der künstlichen Intelligenz? Ist in dieser Netzwerkwelt eine Entnetzung überhaupt noch möglich? Und wenn ja: Warum ist sie sinnvoll?
Idee der Entnetzung
Nina Pfuderer stellt zu Beginn ihrer Analyse unter dem Titel „Die große Entnetzung“ fest, dass durch die Erfahrungen der Pandemie und andere Krisen an die Stelle einer „Netzwerkeuphorie“ eine „Ernüchterungsphase“ getreten sei: „Immer klarer äußern sich die Schattenseiten der Hypervernetzung“, schreibt sie. Das erlebe man bei Themen wie Hatespeech und Verschwörungserzählungen in den sozialen Netzwerken, aber eben auch bei überlasteten ökonomischen Infrastrukturen, die zum Sicherheitsrisiko werden. Die Trendforscherin schlägt vor, die Frage zuzulassen, welche Vernetzung wirklich sinnvoll sei und welche ein reiner Selbstzweck oder nur kurzfristig gewinnbringend. Als Beispiel nennt Nina Pfuderer eine Entwicklung im Bereich der neuen Arbeitskultur, zusammengefasst unter dem Begriff New Work: „Bei der Gestaltung von Büroräumen ist ein Mindshift zu beobachten, weg vom Primat des Open Office, das einstmals den Inbegriff der neuen, vernetzten Arbeitswelt darstellte“, schreibt sie. Studien zufolge führten offene Büros eben nicht unbedingt zu mehr Austausch, sondern im Gegenteil dazu, dass die Zahl persönlicher Begegnungen um etwa 70 Prozent sinke, Menschen Blickkontakte vermieden oder sich mit Kopfhörern abschirmten. „Inzwischen“, schreibt die Autorin, „werden Open Offices wieder rückgebaut, um Arbeitsplätze zu schaffen, an denen Mitarbeitende ungestört arbeiten können.“
Open Offices werden wieder rückgebaut, um Arbeitsplätze zu schaffen, an denen Mitarbeitende ungestört arbeiten können.
Der entscheidende Schritt in Richtung einer klugen Konnektivität bestehe laut Nina Pfuderer darin, „Netzwerke auf ihre Sinnhaftigkeit hin zu überprüfen: Wo ist Austausch qualitativ wertvoll, wo ist Vernetzung zum Selbstzweck geworden?“. Dieses produktive Nachdenken über Entnetzung rücke unweigerlich die Frage nach der Qualität der Infrastrukturen und Netzwerke in den Mittelpunkt. „Damit hilft es, den Megatrend Konnektivität auf eine neue, reflektiertere Stufe zu heben. Und letztlich auch: die Netzwerkgesellschaft vor dem Kollabieren zu bewahren – denn Netzwerke haben per se einen exzessiven Charakter.“ Wie das konkret aussehen kann, zeigen die Reaktionen technischer Unternehmen auf die Materialknappheit: In einer Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zeigte sich, dass die Unternehmen kreative Wege fänden, der Knappheit zu begegnen. „Hierzu zählen neben einer verstärkten Eigenerzeugung oder der Nutzung alternativer Rohstoffe auch die Verwendung von Recyclaten sowie eine Veränderung der Produktzusammensetzung“, heißt es in der Meldung. Pragmatismus, Flexibilität, Regionalität und Kreislaufwirtschaft – gute Ansätze, der überlasteten Vernetzung zu begegnen.
EU-Chip-Gesetz: Abhängigkeiten verhindern
Im Februar 2022 hat die EU-Kommission mit dem europäischen Chip-Gesetz ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, um die Versorgung der EU im Bereich Halbleitertechnologien zu sichern. „Die aktuelle weltweite Halbleiterknappheit hat in einer Vielzahl von Sektoren, von der Automobilbranche bis zu medizinischen Geräten, dazu geführt, dass Fabriken schließen mussten“, heißt es in der Pressemeldung zur Initiative. So sei im Jahr 2021 in einigen Mitgliedstaaten die Produktion im Automobilsektor um ein Drittel zurückgegangen, weil das Material gefehlt habe. „Dadurch wurde die extreme globale Abhängigkeit der Halbleiter-Wertschöpfungskette von einer sehr begrenzten Zahl von Akteuren in einem komplexen geopolitischen Umfeld verdeutlicht.“ Das Chip-Gesetz der EU soll nun ein Halbleiter-Ökosystem von der Forschung bis zur Produktion und eine resiliente Lieferkette schaffen, mit dem Ziel, in Zukunft Unterbrechungen der Lieferketten zu verhindern oder zumindest rasch darauf zu reagieren.
EU-Chip-Gesetz: Abhängigkeiten verhindern
Im Februar 2022 hat die EU-Kommission mit dem europäischen Chip-Gesetz ein Maßnahmenpaket vorgeschlagen, um die Versorgung der EU im Bereich Halbleitertechnologien zu sichern. „Die aktuelle weltweite Halbleiterknappheit hat in einer Vielzahl von Sektoren, von der Automobilbranche bis zu medizinischen Geräten, dazu geführt, dass Fabriken schließen mussten“, heißt es in der Pressemeldung zur Initiative. So sei im Jahr 2021 in einigen Mitgliedstaaten die Produktion im Automobilsektor um ein Drittel zurückgegangen, weil das Material gefehlt habe. „Dadurch wurde die extreme globale Abhängigkeit der Halbleiter-Wertschöpfungskette von einer sehr begrenzten Zahl von Akteuren in einem komplexen geopolitischen Umfeld verdeutlicht.“ Das Chip-Gesetz der EU soll nun ein Halbleiter-Ökosystem von der Forschung bis zur Produktion und eine resiliente Lieferkette schaffen, mit dem Ziel, in Zukunft Unterbrechungen der Lieferketten zu verhindern oder zumindest rasch darauf zu reagieren.
Doris Märtin: Exzellenz. Wissen Sie eigentlich, was in Ihnen steckt? Campus 2021. 24,95 Euro







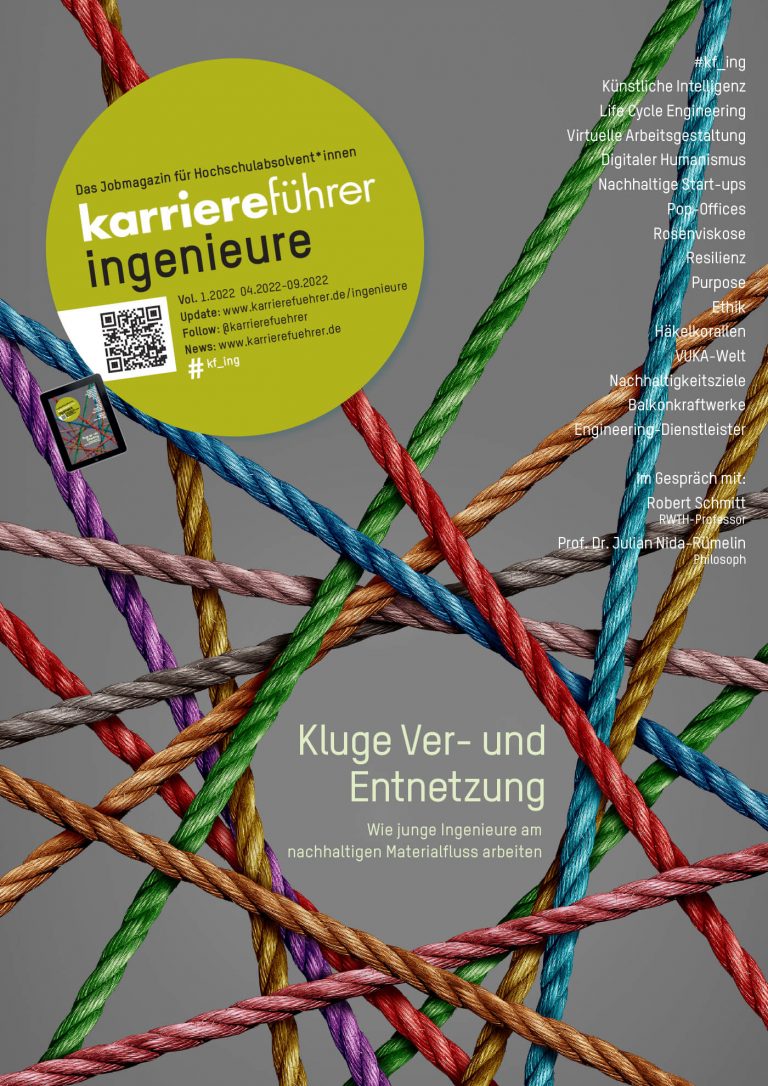


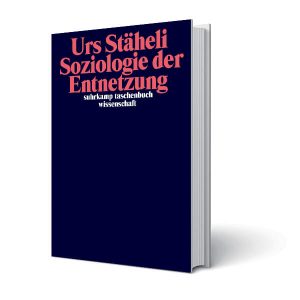 „Soziologie der Entnetzung“
„Soziologie der Entnetzung“