Zwei Beobachtungen prägen das Thema Frauen und Führung: Zum einen erkennen Trendforscher*innen einen „Gender Shift“, der Rollenzuweisungen auflöst und das Individuum in den Fokus stellt. Andererseits identifizieren Studien eine kommende Generation von „Jungbullen“, deren Narzissmus die Entwicklung von Unternehmen zu blockieren droht. Die Lösung: eine reflektierte, teamorientierte Führungskultur. Ganz selbstverständlich mit Frauen als Garantinnen für Good Leadership. Ein Essay von André Boße
Trends kommen und gehen. Megatrends hingegen sind gekommen, um zu bleiben. So sehen das die Trendforscher* innen vom Zukunftsinstitut, einem Think-Tank, der die Wirtschaft und Gesellschaft nach Entwicklungen untersucht, die bereits heute absehbar sind und die Zukunft mitbestimmen. Megatrends ließen sich als „Lawinen in Zeitlupe“ beschreiben, heißt es auf der Homepage des von Matthias Horx gegründeten Zukunftsinstituts, denn sie entwickelten sich zwar langsam, seien aber enorm mächtig: „Sie wirken auf alle Ebenen der Gesellschaft und beeinflussen so Unternehmen, Institutionen und Individuen.“
Megatrend Gender Shift
Zwölf solcher Megatrends haben die Zukunftsforscher*innen für ihren „Trendausblick 2022“ definiert, der im Frühjahr veröffentlicht wurde. Einige von ihnen werden seit einigen Jahren konstant genannt: Globalisierung und Urbanisierung, New Work und Mobilität, Individualisierung und Konnektivität. Hinzu kommen Megatrends, die auf jüngste Entwicklungen reagieren: Sicherheit, Gesundheit oder Neo-Ökologie. Dazu kommt einer, der einen interessanten Namen trägt: Gender Shift. Klar, das Thema ist offensichtlich, aber die meisten Leser*innen des „Trendausblicks 2022“ hätten eher mit einer Bezeichnung wie „Diversity“ gerechnet. Was also hat es mit dem Gender Shift auf sich?
Wirtschaft und Gesellschaft entwickelten sich hin zu einer neuen Kultur des Pluralismus.
„Der Megatrend Gender Shift beschreibt sich zunehmend verändernde Rollenmuster und aufbrechende Geschlechterstereotype“, definieren die Trendforscher*innen. Wirtschaft und Gesellschaft entwickelten sich hin zu einer neuen Kultur des Pluralismus: „Die tradierten sozialen Rollen, die Männern und Frauen zugeschrieben werden, verlieren ebenso an gesellschaftlicher Verbindlichkeit wie das Geschlecht seine schicksalhafte Bedeutung: Es bestimmt immer weniger über den künftigen Verlauf individueller Biografien.“ Wichtig ist den Trendforscher*innen dabei die dynamische Dimension des Shift-Begriffs: Es sei offensichtlich, dass hier etwas in Bewegung sei. Genauso offensichtlich sei, dass es dabei zu Rückschlägen komme, weil die Polarisierungen zwischen einer „längst etablierten Gleichbehandlung und orthodoxen Traditionalisten und Traditionalistinnen ihren Höhepunkt erreichen“. Kurz: Die Bewegung ist nicht linear progressiv, Backlashes sind ein Teil der Dynamik.
Jetzt wird’s persönlich
Die Sache ist also ambivalent. Und: Sie ist im Fluss. Der Megatrend Gender Shift verweise auf eine „ständig neu verhandelte Freiheit von festgeschriebenen Geschlechterrollen“, schreiben die Zukunftsforscher*innen. „Immer häufiger werden diese Rollen durchbrochen, die Möglichkeiten der Gestaltung der eigenen Identität vervielfältigen sich.“ Hier findet sich also der Begriff der Vielfalt – jedoch nicht bezogen auf die Besetzung eines Teams, sondern auf die individuelle Identität. „Geschlecht und Identität waren lange Zeit eng verknüpft“, heißt es im Trendreport, heute jedoch verändere sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Geschlecht, was sich bereits in Bereichen wie Marketing oder auch Recruiting zeige: „Angebote und Kommunikation sind gezwungen, sich anzupassen, wenn Menschen sich nicht mehr automatisch über ihr Geschlecht identifizieren.“
Wie auf Narzissten reagieren?
In ihrem Artikel „Die Jungbullen kommen“ für das Magazin Harvard Business Manager geben die Autor*innen der Studie Ratschläge an alle Frauen, die es im Unternehmen mit (laut Untersuchung zumeist männlichen) Narzissten zu tun haben: „Nehmen Sie das Verhalten des Narzissten nicht persönlich. Besonders Frauen neigen schnell dazu, den Fehler bei sich selbst zu suchen und das Verhalten eines Narzissten auf sich persönlich zu beziehen. Hier gilt es, Abstand zu nehmen und sich bewusst von diesem Verhalten abzugrenzen. Machen Sie sich klar, dass der Narzisst Minderwertigkeitsgefühle hat, mit denen er nicht umgehen kann. Dadurch disqualifiziert er sich letztendlich selbst.“
Kompliziert wird das Thema, weil diese Entwicklung nicht dazu führt, dass das Thema Gender damit an Bedeutung verliert. Im Gegenteil: Es bleibt zentral, wird aber persönlich. „Gender Awareness wird damit zum obersten Gebot“, heißt es im „Trendausblick 2022“: „Gender Blind Spots und Gender Biases werden unter dem Druck der Gesellschaft immer weiter aufgedeckt werden.“ Dabei biete der Einsatz von Technologien wie der Künstlichen Intelligenz und Big Data das Potenzial, Vorurteile zu revidieren. Je nach Bereich und Branche werde daher eine „erhöhte Gender-Sensibilität dauerhaft oder mindestens zur Gestaltung eines Übergangs hin zu geschlechtergerechten und -übergreifenden Ansätzen notwendig werden“.
Narzissten in der Führung
Erledigt sich die Problematik also spätestens dann, wenn die alte, männerdominierte Führungsgeneration Platz für eine neue Generation macht, die mit Gender-Sensibilität aufgewachsen ist? Klingt logisch, jedoch verdichten sich die Anzeichen, dass es sich bei der Gender-Problematik in Unternehmen um kein Thema handelt, das sich mit dem Eintritt einer neuen Generation in die Führungsebenen auflösen wird. Im Gegenteil.
Gender Blind Spots und Gender Biases werden unter dem Druck der Gesellschaft immer weiter aufgedeckt werden.
Mitte 2021 sorgte eine Studie zum Thema Narzissmus in Unternehmen für Aufmerksamkeit. Ein Forscher*innen-Team befragte dafür fast 10.000 Personen, darunter mehr als 2500 Führungskräfte. Das Ziel: herauszufinden, wie ausgeprägt narzisstische Eigenschaften sind. Vorgestellt wurde die Studie im Harvard Business Manager-Magazin. „Narzissten handeln rücksichtslos, verfolgen ihre eigenen Ziele, sind manipulativ und gefährden das Unternehmen“, definieren die Autor*innen. Das Ergebnis ihrer Untersuchung fassen sie in wenigen Sätzen zusammen: „Narzissmus ist in Führungsetagen weit verbreitet, viel weiter als in der Gesamtbevölkerung.“ Diese Tendenz habe mit Entwicklungen wie New Work oder anderen modernen Managementmethoden keineswegs abgenommen.
Achtung, Jungbullen!
Die Studienautor*innen stellen zudem fest, dass es die Egomanen in Unternehmen häufig leicht haben, nach oben zu kommen: „Viele Unternehmen dulden Narzissten und belohnen narzisstische Verhaltensweisen. Sie vermitteln weiterhin falsche Ideale und schaffen damit ein toxisches Arbeitsklima – mit verheerenden Folgen.“ Als „besonders erschreckend“ bezeichnen sie dabei die Erkenntnis, dass der Narzissmus in der jüngeren Generation enorm zunehme: „Junge Menschen weisen die höchsten narzisstischen Werte aller Altersgruppen auf, höher als die Generationen vor ihnen.“ Die Autor*innen verweisen dabei auf eine Titelgeschichte des „Time Magazine“, das bereits vor fast zehn Jahren von der „Me Me Me Generation“ der Millennials geschrieben habe, „auch bekannt als Generation Selfie“.
Ein weiteres Ergebnis der Studie: Männer weisen laut der Studie „in allen Altersgruppen im Durchschnitt signifikant höhere Narzissmuswerte auf als Frauen“. Weshalb die Autor*innen von einem „Jungbullenphänomen“ schreiben. Dieses verschärfe sich vor allem dort, wo Macht gebündelt werde. Zum Beispiel in Führungspositionen. So stiegen in der Studie die ermittelten Narzissmuswerte im Gleichschritt der Karrieren – „die Daten bestätigen die bereits mehrfach nachgewiesene Tatsache, dass Narzissmus in Führungsetagen signifikant häufiger anzutreffen ist als in der allgemeinen Bevölkerung“, heißt es im Text zur Studie im Harvard Business Manager-Magazin. Der Grund: Je höher Manager aufstiegen, desto weniger ehrliches Feedback erhalten sie. „Wenn die Führungskollegen ebenfalls zu narzisstischem Verhalten neigen – was unsere Daten nahelegen –, gibt es kein Korrektiv. Im Gegenteil: Die anderen Narzissten im Team inspirieren Manager, ihr ungesundes Verhalten beizubehalten oder zu verstärken.“ Die Folge sei ein kollektiver Narzissmus auf Führungsebene, gepaart mit einem Überlegenheitsgefühl als Gruppe.
Gender-Gerechtigkeit als Lösung
Ein solches Verhalten habe nicht nur toxische Auswirkungen auf die Unternehmens- und Arbeitskultur, sondern richte auch wirtschaftlichen Schaden an: Weltweit betrage der Verlust, den Unternehmen 2019 aufgrund betrügerischer Aktivitäten hinzunehmen hatten, 42 Milliarden US-Dollar, schreiben die Studienautor*innen. „Diese Schäden gehen zwar nicht ausschließlich auf narzisstische Führungskräfte zurück, doch spielen diese eine gewichtige Rolle.“ Die Lösung: Wenn solche homogenen Gruppen Narzissmus begünstigen, dann wird dieser von vielfältigen Teams gebremst. Die Studienautor* innen nennen fünf Maßnahmen gegen eine Führungskultur der Jungbullen. Sie lauten: „Keine Egomanen einstellen“, „gute Führungsvorbilder finden“, „regelmäßig Feedback einsetzen“, „ein neues Umfeld schaffen“ – sowie: „Frauen als Teil der Lösung begreifen“, denn: „Die zunehmende Beförderung von Frauen kann den ausgeprägten Narzissmus in Führungsetagen zumindest graduell verringern.“
Ist KI frauenfeindlich?
Die Künstliche Intelligenz mag grammatikalisch weiblich sein, ihre Kreatoren sind es nicht: Die IT-Branche wird von Männern dominiert, das Karrierenetzwerk Linkedin zeigte anhand einer Marktanalyse 2021, dass in Deutschland lediglich 21 Prozent aller KI-Talente weiblich sind. Da es Menschen sind, die KI-Systeme entwickeln, bringen sie in diese Technik auch ihre Vorstellungen, Perspektiven und Stereotype ein. „Algorithmen sind nichts Objektives, sondern quasi in Code eingebettete Meinungen und Vorurteile“, schreiben Larissa Ginzinger von der Landesbank Baden-Württemberg und Senior Economist Guido Zimmermann in ihrem Studienpapier „Ist KI frauenfeindlich?“. Wichtig sei es daher, eine größere Diversity bei Entwicklerinnen und Entwicklern zu etablieren: „Bei der Bekämpfung algorithmischer Diskriminierung lautet Vielfalt das Gebot der Stunde.“
Was sich im Spannungsfeld zwischen Gender Shift und Jungbullen zeigt: Das Thema Frauen in Führungspositionen erreicht neue Dimensionen. Es geht noch immer um Gender- Gerechtigkeit – und doch auch darüber hinaus. Der Gender- Shift bricht Stereotype und Rollen auf. Im Zentrum steht die Person, nicht die Zuschreibung. Als Gefahr droht dabei ein narzisstischer Backlash: Laut Studie werde er dann eintreten, wenn die narzisstischen Merkmale der jungen (und zumeist männlichen) Generation ungebremst sowie unreflektiert die Führungsebenen dominieren.
Die Lösung für Unternehmen kann nur eine Diversity-Normalität mit starker Feedbackkultur sein. Leadership ist kein Selbstzweck. Leadership dient Teams, in denen verschiedenste Individuen gemeinsame Sache machen. In diesem Spannungsfeld gewinnen daher diejenigen Unternehmen, die diesem Teamwork einen nachvollziehbaren Purpose geben, der über bestimmte Rollen hinaus geht. Und es gewinnen (weibliche wie männliche) Führungskräfte, die diesen Purpose mit unternehmerischem Erfolg verbinden. Was wiederum nur funktioniert, wenn man das Team fördert – und nicht das eigene Ego. Und weil diese Kompetenz bei jungen Frauen im Schnitt nach aktueller Datenlage ausgeprägter zu scheint, heißt die Devise: Frauen in Führungspositionen zu bringen, bleibt die beste Strategie, um den Shift zu gestalten und Jungbullen-Blockaden zu umgehen.
Gender-Gerechtigkeits-Zertifikat
Für Unternehmen wird es immer wichtiger, ihre Aktivitäten in allen Bereichen der sozialen Verantwortung und Nachhaltigkeit offenzulegen. Diese Transparenz ist zum Beispiel zentral für das Thema Recruiting, aber auch für die Attraktivität für Investoren. Das Beratungsunternehmen Edge Strategy bietet eine neuartige Dienstleistung: Es zertifiziert Unternehmen im Hinblick auf die gegebene Chancengleichheit der Geschlechter. Dabei geht es den Consultants nicht nur darum, den Status Quo festzustellen, sondern auch eine Roadmap zu entwickeln, um die Gender-Gerechtigkeit noch zu erhöhen. Die Liste der bereits zertifizierten internationalen Unternehmen findet sich im Internet. www.edge-cert.org











 Der Text zu Mamie Phipps Clark ist (gekürzt) übernommen aus einem Buch von Anna Reser & Leila McNeill: Frauen, die die Wissenschaft ver änderten. Der umfangreiche, schön illustrierte Band erzählt die Emanzipations- und Gleichstellungs geschichte von Frauen in der Wissenschaft – von der Antike bis zur Gegenwart. Anna Reser & Leila McNeill: Frauen, die die Wissenschaft veränderten. Haupt 2022. 36 Euro.
Der Text zu Mamie Phipps Clark ist (gekürzt) übernommen aus einem Buch von Anna Reser & Leila McNeill: Frauen, die die Wissenschaft ver änderten. Der umfangreiche, schön illustrierte Band erzählt die Emanzipations- und Gleichstellungs geschichte von Frauen in der Wissenschaft – von der Antike bis zur Gegenwart. Anna Reser & Leila McNeill: Frauen, die die Wissenschaft veränderten. Haupt 2022. 36 Euro. In 20 Porträts skizziert der Autor besonders beeindruckende Frauenfiguren der Geschichte, die in ihrer Epoche von traditionellen Wegen abwichen und ihren eigenen gegangen sind. Michael Korth: Wir sind die Veränderung. 20 Porträts starker Frauen. Patmos 2022. 20 Euro.
In 20 Porträts skizziert der Autor besonders beeindruckende Frauenfiguren der Geschichte, die in ihrer Epoche von traditionellen Wegen abwichen und ihren eigenen gegangen sind. Michael Korth: Wir sind die Veränderung. 20 Porträts starker Frauen. Patmos 2022. 20 Euro.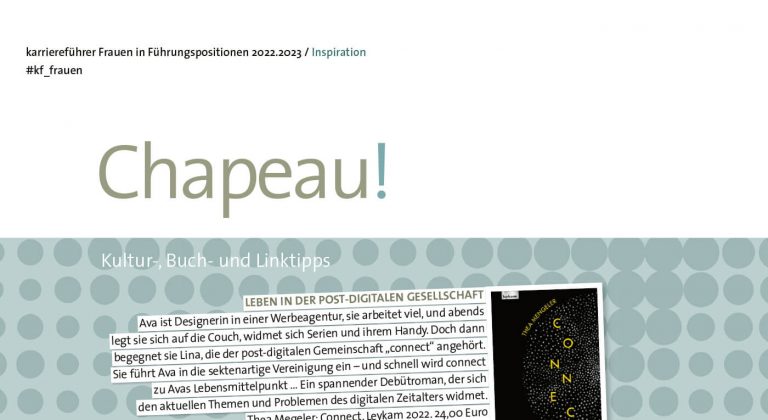
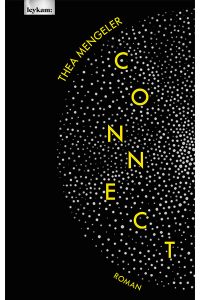 Ava ist Designerin in einer Werbeagentur, sie arbeitet viel, und abends legt sie sich auf die Couch, widmet sich Serien und ihrem Handy. Doch dann begegnet sie Lina, die der post-digitalen Gemeinschaft „connect“ angehört. Sie führt Ava in die sektenartige Vereinigung ein – und schnell wird connect zu Avas Lebensmittelpunkt … Ein spannender Debütroman, der sich den aktuellen Themen und Problemen des digitalen Zeitalters widmet. Thea Megeler: Connect. Leykam 2022. 24,00 Euro
Ava ist Designerin in einer Werbeagentur, sie arbeitet viel, und abends legt sie sich auf die Couch, widmet sich Serien und ihrem Handy. Doch dann begegnet sie Lina, die der post-digitalen Gemeinschaft „connect“ angehört. Sie führt Ava in die sektenartige Vereinigung ein – und schnell wird connect zu Avas Lebensmittelpunkt … Ein spannender Debütroman, der sich den aktuellen Themen und Problemen des digitalen Zeitalters widmet. Thea Megeler: Connect. Leykam 2022. 24,00 Euro
 Hamburg, im Jahr 1910: Die Ärztin Anne Fitzpatrick kämpft gegen alle Widerstände für die Rechte von Frauen. Gemeinsam mit der mutigen und engagierten Pastorentochter Helene arbeitet sie im Frauenhaus, hilft Frauen, die unterdrückt wurden und Gewalt erfahren haben. Doch dann tauchen im benachbarten Hafenbecken die Leichen zweier Frauen auf – die Opfer hatten, genau wie die Hafenärztin, Kontakt zur Frauenbewegung. Auch Anne gerät in Gefahr… Der historische Roman ist Auftakt einer großen Saga – Band zwei soll schon im Juni erscheinen. Henrike Engel: Die Hafenärztin. Ein Leben für die Freiheit der Frauen. Ullstein 2022, 14,99 Euro
Hamburg, im Jahr 1910: Die Ärztin Anne Fitzpatrick kämpft gegen alle Widerstände für die Rechte von Frauen. Gemeinsam mit der mutigen und engagierten Pastorentochter Helene arbeitet sie im Frauenhaus, hilft Frauen, die unterdrückt wurden und Gewalt erfahren haben. Doch dann tauchen im benachbarten Hafenbecken die Leichen zweier Frauen auf – die Opfer hatten, genau wie die Hafenärztin, Kontakt zur Frauenbewegung. Auch Anne gerät in Gefahr… Der historische Roman ist Auftakt einer großen Saga – Band zwei soll schon im Juni erscheinen. Henrike Engel: Die Hafenärztin. Ein Leben für die Freiheit der Frauen. Ullstein 2022, 14,99 Euro Madeleine Becker studiert Geschichte, Politik- und Kommunikationswissenschaften, nebenher arbeitet sie im Café – und wirklich glücklich ist sie nicht. Als sie zum Camping nach Österreich fährt, nimmt ihr Leben die entscheidende Wendung: Sie verliert ihr Herz an einen Bauernhof in Kärnten, an Kühe, Hühner und den großen Gemüsegarten (und später auch an Lukas, den Sohn der Familie). Sie kehrt zurück auf den Hof, erstmal für ein Praktikum, und dann „erstmal für immer“. In ihrem Buch und auf Instagram (@frau_freudig) berichtet sie vom Glück auf der Alm, von Geburten im Kuhstall, Schneechaos auf dem Hof und vielem mehr. Madeleine Becker: Erstmal für immer. Piper 2022. 15,00 Euro
Madeleine Becker studiert Geschichte, Politik- und Kommunikationswissenschaften, nebenher arbeitet sie im Café – und wirklich glücklich ist sie nicht. Als sie zum Camping nach Österreich fährt, nimmt ihr Leben die entscheidende Wendung: Sie verliert ihr Herz an einen Bauernhof in Kärnten, an Kühe, Hühner und den großen Gemüsegarten (und später auch an Lukas, den Sohn der Familie). Sie kehrt zurück auf den Hof, erstmal für ein Praktikum, und dann „erstmal für immer“. In ihrem Buch und auf Instagram (@frau_freudig) berichtet sie vom Glück auf der Alm, von Geburten im Kuhstall, Schneechaos auf dem Hof und vielem mehr. Madeleine Becker: Erstmal für immer. Piper 2022. 15,00 Euro
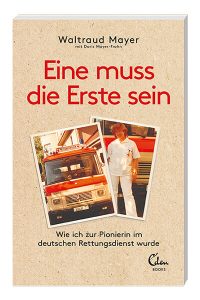 1979 stieg die junge Waltraud Mayer als eine der ersten Frauen in Deutschland in den Rettungsdienst ein. Für sie war das erste Mal am Steuer eines Rettungswagens zwar ein Sprung ins kalte Wasser, doch es fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto. Über dreißig Jahre war sie mit dabei: bei Verkehrsunfällen, häuslichen Unglücken und sogar einem Tötungsdelikt, das später prominent verfilmt wurde. In ihrem Buch gibt sie Einblick in den Alltag im Rettungsdienst und erzählt von den Herausforderungen, die sie gemeistert hat. Waltraud Mayer, Doris Mayer-Frohn: Eine muss die Erste sein. Wie ich zur Pionierin im deutschen Rettungsdienst wurde. Eden 20222. 16,95 Euro
1979 stieg die junge Waltraud Mayer als eine der ersten Frauen in Deutschland in den Rettungsdienst ein. Für sie war das erste Mal am Steuer eines Rettungswagens zwar ein Sprung ins kalte Wasser, doch es fühlte sich an wie ein Sechser im Lotto. Über dreißig Jahre war sie mit dabei: bei Verkehrsunfällen, häuslichen Unglücken und sogar einem Tötungsdelikt, das später prominent verfilmt wurde. In ihrem Buch gibt sie Einblick in den Alltag im Rettungsdienst und erzählt von den Herausforderungen, die sie gemeistert hat. Waltraud Mayer, Doris Mayer-Frohn: Eine muss die Erste sein. Wie ich zur Pionierin im deutschen Rettungsdienst wurde. Eden 20222. 16,95 Euro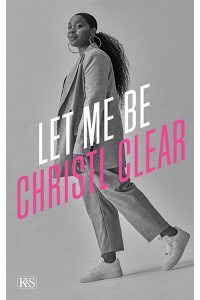 Christl Clear ist Influencerin, lebt in Wien und hat lange mit den Erwartungen gekämpft, die von unterschiedlichen Seiten an sie herangetragen wurden. Heute weiß sie: „Die Erwartungen, die jemand anderer in mich setzt, haben in Wahrheit wenig bis gar nichts mit mir zu tun. Außerdem profitiert gefühlt jeder von diesem anstrengenden Anspruchsdenken außer uns Frauen.“ In kurzen und knackigen Kapiteln zu Themen wie Sex, Freundschaft, Rassismus oder Geld macht sie Mut, das zu tun, was einem selbst gut tut – nicht das, was andere erwarten. Macht Spaß zu Lesen, denn Christl Clear ist witzig, direkt und empowernd. Christl Clear: Let me be Christl Clear. Kremayr & Scheriau 2021. 22 Euro.
Christl Clear ist Influencerin, lebt in Wien und hat lange mit den Erwartungen gekämpft, die von unterschiedlichen Seiten an sie herangetragen wurden. Heute weiß sie: „Die Erwartungen, die jemand anderer in mich setzt, haben in Wahrheit wenig bis gar nichts mit mir zu tun. Außerdem profitiert gefühlt jeder von diesem anstrengenden Anspruchsdenken außer uns Frauen.“ In kurzen und knackigen Kapiteln zu Themen wie Sex, Freundschaft, Rassismus oder Geld macht sie Mut, das zu tun, was einem selbst gut tut – nicht das, was andere erwarten. Macht Spaß zu Lesen, denn Christl Clear ist witzig, direkt und empowernd. Christl Clear: Let me be Christl Clear. Kremayr & Scheriau 2021. 22 Euro.