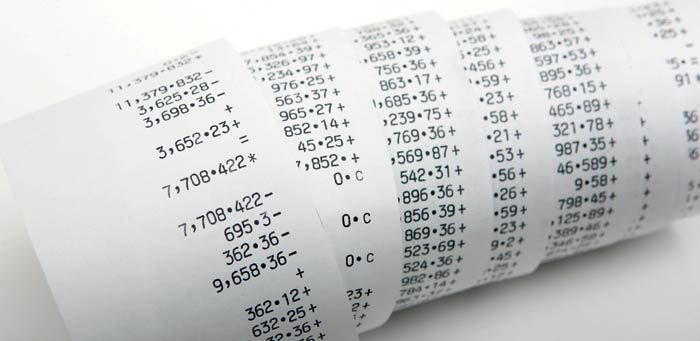Die Möglichkeiten der Industrie 4.0 schenken der Pharma-Branche neue Visionen in der Produktion. So soll es schon bald möglich sein, effizient individuelle Medikamente herzustellen. Für Naturwissenschaftler entstehen damit ganz neue Möglichkeiten. Nötig ist es jedoch, zusammen mit IT-Experten und Ingenieuren schlagkräftige Teams zu bilden. Von André Boße
Jeder Patient ist anders. Jedes gesundheitliche Problem hat eine eigene Geschichte, jeder Körper reagiert unterschiedlich auf ein Präparat. Es wäre daher ein Traum der pharmazeutischen Forschung, wenn jedes Medikament individuell hergestellt werden könnte, jeweils genau abgepasst auf die persönlichen Bedürfnisse eines Patienten. Noch ist das Zukunftsmusik. Die handelsüblichen Tabletten, die man in der Apotheke gegen Rezept erhält oder kauft, sind für jeden gleich. Passgenau auf den Patienten zugeschnittene Präparate sind heute die Ausnahme – und dementsprechend teuer, was damit zu tun hat, dass es umständlich ist, sie zu produzieren. Doch das soll sich ändern. Die Vision: Forscher entwickeln für Patienten individuelle Medikamente und beauftragen die Produktion, diese schnell und effizient herzustellen. Um das hinzubekommen, setzt die Pharma- Industrie verstärkt auf technische Innovationen, die sich unter dem Begriff Industrie 4.0 zusammenfassen lassen.
Im Fokus stehen dabei intelligente Fabriken, in denen die Produktion deutlich flexibler, effizienter und interaktiver Abläuft. Das funktioniert mithilfe sogenannter cyber-physischer Systeme: Elektronische und mechanische Teile werden mit Sensoren sowie IT-Komponenten aufgerüstet, die dann dafür sorgen, dass alle diese Produktionswerkzeuge miteinander über ein „Internet der Dinge“ kommunizieren. Kurz: In der Produktion weiß dann ein Teil, was das andere tut. Und mehr noch: Es kann Befehle ausführen und Parameter verändern. Und das zu jedem Zeitpunkt sowie einzeln bei jedem Medikament. Pharma 4.0 – das ist der Weg zum effizient hergestellten personalisierten Präparat. „Für unsere Branche besitzt Industrie 4.0 daher ein hohes Potenzial“, sagt Steve Hydzik, globaler Head of Manufacturing IT, Architecture & New Technology beim internationalen Pharma-Konzern Merck. „Durch die Digitalisierung werden Produktion und Lieferkette von Anfang bis Ende transparent. Dadurch können wir zu jeder Zeit Entscheidungen analysieren und optimieren. Es wird damit eben auch möglich sein, jedes Produkt anhand des Bedürfnisses eines Kunden zu verändern, um es individuell zu optimieren.“
RFID-Technik gibt die Infos
Funktionieren wird das zum Beispiel mit der RFID-Technik, die man vor allem bei Chipkarten oder aus Bibliotheken kennt: Elektromagnetische Wellen informieren die Produktionsgeräte über die individuelle Zusammensetzung eines Präparats; die Maschinen konfigurieren sich automatisch anhand der erhaltenden Daten, stimmen sich über das „Internet der Dinge“ gegenseitig ab und übernehmen sogar die Qualitätskontrolle. „Es wird dann möglich sein, eine große Menge an personalisierten Pharmaprodukten, die genau den Bedürfnissen des Kunden entsprechen, herzustellen – und zwar mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz“, stellt Steve Hydzik von Merck in Aussicht. Das Szenario beim Besuch eines Arztes ist dann nicht mehr, dass dieser dem Patienten ein Medikament verschreibt. Vielmehr kann der Arzt das Präparat – in Kooperation mit dem Patienten und mit Blick auf dessen Daten – individuell zusammensetzen.
Industrie 4.0: kurze Revolutionsgeschichte
Die Zahl 4 steht für die vierte industrielle Revolution, die durch die Digitalisierung und Vernetzung von Maschinen in einem „Internet der Dinge“ gekennzeichnet ist. Für die erste industrielle Revolution sorgten Ende des 18. Jahrhunderts die ersten mechanischen Produktionsanlagen. Die Einführung der Elektrizität stand für die zweite industrielle Revolution, der Einzug von Elektronik und IT sorgten für die Automatisierung der dritten industriellen Revolution.
Reale und virtuelle Prozesse
Noch ist die Pharma 4.0 ein Szenario der Zukunft. Ein Verfahren, das bereits heute bei ausgewählten pharmazeutischen Produktionen zum Einsatz kommt, nennt sich Process Analytical Technology (PAT) und nimmt bereits einige der Ideen von Industrie 4.0 auf. „Dieser Ansatz wird von der Perspektive der Zulassung aus gedacht“, erklärt Dr. Reinhard Baumfalk von Sartorius, einem der führenden Anbieter von Labor- und Bioprozesstechnologie mit Sitz in Göttingen. Ziel ist es, den Produktionsprozess genauer zu verstehen und bereits während des Prozesses zu interagieren. „Dies gelingt mit einem Modellprozess, um den tatsächlichen Produktionsprozess virtuell und online zu steuern“, so Baumfalk. „Es gibt also eine Wechselwirkung zwischen realem und virtuellem Produktionsprozess – was ja auch ein zentraler Ansatz der Industrie 4.0 ist.“ Damit geht die Pharma- Industrie schon heute einen Schritt weiter als bei den herkömmlichen Strategien: Hier war die Produktion eine Art „Black Box“, bei der man erst nach Ablauf überprüfen konnte, ob das Produkt tatsächlich die Qualitäts- und Zulassungsstandards erfüllt. Stimmte etwas nicht, musste die Produktion zwangsläufig verworfen werden, was Zeit und Geld kostete. „Diese neuen Ansätze helfen, das zu verhindern, weil wir online und in Echtzeit Parameter verändern können “, sagt Baumfalk.
Es steht außer Frage, dass die neuen Möglichkeiten die pharmazeutische Produktion entscheidend verändern werden – und zwar gerade auch für die Naturwissenschaftler, die zusammen mit IT-Experten und Ingenieuren neue Teams bilden. „Wenn wir die Grundsätze der Industrie 4.0 mit den neuen Technologien zum Umgang mit großen Mengen an Daten kombinieren, erhalten Naturwissenschaftler weitergehende und schnellere Einblicke in die pharmazeutischen Prozesse“, sagt Steve Hydzik von Merck. „Wir stehen daher vor einem Zeitalter, in dem Naturwissenschaften und Technik gemeinsam etwas früher Unmögliches möglich machen können.“ Dabei werden seiner Meinung nach zwei Kompetenzen für Naturwissenschaftler besonders wichtig: zukunftsorientierte Analyseverfahren (häufig wird der englische Begriff Advanced Analytics benutzt) sowie Data Science. „Mithilfe der Advanced Analytics wird dafür gesorgt, dass Informationen zur richtigen Zeit und im richtigen Kontext an die richtigen Leute gelangen.“ Hier arbeiten IT-Experten und Naturwissenschaftler sehr eng zusammen: Die einen sorgen für den richtigen Datenfluss, die anderen für die Auswertung. Noch enger gehen beide Disziplinen bei der Data Science zusammen. Hydzik: „In einer bislang nicht möglichen Geschwindigkeit werden Naturwissenschaftler aus Daten neues Wissen generieren.“
Auch bei Sartorius ist mit Blick auf die Produktionsverfahren der Zukunft die Balance aus Ingenieurwissen und dem Know-how der Naturwissenschaftler entscheidend. „Wer sich für die neuen Produktionsprozesse der Pharmaindustrie interessiert, sollte zum Beispiel Kompetenzen in der Sensorik mitbringen, die ihn in die Lage versetzen, die wirklich entscheidenden Parameter zu messen“, sagt Dr. Reinhard Baumfalk. Um die gesammelten Informationen in Relation zu setzen und zu bewerten, sei Know-how im Datenmanagement wichtig.
Rahmenbedingungen schaffen
Eine Besonderheit der Pharmabranche: Veränderungen in der Produktion setzen sich in der Regel langsamer durch als in anderen Branchen. Während besonders die Autoindustrie bereits heute visionäre Bilder der Industrie 4.0 an die Wand wirft, sind viele Experten aus der Pharmabranche deutlich vorsichtiger. „Mit Blick auf die Industrie 4.0 sind stark regulierte Branchen, zu denen natürlich vor allem die pharmazeutische Industrie zählt, naturbedingt etwas langsamer, weil zunächst erst einmal Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit neue Ansätze anwendbar sind“, begründet Dr. Reinhard Baumfalk von Sartorius. Über die Ansätze der Process Analytical Technology (PAT) zum Beispiel werde in der Branche schon lange diskutiert; bis sie erstmals Anwendung gefunden hat, seien mehrere Jahre vergangen.
Wer als Naturwissenschaftler Freude daran hat, die Idee von Pharma 4.0 mitzugestalten, benötigt daher etwas mehr Geduld als der visionäre Kollege in einer anderen Branche. Die Unternehmen erwarten dennoch vom Nachwuchs, dass er schon heute die Kompetenzen von morgen mitbringt. „In der Produktion, aber auch in Forschung und Entwicklung, bewegt sich durch die neuen technischen Möglichkeiten derzeit viel. Es gehört in den naturwissenschaftlichen Disziplinen dazu, dass man sich mit den Chancen der Digitalisierung auseinandersetzt und schaut, wie man dieses Wissen in die Unternehmen einbringen kann“, sagt Mathias Finkele, Personalleiter bei Pfizer Deutschland. Im Zuge dieser Veränderungen gestalten viele pharmazeutische Unternehmen zudem ihre Arbeitsstrukturen neu. „Wir beobachten bereits heute, dass Forschung und Entwicklung bei uns anders organisiert wird“, so Finkele. So kooperiere Pfizer häufig mit externen Partnern, was bei den Naturwissenschaftlern auf beiden Seiten eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, unternehmerisches Handeln, Eigeninitiative sowie die Bereitschaft erfordere, Wissen zu teilen.
Die neue Technik verändert also nicht nur die Art, wie produziert, sondern auch, wie geforscht und entwickelt wird. Damit ist Pharma 4.0 weit mehr als nur ein ingenieur- und IT-getriebenes Thema. Es bestimmt in großem Maße die Arbeit der Naturwissenschaftler und schenkt ihnen eine sehr faszinierende Perspektive: Die Produktion als „Black Box“, das war einmal. In naher Zukunft ist sie für Naturwissenschaftler ein Prozess mit Einblick – sowie der Möglichkeit zum Eingriff.
Fit für die Industrie 4.0
Die vielfältigen Möglichkeiten ändern auch die Art und Weise, wie die Menschen in der Produktion arbeiten. Das gilt besonders in der Pharma-Industrie, wo die Themen Qualitätsprüfung und Zulassung hohe Ansprüche an die Produktion stellen. Derzeit arbeiten Experten an Fort- und Weiterbildungskonzepten, um Fachkräfte aller Bereiche fit für die Industrie 4.0 zu machen. Noch ist das Thema jung, etablierte Bildungswege für Naturwissenschaftler gibt es noch nicht. Den neuesten Stand und viele weiterführende Infos zum Thema bietet das im April 2015 gestartete Portal „Plattform Industrie 4.0“.
www.plattform-i40.de









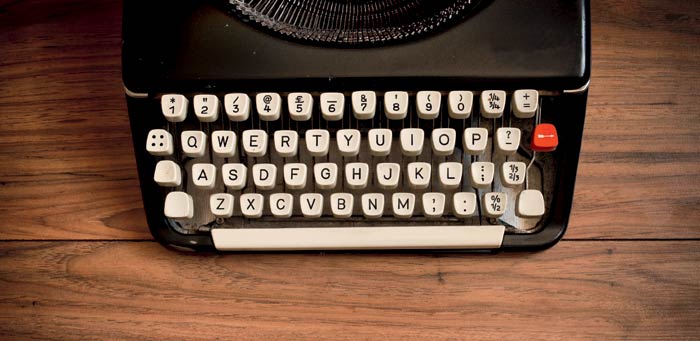

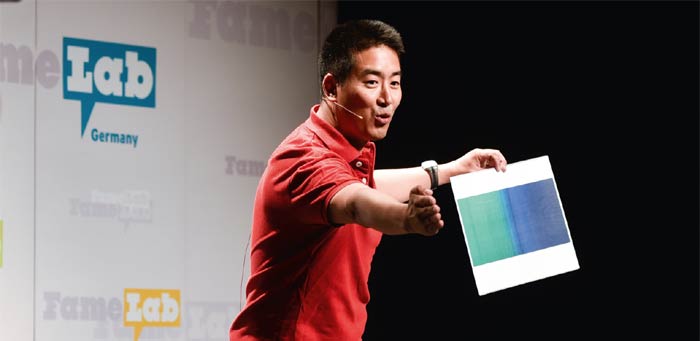

 Iris Riffelt: Zwischenstopp Burnout.
Iris Riffelt: Zwischenstopp Burnout.