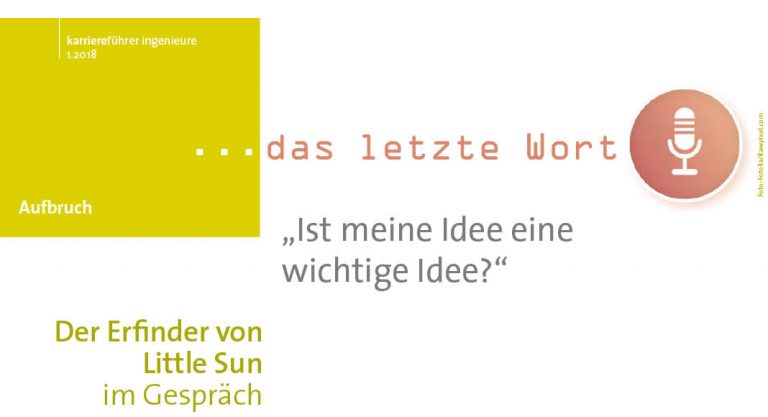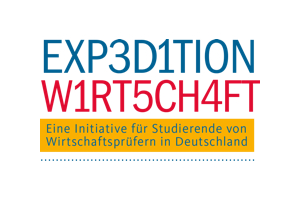Dr. Anna Schwarz wurde auf der Hannover Messe 2017 zur Engineer Powerwoman nominiert. Die 37-jährige Maschinenbauingenieurin ist Geschäftsführerin der Danto-Invention GmbH, die eine Feder aus Faser-Verbund- Werkstoff entwickelt hat. Im karriereführer gibt sie Tipps zur Unternehmensgründung. Die Fragen stellte Sabine Olschner.
Wie kamen Sie auf die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
Ich habe meinen heutigen Ehemann und Geschäftspartner Tobias Keller im ersten Semester kennengelernt. Schon früh im Studium haben wir beschlossen: Wenn wir eine Idee haben, mit der wir uns selbstständig machen können, würden wir das tun. Bei seiner Promotion im Leichtbau-Bereich beschäftigte sich mein Mann mit einem sehr interessanten Thema für die Industrialisierung: einer Feder aus Faser- Kunststoff-Verbunden für die Automobilindustrie. Da haben wir nicht lange gezögert, sondern direkt ausprobiert, wie die Idee am Markt ankommen würde.
Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Das Interesse aufseiten der Automobilbauer war groß, die Spiralfedern in Pkw durch Leichtbaufedern zu ersetzen. Die ersten sechs Jahre haben wir in die Entwicklung gesteckt – hier hat uns bereits die Automobilindustrie unterstützt. Seit 2016 haben wir ein funktionierendes Konzept, das wir nun bei verschiedenen Herstellern in Serie umsetzen lassen. Da es um mehrere Millionen Federn pro Jahr geht, können wir diese nicht selber produzieren, sondern arbeiten hier mit einem Partner zusammen.
Wie haben Sie sich das betriebswirtschaftliche Wissen für Ihre Arbeit als Geschäftsführerin angeeignet?
Ich habe nach meiner Promotion an einer Fernuniversität BWL studiert, um die Grundlagen für das Management einer Firma zu erlernen. Das Wissen über Marketing, Steuern, Budgetierung etc. fehlte uns beiden als Maschinenbauingenieuren. Daher war das Studium sehr hilfreich.
Wie geht es jetzt weiter?
Wir wollen die Entwicklung unserer Federn weiter vorantreiben, um sie zum Beispiel auch für andere Industrien anbieten zu können, etwa für den Schiffbau, die Robotik, die Luft- und Raumfahrt, die Transportindustrie oder den Maschinenbau – eben überall dort, wo Gewichtsparen von Interesse ist.
Würden Sie Ingenieuren grundsätzlich dazu raten, sich selbstständig zu machen, wenn sie eine gute Idee haben?
Die Maschinenbaubranche in Deutschland lebt von neuen Entwicklungen und Innovationen. Wer also eine gute Idee hat, sollte sich Unterstützung suchen – sei es in finanzieller Hinsicht oder in Form von Management-Know-how – und es probieren. Es gibt viele Fördervereine, die Start-ups helfen. Für jeden, der den Mut hat, sich selbstständig zu machen, kann ich diesen Weg nur empfehlen. Man braucht dazu Risikobereitschaft und wahnsinnig viel Zeit. 60- bis 70-Stunden- Wochen waren für uns am Anfang keine Seltenheit.
Was sind Ihre Tipps für angehende Gründer?
Man muss sich von der Vorstellung lösen, dass von Anfang an alles klappen wird. Man muss flexibel bleiben und sich immer wieder neuen Situationen anpassen – die sich manchmal täglich ändern. Und man darf sich nicht zu hohe Ziele stecken, sondern das Ganze realistisch betrachten. Im Zweifel ist es besser, Prognosen nach unten zu korrigieren als mit seiner Idee zu scheitern. Wer etwas Neues entwickelt, geht einen Weg, den niemand zuvor gegangen ist. Die Probleme, auf die man dort trifft, sind aber alle lösbar.
Langsamer Anstieg bei weiblichen Führungskräften
Laut dem Führungskräfte-Monitor 2017 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung waren im Jahr 2015 in Deutschland von den knapp über 4,9 Millionen angestellten Führungskräften in der Privatwirtschaft 30 Prozent Frauen (Vorjahr: 28 Prozent). Von 1995 bis 2015 stieg der Frauenanteil in Führungspositionen um 10 Prozentpunkte. Die Dynamik des Anstiegs war in der Dekade nach 2005 etwas stärker als zwischen 1995 und 2005. In Westdeutschland war seit 2010 kein nennenswerter Anstieg mehr zu beobachten. In den neuen Bundesländern war die Entwicklung weit dynamischer: Im Jahr 2015 lag hier der Anteil von Frauen in Führungs positionen bei 44 Prozent (2010: 38 Prozent), gegenüber 27 Prozent im Westen (2010: 26 Prozent). Insgesamt ist der Frauenanteil in Führungs positionen in der Privatwirtschaft geringer als im öffentlichen Dienst. Quelle: www.diw.de
Erfolgsfaktoren von weiblichen amerikanischen Top-CEOs
Laut einer aktuelle Studie des Beratungsunternehmens Korn-Ferry und der Rockefeller Foundation wussten nur 7 von 57 amerikanischen weiblichen CEOs schon sehr früh, dass sie einmal an der Spitze eines Unternehmens stehen wollen. 40 Prozent der weiblichen CEOs haben einen Abschluss in MINT-Fächern. Viele haben in den persönlichen Interviews berichtet, dass sie stets beweisen wollten, dass Probleme lösbar sind. Unabhängigkeit bedeutet für sie das Streben danach, selbst zu gestalten und nicht nur zu verwalten. 39 der 57 Teilnehmerinnen haben angegeben, dass für sie ein Sinn in ihrer Tätigkeit besonders wichtig ist. Sinn bedeutet für sie ein positiver Einfluss auf Mitarbeiter, das Umfeld des Unternehmens und die Welt im Allgemeinen. Auch Demut ist ihnen wichtig: Die befragten Frauen sind laut eigenen Angaben in der Lage, Situationen und den damit verbundenen Personen, die einen Beitrag zum eigenen Erfolg geleistet haben, Respekt entgegenzubringen. Auch weil sie wissen, dass sie nicht immer alles selbst unmittelbar beeinflussen können. Mehr Infos: www.kornferry.com





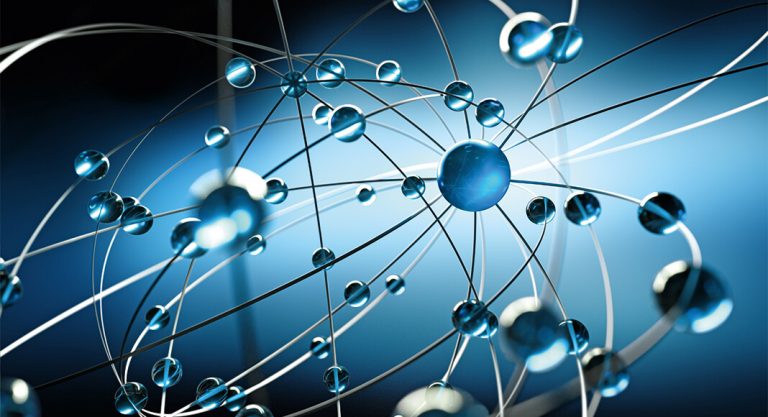





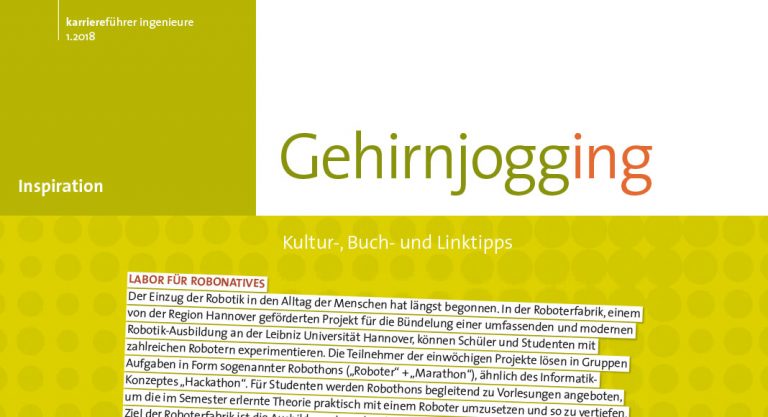
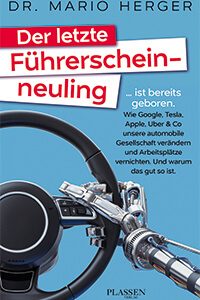 Werden wir im Jahr 2030 noch selber Auto fahren? Im Zeitalter autonom fahrender und vernetzter Fahrzeuge wird der menschliche Faktor die Sicherheit auf den Straßen nur unnötig gefährden, meint Dr. Mario Herger, Unternehmensberater im Silicon Valley. Neue Mobilitätskonzepte, E-Antrieb, autonome Fahrzeuge und Geschäftsmodelle wie das von Uber werden unser Leben und unsere Städte verwandeln, so sein Ausblick. Zahlreiche Start-ups im Silicon Valley arbeiten bereits am Ende des klassischen Automobils, wie wir es kennen. Und damit auch am Ende eines ganzen Industriezweigs. Herger will zeigen, wie diese Revolution Kraft und Energien freisetzt, die in Innovationen fließen können, und ruft auf zu Radikalität im Denken und Mut, die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Mario Herger: Der letzte Führerscheinneuling. Plassen Verlag 2018.
Werden wir im Jahr 2030 noch selber Auto fahren? Im Zeitalter autonom fahrender und vernetzter Fahrzeuge wird der menschliche Faktor die Sicherheit auf den Straßen nur unnötig gefährden, meint Dr. Mario Herger, Unternehmensberater im Silicon Valley. Neue Mobilitätskonzepte, E-Antrieb, autonome Fahrzeuge und Geschäftsmodelle wie das von Uber werden unser Leben und unsere Städte verwandeln, so sein Ausblick. Zahlreiche Start-ups im Silicon Valley arbeiten bereits am Ende des klassischen Automobils, wie wir es kennen. Und damit auch am Ende eines ganzen Industriezweigs. Herger will zeigen, wie diese Revolution Kraft und Energien freisetzt, die in Innovationen fließen können, und ruft auf zu Radikalität im Denken und Mut, die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu sehen. Mario Herger: Der letzte Führerscheinneuling. Plassen Verlag 2018.

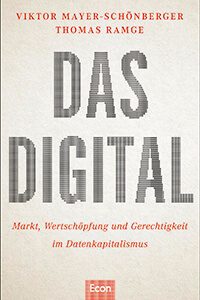 Wie entsteht ökonomischer Mehrwert im Kapitalismus? Und wie sollte er umverteilt werden? Das waren die zentralen Fragen, die Karl Marx am Übergang zum Industrie-Kapitalismus in „Das Kapital“ auf radikale Weise beantwortete. Viktor Mayer-Schönberger, ehemaliger Harvard-Professor und heutiger Inhaber des Lehrstuhls für Internet Governance in Oxford, und Technologie-Journalist Thomas Ramge beantworten die gleichen Fragen am Übergang zum globalen Datenkapitalismus neu. Ihre These: Wir können mit Daten den Markt neu erfinden und Wohlstand für alle schaffen. Dazu müssen Big Data, Automatisierung und künstliche Intelligenz ihr Potenzial voll entfalten können. Den Effizienzgewinn dürfen nicht allein die großen Datenmonopolisten einstreichen. Nur wenn dieser allen zugutekommt, schaffen wir eine digitale soziale Marktwirtschaft . In der aber werden Geld und Banken eine untergeordnete Rolle spielen, glauben die Autoren. Thomas Ramge, Viktor Mayer-Schönberger: Das Digital. Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus. Econ Verlag 2017
Wie entsteht ökonomischer Mehrwert im Kapitalismus? Und wie sollte er umverteilt werden? Das waren die zentralen Fragen, die Karl Marx am Übergang zum Industrie-Kapitalismus in „Das Kapital“ auf radikale Weise beantwortete. Viktor Mayer-Schönberger, ehemaliger Harvard-Professor und heutiger Inhaber des Lehrstuhls für Internet Governance in Oxford, und Technologie-Journalist Thomas Ramge beantworten die gleichen Fragen am Übergang zum globalen Datenkapitalismus neu. Ihre These: Wir können mit Daten den Markt neu erfinden und Wohlstand für alle schaffen. Dazu müssen Big Data, Automatisierung und künstliche Intelligenz ihr Potenzial voll entfalten können. Den Effizienzgewinn dürfen nicht allein die großen Datenmonopolisten einstreichen. Nur wenn dieser allen zugutekommt, schaffen wir eine digitale soziale Marktwirtschaft . In der aber werden Geld und Banken eine untergeordnete Rolle spielen, glauben die Autoren. Thomas Ramge, Viktor Mayer-Schönberger: Das Digital. Markt, Wertschöpfung und Gerechtigkeit im Datenkapitalismus. Econ Verlag 2017