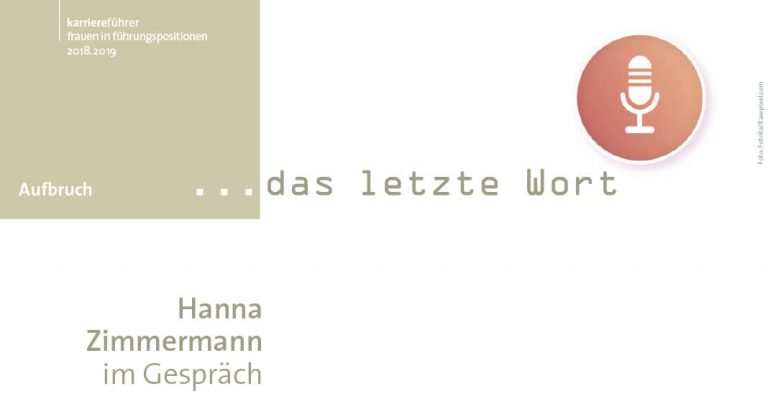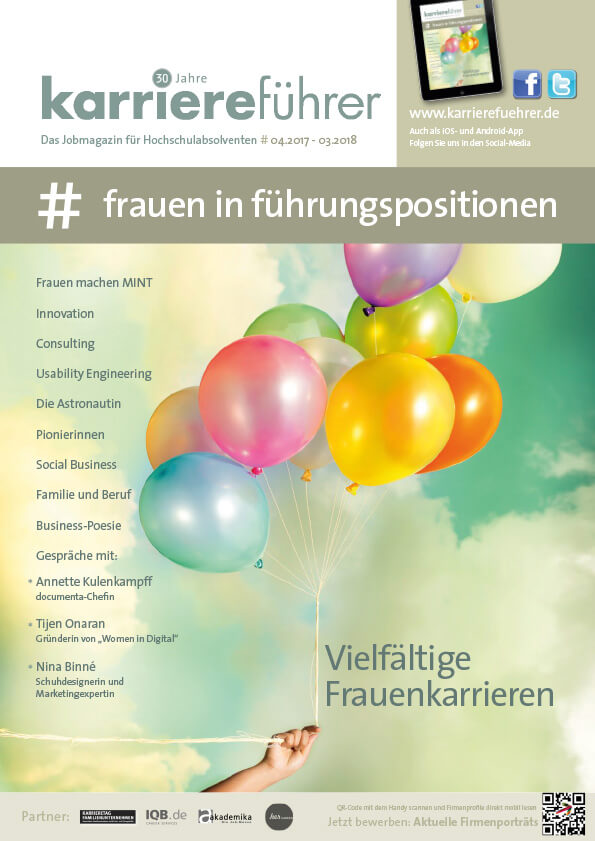Sie kämpften in einer männlich dominierten Gesellschaft für ihre Überzeugungen, setzten sich an die Spitze der technischen und künstlerischen Innovation und prägten den Verlauf der Geschichte mit ihren Ideen. Im sechsten Teil unserer Pionierinnen-Reihe stellen wir Frauen vor, die mit ihrem Mut und ihrem Durchsetzungsvermögen den Weg zur Gleichberechtigung geebnet haben. Von Kathreen Claire Schulz
Carmen Herrera (*1915)
„Besser spät als nie“ auf Carmen Herrera passt diese Redewendung wie die Faust aufs Auge: Erst 2003 – damals war sie 89 Jahre alt! – wurde sie endlich als Künstlerin entdeckt und als Pionierin der Farbfeldmalerei anerkannt. Herrera studierte zunächst in ihrem Geburtsort Havanna Architektur, dann heiratete sie, zog nach New York und studierte Malerei.
In den 1940er Jahren lebte sie für kurze Zeit in Paris und lernte dort die europäische Avantgarde kennen. Sie nahm an zahlreichen Ausstellungen teil und fand ihren Stil, der sich durch klare Strukturen und starke Kontraste hervorhob. Ihre Gemälde waren ihrer Zeit voraus, dennoch erfuhr sie Jahrzehnte lang Ablehnung. 1954 kehrte sie mit ihrem Ehemann nach New York zurück, wo sie bis heute lebt und arbeitet.
Ihre Bilder hängen nun in weltberühmten Museen wie dem Museum of Modern Art in New York und der Tate Gallery in London. Die Ausstellung „Lines of Sight“ wurde vom Whitney Museum of American Art, New York, organisiert und war bis Anfang April 2018 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf zu sehen. Der Katalog zur Ausstellung erschien im Wienand Verlag. Interessant ist auch die Dokumentation „The 100 years show“, zu sehen auf Netflix: www.netflix.com/de/title/80106609
Jeanne Baret (1740 – 1807)
Jeanne Baret war wohl die erste Frau, die die Welt umsegelt hat. In ihrer Jugend war sie mittellos, und mit ihrem Geliebten, dem angesehenen Botaniker Philibert Commerson, konnte sie aufgrund des Standesunterschiedes nur heimlich zusammen sein – sie arbeitete als seine Haushälterin. Als Commerson 1766 auf eine Expedition in den Südpazifik ging, verkleidete Jeanne Baret sich als Mann und nannte sich Jean. Sie begleitete Commerson als Kammerdiener und Assistent – Frauen waren auf Marineschiffen nicht erlaubt.
Auf Mauritius trennte sich das Paar vom Rest der Expedition und blieb fast fünf Jahre auf der Insel. Sie sammelten über 6.000 Pflanzen, die heute im Museúm national d’historie naturelle ausgestellt werden. Auch als Commerson krank wurde, sammelte Baret weiter. Nach seinem Tod kehrte sie nach sieben abenteuerlichen Jahren nach Paris zurück.
Ihre Leistungen wurden lange nicht anerkannt. Erst 2012 ehrte sie Eric Tepe, Professor für Biologie der Universität in Utah, indem er ein von ihm entdecktes Nachtschattengewächs nach ihr benannte, das Solanum baretiae.
Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin (1777 – 1866)
Die französische Unternehmerin BarbeNicole ClicquotPonsardin ist bekannt als die Grande Dame de Champagne (die ‚Große Dame des Champagners‘). Nach dem Tod ihres Mannes übernahm sie die Leitung des von ihrem Schwiegervater gegründeten Champagnerhauses, das nur ein kleiner Familienbetrieb war. Sie war damals 27 Jahre alt und entwickelte sich schnell zur leidenschaftlichen Unternehmerin.
Sie optimierte das Verfahren zur Herstellung und stellte ihren Champagner an allen Herrschaftshöfen in Europa vor. BarbeNicole ClicquotPonsardin war die erste, die ihren Wein nach Russland liefern ließ, nachdem die napoleonischen Kriege beendet waren und ging damit ein enormes Risiko ein, das sich aber schnell auszahlte. Um andere mutige Unternehmerinnen zu ehren hat das Champagnerhaus 1972 den Veuve Clicquot Business Woman Award ins Leben gerufen.
Maria Montessori (1870 – 1952)
„Hilf mir es selbst zu tun“ ist der berühmte Leitsatz der Ärztin, Reformpädagogin, Philosophin und Philanthropin Maria Montessori. Sie hat die Montessori-Pädagogik begründet, deren Kerngedanke es ist, dass Kinder von sich aus lernen wollen und von Erwachsenen nur unterstützend begleitet werden sollten. Maria Montessori absolvierte zunächst ein Studium der Mathematik und des Ingenieurwesens, danach studierte sie Medizin und promovierte als eine der ersten Frauen Italiens.
Sie arbeitete mit Kindern mit Behinderungen, und als Direktorin eines Heilpädagogischen Zentrums entwickelte sie Lernmaterialien, mit denen die Kinder Fortschritte machten, die man zuvor nicht für möglich gehalten hatte. Auf vielen Reisen – durch Europa, Indien und Amerika – hielt sie Vorträge über ihre Pädagogik, aber auch über die Emanzipation der Frauen. Heute gibt es auf der ganzen Welt Schulen und Kindertagesstätten, die sich an Montessoris Ideen orientieren, alleine in Deutschland sind es mehr als tausend Einrichtungen.
Bibiana Steinhaus (*1979)
Bibiana Steinhaus ist Polizeihauptkommissarin, Abwehrspielerin in der niedersächsischen Polizeiauswahl und die erste Schiedsrichterin in der Geschichte der Männer-Bundesliga. Sie pfiff 80 Zweitliga-Partien, bei den Frauen-Weltmeisterschaften 2011 und 2015 sowie bei Olympia 2012. Bereits dreimal (2013, 2014 und 2017) wurde sie als Weltschiedsrichterin des Jahres ausgezeichnet. 2015/16 legte sie eine tadellose Saison in der zweiten Liga hin und stand auf Platz 1 der Rangliste der besten Schiedsrichter. Ein Jahr später stieg sie in die erste Liga auf und leitete zum ersten Mal ein Spiel in der ersten Liga – Hertha BSC gegen Werder Bremen.
Sie setzt sich mit viel Gelassenheit in der Männerdomäne durch und betont immer wieder, dass sie nach ihrer Leistung beurteilt werden möchte und ihr Geschlecht dabei zweitrangig sein sollte. „Ich bin die ganze Frauen-/Männerdiskussion leid. Nur Leistung zählt“, sagte Steinhaus beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbandes im Januar 2018. „Es war nie mein Ziel, in eine Männerdomäne reinzukommen; es war mein Ziel, Spiele zu leiten.“
Redaktionstipp:
Inspiration Circle
Mit She’s Mercedes bietet Mercedes Benz Frauen eine Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und Ideen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und voneinander zu lernen. NetworkingVeranstaltungen, ein Magazin und eine Website sollen Frauen inspirieren, sie untereinander vernetzen und befähigen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Außergewöhnliche Frauen aus verschiedenen Bereichen und Branchen vermitteln persönliche Einblicke in Themen rund um das Geschäftsund Privatleben und geben Tipps, wie man beides erfolgreich in Einklang bringen kann. Unser Highlight: Der Kurzfilm Iconic You – eine Hommage an die Pionierinnen dieser Welt. Im Zeitraffer und mittels aufwändiger Schminktechniken zeigt der Film die Verwandlung einer jungen Frau in verschiedene Ikonen. www.mercedesbenz.com/de/mercedesme/inspiration/she





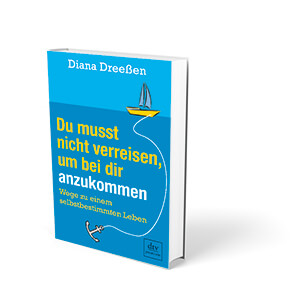 Diana Dreeßen: Du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen. dtv 2017. 14,90 Euro.
Diana Dreeßen: Du musst nicht verreisen, um bei dir anzukommen. dtv 2017. 14,90 Euro.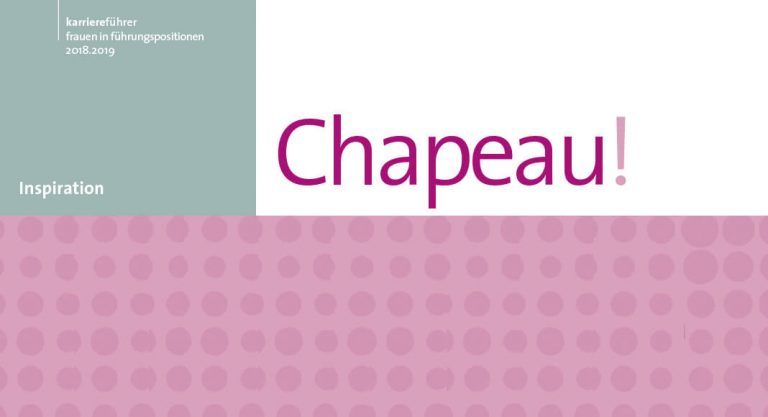

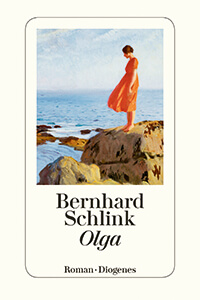 Bernhard Schlink, Autor des Weltbestsellers „Der Vorleser“, erzählt in seinem neuen Roman die Geschichte von Olga, einer starken, klugen Frau – und gleichzeitig ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte. „Bernhard Schlink hat uns mit Olga eine stolze wie gradlinige, mutige, selbstbewusste und aufrechte Frauengestalt geschenkt“, urteilte Deutschlandfunk Kultur. Bernhard Schlink: Olga. Diogenes 2018. 24 Euro. Auch als Hörbuch und EBook erhältlich!
Bernhard Schlink, Autor des Weltbestsellers „Der Vorleser“, erzählt in seinem neuen Roman die Geschichte von Olga, einer starken, klugen Frau – und gleichzeitig ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte. „Bernhard Schlink hat uns mit Olga eine stolze wie gradlinige, mutige, selbstbewusste und aufrechte Frauengestalt geschenkt“, urteilte Deutschlandfunk Kultur. Bernhard Schlink: Olga. Diogenes 2018. 24 Euro. Auch als Hörbuch und EBook erhältlich!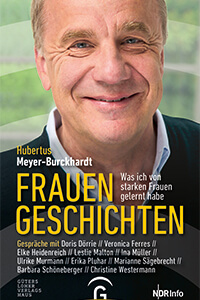 Hubertus Meyer-Burckhardt, preisgekrönter Film- und TV-Produzent, Journalist, Manager in der Medienbranche, Schriftsteller und seit vielen Jahren Gastgeber der „NDR Talk Show“, hat viele Menschen interviewt. Und immer wieder Frauen, die ihn tief beeindruckt haben – unter anderem in seiner Radiosendung „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ auf NDR Info. Frauen, „die etwas ›vertragen‹, die das Leben abkönnen, die sich dem Leben stellen, die mutig sind und unvernünftig, die sich für ihre Lebenszeit verantwortlich fühlen und für nichts anderes.“ Zehn von Ihnen porträtiert er in seinem neuesten Buch „Frauengeschichten“, darunter Doris Dörrie, Ina Müller, Marianne Sägebrecht und Barbara Schöneberger. Hubertus Meyer-Burckhardt: Frauengeschichten. Gütersloher Verlagshaus 2017. 19,99 Euro Der Autor ist auf Lesereise. Alle Termine auf
Hubertus Meyer-Burckhardt, preisgekrönter Film- und TV-Produzent, Journalist, Manager in der Medienbranche, Schriftsteller und seit vielen Jahren Gastgeber der „NDR Talk Show“, hat viele Menschen interviewt. Und immer wieder Frauen, die ihn tief beeindruckt haben – unter anderem in seiner Radiosendung „Meyer-Burckhardts Frauengeschichten“ auf NDR Info. Frauen, „die etwas ›vertragen‹, die das Leben abkönnen, die sich dem Leben stellen, die mutig sind und unvernünftig, die sich für ihre Lebenszeit verantwortlich fühlen und für nichts anderes.“ Zehn von Ihnen porträtiert er in seinem neuesten Buch „Frauengeschichten“, darunter Doris Dörrie, Ina Müller, Marianne Sägebrecht und Barbara Schöneberger. Hubertus Meyer-Burckhardt: Frauengeschichten. Gütersloher Verlagshaus 2017. 19,99 Euro Der Autor ist auf Lesereise. Alle Termine auf 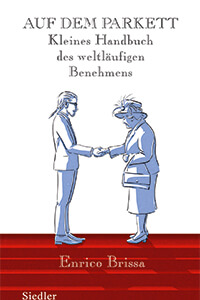 Enrico Brissa ist promovierter Jurist und weiß, was sich gehört: 2011 bis 2016 war er als Protokollchef im Bundespräsidialamt tätig, unter den Bundespräsidenten Wulff und Gauck. Seit 2016 leitet er das Protokoll beim Deutschen Bundestag. Nun hat er ein Buch veröffentlicht – ein Plädoyer für die schönen Künste der Höflichkeit. Er erklärt, wie man einen Toast ausbringt, wie man sich stilvoll entschuldigt oder wie man lernt, mit Komplimenten umzugehen. Ein unterhaltsames wie lehrreiches Kompendium des sozialen Miteinanders mit Illustrationen von Birgit Schössow. Enrico Brissa: Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens. Siedler 2018. 18 Euro
Enrico Brissa ist promovierter Jurist und weiß, was sich gehört: 2011 bis 2016 war er als Protokollchef im Bundespräsidialamt tätig, unter den Bundespräsidenten Wulff und Gauck. Seit 2016 leitet er das Protokoll beim Deutschen Bundestag. Nun hat er ein Buch veröffentlicht – ein Plädoyer für die schönen Künste der Höflichkeit. Er erklärt, wie man einen Toast ausbringt, wie man sich stilvoll entschuldigt oder wie man lernt, mit Komplimenten umzugehen. Ein unterhaltsames wie lehrreiches Kompendium des sozialen Miteinanders mit Illustrationen von Birgit Schössow. Enrico Brissa: Auf dem Parkett. Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens. Siedler 2018. 18 Euro