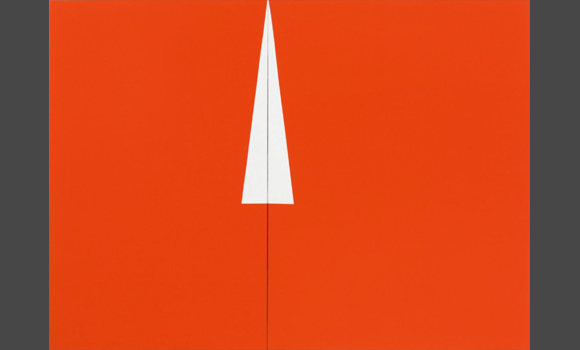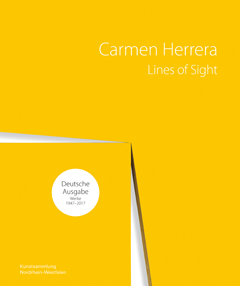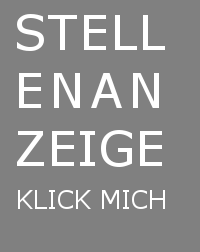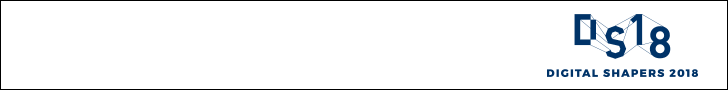Während einige Händler noch immer keinen Internetauftritt haben, bauen andere ihr Unternehmen massiv um. Es entstehen Jobs, die sich mit Big Data und Security befassen und die Digitalisierung der Supply Chain vorantreiben. Studien zeigen: Diesem Handel gehört die Zukunft – und zwar sowohl im Netz als auch stationär in den Showrooms. Von André Boße.
Wenn der britische Bestseller-Autor Ken Follett (68) – Zahl der weltweit verkauften Bücher: mehr als 160 Millionen – seine Frau Barbara anspricht, nennt er sie formvollendet „my dear“. Dann jedoch dreht er sich zum Journalisten um und erklärt mit breitem Grinsen im Gesicht: „Eigentlich ist sie mein Boss.“ Das ist in diesem Fall keine Koketterie: Barbara Follett (74) war bis 2010 eine erfolgreiche Politikerin, sie saß im Parlament, war als Ministerin tätig. Als sie ihre politische Laufbahn beendete, startete sie an der Seite ihres Mannes eine zweite Karriere: Sie ist nun Boss von Ken Follett – gemeint ist hier weniger die Person ihres Mannes als die Marke hinter dem Schriftsteller.
Handel digitalisiert sich schleppend
Die Handelsunternehmen sehen sich beim Stand der digitalen Transformation selbst eher im Rückstand. Laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom aus dem Juni 2017 betrachten sich 77 Prozent der Händler als Nachzügler in Sachen Digitalisierung. „Zwei von drei Händlern sehen die Digitalisierung jedoch als Chance. Sie müssen die Digitalisierung jetzt also entschlossener angehen“, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Mehr als jeder dritte stationäre Händler (36 Prozent) bietet gar keine Internet-Präsenz, nur 6 Prozent geben an, online ein größeres Angebot als im Geschäft zu haben. „Viele Händler sehen den Online-Shop nicht als Chance für eine Erweiterung des Portfolios, etwa da sie Produkte dann nicht mehr alle einzeln im Ladengeschäft vorhalten müssen“, kritisiert Rohleder.
Ken Follett ist weit mehr als ein künstlerischer Einzelkämpfer. „Für mich arbeiten 30 Leute“, sagt der Autor, der mit Büchern wie „Die Nadel“ oder „Die Säulen der Erde“ Weltruhm erlangte und aktuell sein Buch „Das Fundament der Ewigkeit“ auf den Markt gebracht hat. Booker buchen seine Lesereisen, Kommunikationsprofis bereiten Marketing- und Medienkampagnen vor, Vertriebler bringen die Werke in den Handel, Historiker helfen dem Autor bei der Recherche, Lizenzexperten vermarkten seine Geschichten für Verfilmungen, Brett- oder Videospiele.
Der Schriftsteller weiß: Dass die Story von „Das Fundament der Ewigkeit“ spannend zu lesen ist, ist die halbe Miete. Genau so wichtig ist aber ein Managementkonzept, um das mehr als 1000 Seiten dicke Werk über möglichst viele Kanäle zu vermarkten. Ken Follett schreibt das Buch, gibt die Interviews. Seine Frau Barbara jedoch ist der Boss – das Management hinter dem Welterfolg.
Vier Aspekte für die Zukunft des Handels
Die Erfolgsformel des Bestsellerautors zeigt, worauf es im Handel ankommt. Ein starkes Produkt ist wichtig, ohne Frage. Mindestens so bedeutsam ist jedoch ein Management-Team, das nicht nur den klassischen Kanal im Blick hat, sondern weiter denkt. Es geht nicht nur darum, was verkauft werden soll – sondern auch, auf welche Art und über welche Kanäle. Zudem gilt es zu prüfen, ob weitere Absatzmärkte identifiziert werden können – wie im Fall Follett eben die Film- und Gaming- Industrie. Mehr denn je entwickeln sich daher neue Themen, die den Handel schon heute prägen und neue Job-Profile entstehen lassen. Die Studie „Total Retail 2017“ der Unternehmensberatung PwC hat einige davon als besonders wichtig identifiziert:
25.000 Smartphones für dm-Mitarbeiter
Als Teil der Digitalsierungsstrategie wird die Drogeriemarkt-Kette dm bis Ende des Jahres alle im Verkauf und in der Beratung Beschäftigten mit einem Smartphone ausstatten. „Wir haben das in den Sommermonaten getestet und eine sehr breite Zustimmung seitens der am Test beteiligten Kolleginnen und Kollegen erhalten. Die mehr als 25.000 Smartphones in den Händen der Mitarbeiter erleichtern den Wissens- und Informationstransfer von den filialunterstützenden Diensten in Karlsruhe in alle 1892 dm-Märkte“, heißt es in einer dm-Pressemitteilung.
1. Data Analystics
Laut Studie ist die Loyalität der deutschen Kunden im internationalen Vergleich eher gering: Fast die Hälfte, nämlich 47 Prozent, bevorzugten es, regelmäßig neue Produkte auszuprobieren. Diese Wechselkunden sind unbekannte Wesen: Was sind die Motive, das Konsumverhalten zu verändern? Wie lässt sich die Loyalität steigern? Die Antwort der PwC-Experten: „Datenanalysen und neue Technologien sind die Basis, um kundenorientierte Loyalty-Strategien zu entwickeln.“ Innovative Digitalabteilungen nehmen für Handelsunternehmen die Funktion von Seismografen wahr, ihre Aufgabe ist es, aus Kundendaten das Verhalten der Konsumenten zu erklären, im besten Fall zu prognostizieren.
2. Gestaltung und Beratung im Showroom
Für viele ist „Schaufensterbummel“ ein Relikt aus alten Zeiten: Viele Kinder wurden von ihren Eltern und Großeltern mitgeschleppt, um sich an Sonntagen die Auslagen der (geschlossenen) Geschäfte anzuschauen. Laut PwCStudie ist dieses Konsumentenverhalten nun wieder im Trend: Der Kunde betrachtet das stationäre Geschäft als „Showroom“; man lässt sich beraten, vergleicht die Konkurrenz, prüft das Online-Angebot. Daher sind Showrooms für Händler „eine gute Option, um mit Beratungskompetenz zu punkten und den Online-Handel zu stützen“, schreiben die Autoren der Studie. Gefragt sind Experten, die Showrooms und die Beratung dort gestalten und optimieren – und dabei Multichannel- Konzepte stets im Hinterkopf haben.
3. Marketing über Social Media
Laut Studie nutzen 43 Prozent der Kunden zwischen 18 und 34 Jahren regelmäßig die sozialen Medien als Inspirationsquelle für ihre Käufe, auch die Altersgruppe der über 35-Jährigen setze im Einkaufsprozess immer häufiger auf Social Media. „Insbesondere Storytelling ist eine gute Möglichkeit für Händler, die Aufmerksamkeit der Konsumenten zu erreichen“, so die PwC-Autoren. Handelsunternehmen müsse es gelingen, über die verschiedenen Kanäle interessante Geschichten über das Produkt zu erzählen und attraktive Inhalte zu bieten. Eine Aufgabe für ein Social-Media-Management, das deutlich weiterdenkt, als hier und da mal etwas zu posten!
4. Datensicherheit schafft Vertrauen
Kaum noch ein Kunde ist unbekümmert digital unterwegs: Das Sicherheitsrisiko ist bekannt, entsprechend groß sind die Anforderungen der Konsumenten an die Security des E-Commerce: „61 Prozent der Kunden kaufen online nur bei Unternehmen, denen sie vertrauen. 67 Prozent wählen nur vertrauenswürdige Zahlungsanbieter aus“, so die Studie. Wer kein Vertrauen bieten kann, verliert mit einem Schlag einen Großteil möglicher Kunden. „Der Vertrauensaufbau ist ein langwieriger Prozess, wohingegen der Vertrauensverlust bei einem ernsten Vorfall rapide eintritt“, schlussfolgert die Studie. Demnach werden IT-Security-Experten für Unternehmen der Handelsbranche immer wichtiger.
Digitalisierung der Supply Chain
Der Einfluss der Digitalisierung auf den Handel ist immens, auch hinter der Kulisse, in den Bereichen Logistik und Supply Chain, tut sich viel. Für die Unternehmen ergeben sich – ähnlich wie in den Fabriken unter dem Schlagwort Industrie 4.0 – ganz neue Möglichkeiten, man darf durchaus von Logistik 4.0 sprechen. „Durch die Digitalisierung der Supply Chain ergeben sich zwei Schwerpunkte: die verstärkte Personalisierung der Produkte und die Geschwindigkeit in der Lieferkette“, sagt Hans Thalbauer, Senior Vice President, Extended Supply Chain bei SAP. Der Softwarehersteller bietet seinen Kunden Lösungen für die Digitale Transformation des Lieferketten- Managements.
Marge, Umsatz und Fehlbestand
Das „SAP Performance Benchmarking“ ist eine Methode, die abhängig von Variablen die Folgen der digitalen Transformation bestimmt. Für die Handelsbranche bedeute das laut SAP-Supply-Chain-Experte Hans Thalbauer, dass
# die operative Marge um 29 Prozent steigt, wenn Verkaufstrends überwacht und Minderumsätze proaktiv analysiert werden,
# der Umsatz im Cross-Selling (also im Verkauf ergänzender Produkte) sowie Up-Selling (Verkauf eines höherwertigen Produkts) um 58 Prozent steigt, wenn der Verkäufer im Kundengespräch Zugang zu Produkt- und Wettbewerberdaten hat,
# die Fehlbestände um 30 Prozent sinken, wenn Buchbestand und aktueller Lagerbestand ständig abgeglichen werden.
Dabei geht es nicht nur darum, die logistischen Prozesse zu digitalisieren: Die Supply Chain der Zukunft ist mit den Social-Media- Kanälen, Showrooms und sonstigen Informationsquellen vernetzt. Das Ziel ist es, in Echtzeit Informationen über Entwicklungen zu erhalten. „Eine Baumarktkette erzielt beispielsweise einen um 30 Prozent höheren Umsatz, indem sie online mit schnellen Preisanpassungen und Sonderangeboten auf Markttrends und Wettbewerberkampagnen reagiert“, sagt Thalbauer. Dabei komme es darauf an, dass der Mitarbeiter im stationären Geschäft genau so über Trends und die Konkurrenz Bescheid weiß, wie der Logistik-Manager.
Vision vom Kunden 4.0
Was dafür benötigt wird, ist eine digitale Infrastruktur vom Lager bis hin zum Endpoint, also dem Ort, an dem sich der Kunde für ein Produkt entscheidet. „IT- und Marketingleiter sowie die Logistiker sollten sich daher zusammensetzen, um Synergien zu schaffen“, fordert der SAP-Experte. Doch das ist für viele Unternehmen leichter gesagt als getan: Thalbauer, der viele Kunden mit Blick auf die digitale Transformation der Supply Chain berät, hat festgestellt, dass sich viele Unternehmen schwer damit tun, eine neue Lern- und Führungskultur zu entwickeln. „Um die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern und in Innovationen umzusetzen, müssen Firmen und ihre Mitarbeiter agiler werden“, sagt Thalbauer. „Die Unternehmenskultur muss sich verändern, in Richtung mehr Autonomie und Handlungsfreiheit.“
Auch sei es wichtig, über neue Modelle nachzudenken, um noch mehr Wissen über den Kunden und dessen Erfahrungen mit dem Produkt zu erlangen. Da könne über „Co-Creation oder „Mitarbeit im Rahmen der Sharing Economy gelingen“, sagt Thalbauer. Somit wären bestimmte Kunden nicht mehr nur passive Konsumenten, sondern aktiv an der Weiterentwicklung beteiligt. Im Idealfall ist der Kunde dann nicht mehr das unbekannte und wechselhafte Wesen, sondern ein aktiver Teil der digitalen Kette: Der Konsument, der selbst Veränderungen anstößt und sein Produkt in Zusammenarbeit mit der digitalen Infrastruktur des Unternehmens personalisiert – das wäre dann wohl der Kunde 4.0.
Glossar für den Handel in 20 Jahren
Die Zukunftsforscher des Trendbüros haben zusammen mit dem TV-Shopping- Kanal QVC Ende 2016 eine „Zukunftsstudie Handel 2036“ entwickelt. Folgende Techniken werden in 20 Jahren zum Alltag gehören:
# NFC-Tag – Mit der „Near Field Communication“ können Daten über kurze Distanz ausgetauscht werden, die Technik soll die Grundlage für das einfache Bezahlen mit dem Smartphone werden.
# Gamification – Der Mensch spielt gerne. Der Handel kann das nutzen, indem er beim Shopping Gaming-Ideen integriert, zum Beispiel bei Bestellung oder Kunden-Feedback.
# Predicitive Analytics: Datenmodelle versuchen, die Nachfrage nach bestimmten Produkten anhand von prognostizierten Ereignissen vorherzusagen, vom Wetter bis hin zu plötzlichen Food-Trends.
 Sebastian Tonn: 1x Rente bitte! Die große Portion! Heute richtig vorsorgen – anschaulich und einfach erklärt. FinanzBuch Verlag – Münchner Verlagsgruppe 2. Auflage 2018. 9,99 Euro (Amazon-Werbelink). Auch als E-Book erhältlich!
Sebastian Tonn: 1x Rente bitte! Die große Portion! Heute richtig vorsorgen – anschaulich und einfach erklärt. FinanzBuch Verlag – Münchner Verlagsgruppe 2. Auflage 2018. 9,99 Euro (Amazon-Werbelink). Auch als E-Book erhältlich!