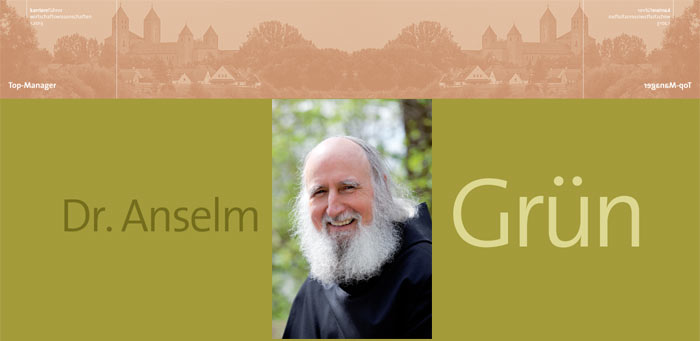Selber gründen? Muss man dafür nicht ein Alleskönner sein? Tagsüber ein kreativer Entrepreneur – und abends ein fleißiger Buchhalter? Nein, sagt Günter Faltin. Der Professor für Entrepreneurship empfiehlt Gründern, möglichst viel von dem, was ihnen schwerfällt, anderen zu überlassen – nur so kann man sich auf die Geschäftsidee und ein wasserdichtes Konzept fokussieren. Denn wenn das Konzept stimmt, findet man auch Investoren. Das Interview führte André Boße.
Zur Person
Günter Faltin, geboren am 25. November 1944 in Bamberg, ist Professor für Entrepreneurship an der Freien Universität Berlin. Er initiierte 1985 die Teekampagne (s. S. 34) als Modell für Unternehmensgründungen. Der 68-Jährige ist Business Angel zahlreicher Start-ups, darunter Ebuero, Direkt zur Kanzlerin, Ratiodrink, ePortrait und Waschkampagne. 2001 errichtete er die Stiftung Entrepreneurship. 2009 erhielt er für die Teekampagne den Deutschen Gründerpreis. Als „Pionier des Entrepreneurship-Gedankens in Deutschland“ zeichnete ihn der Bundespräsident 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz aus.
Wie definieren Sie in diesem Zusammenhang Kunst? Kunst will zerstören – nicht Prozesse optimieren. Sie will neue Sichtachsen aufzeigen – und genau diese benötigen wir, weil wir sonst diesen Planeten ruinieren. Joseph Schumpeter schreibt von „schöpferischer Zerstörung“. Das trifft den Punkt. Was sind weitere wichtige Eigenschaften für Entrepreneure? Wer in der Lage sein will, neue Ideen in erfolgreiche Ideen umzusetzen, benötigt einen Blick für Zusammenhänge und für Menschen. Dazu Intuition, Bauchgefühl, damit der Entrepreneur auch ohne groß angelegte Marktforschung herausbekommt, ob seine Innovation bei den Kunden ankommen wird. Nun reicht ein gutes Bauchgefühl alleine nicht aus. Welche Methoden gibt es, um herauszufinden, ob meine Idee für ein Geschäftsmodell taugt oder nicht? Es gibt eine Studie, die besagt, 70 Prozent aller Annahmen in Businessplänen seien falsch. Da hilft nur eines: Meine Annahmen nicht als plausibel betrachten, sondern als eine Wette. Und diese Wetten überprüfen. Also auf Leute zugehen und fragen: Würdest du mein Produkt kaufen oder meine Dienstleistung in Anspruch nehmen? Das bleibt aber hypothetisch. Nicht unbedingt. Ich empfehle Gründern, eine Bestell-Liste dabei zu haben. Und wenn jemand antwortet: Ja, würde ich machen, dann soll er verbindlich auf der Liste unterschreiben. Wenn die Liste leer bleibt, weiß man, woran man ist. Das ist wichtig, denn Gründer sind immer sehr in ihre Ideen verliebt. Das muss auch so sein, ist aber gefährlich. Daher rate ich jungen Gründern auch, nicht nur an einer einzigen Idee zu arbeiten, sondern an mehreren gleichzeitig. Wer nur eine Idee hat, verfällt ihr irgendwann so sehr, dass er sie für plausibler hält, als sie eigentlich ist.Linktipps
Entrepreneurship Campus: www.entrepreneurship.de Auf YouTube gibt es einen eigenen Kanal mit Interviews und Info-Videos: www.youtube.com/user/EntrepreneurshipTV
Angenommen, ich habe das Gefühl, dass meine Wette aufgeht. Was dann? Investoren suchen? Nein, dafür ist es noch viel zu früh. Von einer Anfangsidee bis zu einem ausgereiften Konzept ist es ein langer und steiniger Weg, der häufig unterschätzt wird. Viele junge Unternehmen scheitern, weil die Gründung zu optimistisch erfolgte. Viele Probleme ergeben sich erst, wenn man genauer analysiert. In dieser Konzeptphase ist es besonders wichtig, hartnäckig zu sein. Es wird immer vorkommen, dass sich ein Problem auftut und keine Lösung absehbar ist. Dann kommt es auf die Geduld an: Wer tausendmal ein Problem umkreist, findet vielleicht beim tausendersten Mal das Muster für die Lösung – und diese Lösung kann nur bemerkenswert sein, denn sonst wären andere ja auch schon darauf gekommen. Am Ende müssen aber dann doch Investoren her. Gibt es genug Geld für Gründer? Ja. Schon alleine, weil viele erfolgreiche Gründer als Business Angel für junge Gründer tätig werden. Kapital ist nicht länger ein Engpass. Spätestens seit dem Start des Crowdfunding-Konzepts ist das gut belegt. Der Engpass sind gut durchdachte Konzepte. Das führt dazu, dass heute Kapitalgeber nach guten Ideengebern suchen – und nicht umgekehrt.Buchtipp
Günter Faltin: Kopf schlägt Kapital. DTV 2012. ISBN 978-3423347570. 9,90 Euro. Website zum Buch: www.kopfschlaegtkapital.com
Zur Teekampagne
„Wenn man doch den besten Tee der Welt kaufen kann – warum dann noch andere anbieten?“ Dies ist die Wette, die Günter Faltin bei der Gründung seiner Projektwerkstatt GbR einging, die 1985 die Teekampagne startete: Im Angebot ist nur eine einzige Teesorte, Darjeeling, angebaut an den Steilhängen des Himalajas und für viele der „Champagner unter den Teesorten“. Durch den Fokus auf eine Sorte, den Einkauf großer Mengen direkt aus Indien und dem Verkauf nur in Großverpackungen kann das Unternehmen den Preis klein halten. Mit Erfolg: Seit 1995 ist die Teekampagne Marktführer beim Versandhandel von Tee. Weitere Infos: www.teekampagne.de www.facebook.com/teekampagne