Eine betriebswirtschaftliche Bilanz ist selbstverständliches Handwerkszeug des Rechnungswesens. Wie jedoch erstellt man eine Ökobilanz, also eine Lebenszyklusanalyse der Umweltwirkungen eines Menschen, Produkts oder Unternehmens? Und warum ist das auch für Wirtschaftswissenschaftler wichtig? Fragen an Prof. Dr. Matthias Finkbeiner, der an der TU Berlin zu diesem Thema forscht und vor kurzem die erste Ökobilanz eines Menschen erstellt hat – mit einem bemerkenswerten Ergebnis. Das Interview führte André Boße.
Zur Person
Prof. Dr. Matthias Finkbeiner ist Leiter des Fachgebietes Sustainable Engineering und geschäftsführender Direktor des Instituts für Technischen Umweltschutz an der Technischen Universität Berlin. Er besitzt eine Gastprofessur an der chinesischen Akademie der Wissenschaften. Seine Arbeitsschwerpunkte sind u.a. die Erforschung von CO2- und Wasser-Fußabdrücken, die Erstellung von Ökobilanzen sowie die Analyse der Ressourceneffizienz. Er war Teil der Jury des Umweltzeichen „Blauer Engel“ und Präsident ISO-Ausschuss für Ökobilanzen. Als Autor schrieb er sechs Bücher zu seinen Forschungsthemen, zudem ist er Chefredakteur der führenden Fachzeitschrift zu Ökobilanzen, dem „International Journal of Life Cycle Assessment“.
Herr Prof. Finkbeiner, der Mensch bevölkert die Erde seit vielen Jahren, warum waren Sie und Ihr Team die ersten, die eine Ökobilanz erstellt haben?
Die Ökobilanz ist methodisch noch recht jung, es gibt sie erst seit den 80er-Jahren. Entwickelt wurden sie für einzelne Produkte oder Unternehmen, um herauszufinden, welche Wirkungen auf die Umwelt sie während ihres gesamten Lebenszyklus haben. Diese Methode auf den Menschen anzuwenden, führte zu ein paar heiklen Fragen. Wie zum Beispiel rechnet man die Kindheit an, sind zum Beispiel die Eltern für die Ökobilanz ihrer Kinder mitverantwortlich? Auch kann es ethisch schwierig werden, die Ökobilanzen von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituation zu vergleichen, zum Beispiel zwischen Leuten in der Stadt und auf dem Land. Da kann es schnell zu einer Vergleichsdebatte kommen, die wenig zielführend ist.
Sie haben die Ökobilanz des Unternehmers, Autors und Rechtanwalts Dirk Gratzel erstellt. Was hat Sie am Ergebnis überrascht?
Das Ausmaß seiner Bilanz und der hohe Anteil der Mobilität. Wir wussten, dass er beruflich bedingt viel unterwegs ist, die absoluten Zahlen haben uns aber schon überrascht.
In den ersten 50 Jahren seines Lebens hat er CO2-Emmissionen in Höhe von 1147 Tonnen verursacht.
Ja, und ich denke schon, dass eine solche Vergegenwärtigung einen kathartischen Effekt hat. Es beginnt das Nachdenken darüber, wohin wir uns bewegen, was wir besitzen, was wir konsumieren.
Es beginnt das Nachdenken darüber, wohin wir uns bewegen, was wir besitzen, was wir konsumieren.
Wäre also doch eine Ökobilanz für jeden sinnvoll?
Das zu fordern, dafür reicht mein Sendungsbewusstsein nicht aus. Zudem kann es nicht jeder so machen, wie es Dirk Gratzel für sein Buchprojekt angegangen ist, das wäre ein zu großer Aufwand. Es gibt zwar im Internet relativ simple Rechner, die einem zumindest ein Grundgefühl für die eigene Bilanz geben. Aber diese Tools vereinfachen schon sehr stark: Fliege ich oder nicht, esse ich Fleisch oder nicht – die Komplexität des Lebens besteht ja eben darin, dass wir meistens zwischen den Ja- und Nein-Antworten stehen. Gut wäre daher eine App, die ein individuelles Tracking erlaubt. Das machen die Leute ja eh andauernd, zum Beispiel beim Sport. Da wäre eine Art Konsum-Tracking eine interessante Ergänzung. Denn: Die Zahlen zu sehen, löst bei dem einen oder anderen sicher etwas aus.
Liegen uns Menschen Bilanzen mehr als normative Appelle?
Ich glaube schon, ja. Ich habe aus dem Bauch heraus eine Sympathie für das moralische Pathos, mit dem zum Beispiel die Diskussion über das Klima geführt wird. Andererseits erreiche ich damit einige Menschen eben nicht. Die machen dicht, weil sie sich moralisch nicht in eine Ecke drängen lassen wollen – mit der Folge, dass sich die Gesellschaft in Gruppen spaltet, die dann gegeneinander agieren. Wir sehen es als Wissenschaftler als unsere Aufgabe an, Zahlen, Daten und Fakten bereitzustellen und das normative Element bewusst außen vor zu lassen. Denn das hilft hoffentlich, dass die Debatte freier und ehrlicher wird.
Inwiefern?
Wenn ich normativ argumentiere und Ihnen sage, Sie dürften kein Fleisch mehr essen oder keine Kurzstreckenflüge mehr buchen, dann lasse ich Sie nicht davonkommen und drücke Ihnen einen bestimmten Lebensstil auf. Eine Bilanz dagegen gibt Ihnen die Möglichkeit, selbstbestimmt an bestimmten Stellschrauben zu drehen. Sie könnten zum Beispiel Ihren Konsum generell reduzieren, oder Sie verzichten auf einige Sachen komplett, behalten anderes aber bei. Bilanzen geben Ihnen also mehr Gestaltungsspieltraum und lassen Raum für Individualität – wobei die Zahlen am Ende ganz nüchtern für sich sprechen.
Welche Rolle spielen Ökobilanzen in Unternehmen?
Hier sind ökologische Bilanzbetrachtungen schon länger etabliert, jedoch nicht so sehr in der Öffentlichkeit: 95 Prozent der Ökobilanzen in Unternehmen dienen primär dem internen Erkenntnisgewinn und werden nicht kommuniziert.
Weil sie so schlecht sind?
Eher, weil sie kompliziert zu kommunizieren sind. Eine Bilanz hat die Aufgabe, das gesamte Bild zu zeigen. Und dieses Bild ist fast nie Schwarz oder Weiß. Hat ein Unternehmen zum Beispiel zehn Umweltwirkungen analysiert, dann ist es häufig so, dass man zwar bei acht davon deutlich besser wird, bei zweien aber Rückschritte macht. Ein solches Ergebnis in einer Kultur zu kommunizieren, die über Twitter-Vereinfachungen funktioniert, ist nicht ganz einfach. Nehmen Sie als Beispiel die Frage, was ökologisch besser ist, ein Verbrenner- oder ein Elektroauto: Die Ökobilanz beantwortet diese Frage nicht mit entweder oder, auch wenn die Öffentlichkeit das gerne so hätte. Die Ökobilanz zeigt, unter welchen Herstellungs-, Nutzungs- oder Recyclingbedingungen die jeweilige Technologie ökologische Vor- oder Nachteile mit sich bringt.
Erkennen Sie, dass die Ökobilanzen der Unternehmen besser werden?
Auf jeden Fall, ja. In den Unternehmen wird seit vielen Jahren gehandelt – übrigens im Rahmen dessen, was wir Konsumenten nachfragen: Unternehmen haben heute in vielen Fällen ökologisch bessere Lösungen, und wie sehr sie diese in den Fokus stellen, liegt vor allem daran, wie gut sie im Markt funktionieren. Aber generell kann ich feststellen: Ja, die Unternehmen können immer noch mehr tun, aber führende Unternehmen sind in manchen Bereichen weiter als die Umweltpolitik.
Ich hielte es für sinnvoll, wenn jeder Wirtschaftswissenschaftler eine Lehrveranstaltung zu dem Thema belegen würde. Der Lerneffekt wäre groß – und er ist auch von Bedeutung, weil früher oder später jeder Wiwi- Absolvent mit diesem Thema konfrontiert werden wird.
Was denken Sie, bekommen Absolvent* innen der Wirtschaftswissenschaften im Studium genug Wissen über die Erstellung von Ökobilanzen mit?
Ich hielte es für sinnvoll, wenn jeder Wirtschaftswissenschaftler eine Lehrveranstaltung zu dem Thema belegen würde. Der Lerneffekt wäre groß – und er ist auch von Bedeutung, weil früher oder später jeder Wiwi-Absolvent mit diesem Thema konfrontiert werden wird. Ein Grundbriefing dafür, wie man ökologische Aspekte grundsätzlich bewertet und selbst Plausibilitätsbetrachtungen anstellt, wäre sinnvoll. Bei uns an der TU Berlin ist diese Lehrveranstaltung freiwillig, und wir merken, dass die Wiwis, die diese Veranstaltung besuchen, erstens Spaß daran haben und zweitens in den Prüfungen auch sehr gut abschneiden.
Was spricht dafür, die Ökobilanz eines Produktes oder einer Dienstleistung offen zu kommunizieren – und was spricht dagegen?
Natürlich ist es wichtig, den Konsumenten mit einer möglichst einfachen Zahl zu erreichen. Auf der anderen Seite ist es kaum machbar, die 10 bis 15 Kriterien, aus denen sich eine Ökobilanz zusammensetzt, lesbar und verständlich auf eine Packung zu bringen. Die Frage ist also, wie stark darf ich vereinfachen oder gewichten? Und da wird es heikel. Aktuell zum Beispiel spielen in der öffentlichen Diskussion Klimathemen eine dominierende Rolle. Kennzahlen zur Artenvielfalt, zur Bodenversauerung oder Wassernutzung haben es dagegen schwerer. Man würde daher dazu neigen, bei einer einfach zu kommunizierenden Ökobilanz der Klimakrise eine große Bedeutung zu geben, anderes dagegen bliebe unter dem Radar.
Haben Sie eigentlich persönlich nach der Erstellung der Ökobilanz von Dirk Gratzel entscheidende Dinge in Ihrem Leben verändert?
Na ja, in Maßen. Nicht so konsequent wie er, da sündige ich doch noch mehr. (lacht) Aber natürlich gibt es bei jeder Ökobilanz, die wir stellen, ob für einen Menschen, ein Unternehmen oder ein Produkt, einen Aha-Effekt. Wir lernen immer was dazu, es wird nie langweilig – und das macht diesen Bereich sehr interessant.
Ökobilanz eines Menschen
Die Geschichte der Ökobilanzschreibung für Unternehmen und Produkte begann in den 80er-Jahren; die erste Ökobilanz eines Menschen folgte fast vier Jahrzehnte später: Als Auftragsarbeit für das Buchprojekt von Dirk Gratzel erstellte das Team von Matthias Finkbeiner die Ökobilanz des Unternehmers. Gratzel schreibt über die Idee, die Bilanz und ihre Auswirkungen in seinem Buch: Dirk Gratzel: Projekt Green Zero. Mein konsequenter Weg zu einer ausgeglichenen Ökobilanz. Ludwig 2020. 18,00 Euro





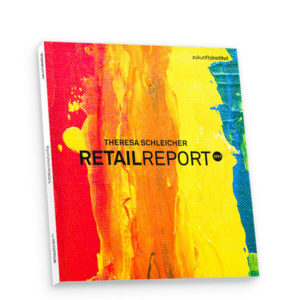 Der nächste Retail Report erscheint Ende 2021.
Der nächste Retail Report erscheint Ende 2021.
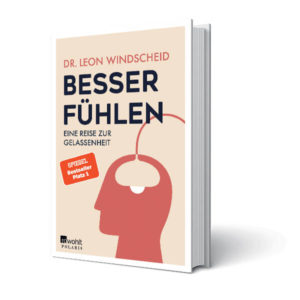 Leon Windscheid: Besser fühlen. Eine Reise zur Gelassenheit. Rowohlt 2021. 16,00 Euro Im Herbst geht Leon Windscheid mit seinem Programm „Altes Hirn, neue Welt“ auf Tour. Infos und Termine:
Leon Windscheid: Besser fühlen. Eine Reise zur Gelassenheit. Rowohlt 2021. 16,00 Euro Im Herbst geht Leon Windscheid mit seinem Programm „Altes Hirn, neue Welt“ auf Tour. Infos und Termine: 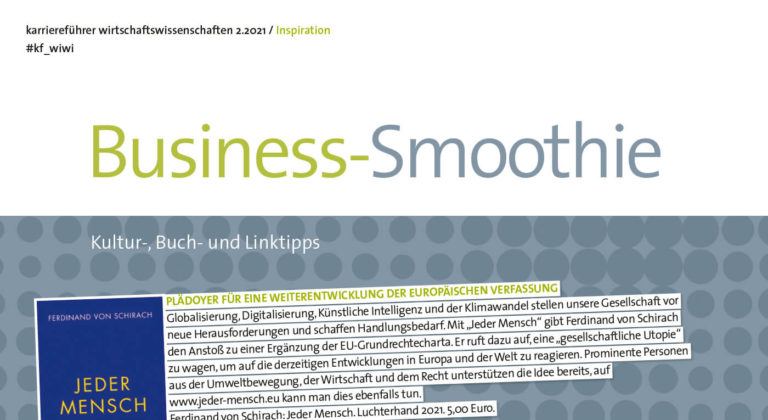
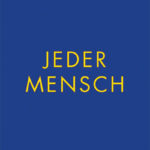
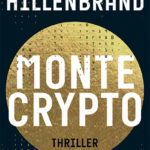
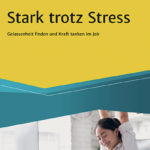
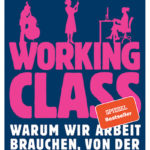
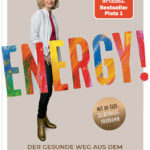
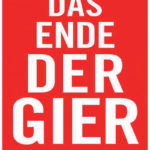





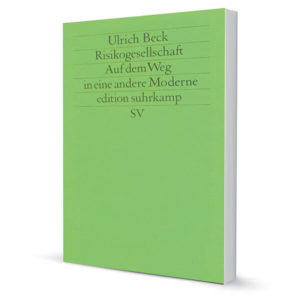 Der Soziologe Ulrich Beck hat sein wegweisendes Buch „Risikogesellschaft“ im Jahr 1986 geschrieben. Das Werk hat also einige Jahre auf dem Buckel, scheint heute aber aktueller denn je: Beck schreibt zum Beispiel über „naturwissenschaftliche Schadstoffverteilungen“ und meint damit, dass Ereignisse, die früher lokal bedrohlich wirkten, heute globale Folgen haben. 1986 dachte er an den Reaktorunfall in Tschernobyl, heute bietet die Pandemie das beste Beispiel. Beck analysiert die zentrale Rolle der Medien, die die Wahrnehmung der Krise prägen, und beschreibt den paradoxen Effekt, dass aus der permanenten Zunahme von Risiken eine Gleichgültigkeit erwächst: „Wo sich alles in Gefährdungen verwandelt, ist irgendwie auch nichts mehr gefährlich.“ Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp 1986.
Der Soziologe Ulrich Beck hat sein wegweisendes Buch „Risikogesellschaft“ im Jahr 1986 geschrieben. Das Werk hat also einige Jahre auf dem Buckel, scheint heute aber aktueller denn je: Beck schreibt zum Beispiel über „naturwissenschaftliche Schadstoffverteilungen“ und meint damit, dass Ereignisse, die früher lokal bedrohlich wirkten, heute globale Folgen haben. 1986 dachte er an den Reaktorunfall in Tschernobyl, heute bietet die Pandemie das beste Beispiel. Beck analysiert die zentrale Rolle der Medien, die die Wahrnehmung der Krise prägen, und beschreibt den paradoxen Effekt, dass aus der permanenten Zunahme von Risiken eine Gleichgültigkeit erwächst: „Wo sich alles in Gefährdungen verwandelt, ist irgendwie auch nichts mehr gefährlich.“ Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp 1986.

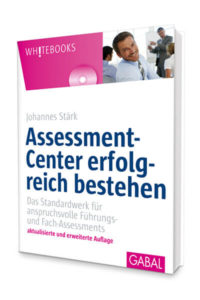


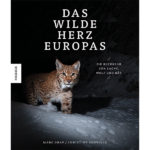
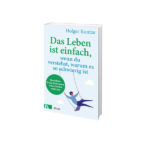
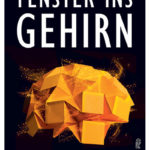
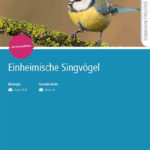


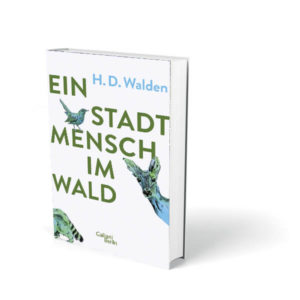 D. Walden: Ein Stadtmensch im Wald. Galiani Berlin 2021. ISBN: 978-3-86971-242-0. 14 Euro.
D. Walden: Ein Stadtmensch im Wald. Galiani Berlin 2021. ISBN: 978-3-86971-242-0. 14 Euro.