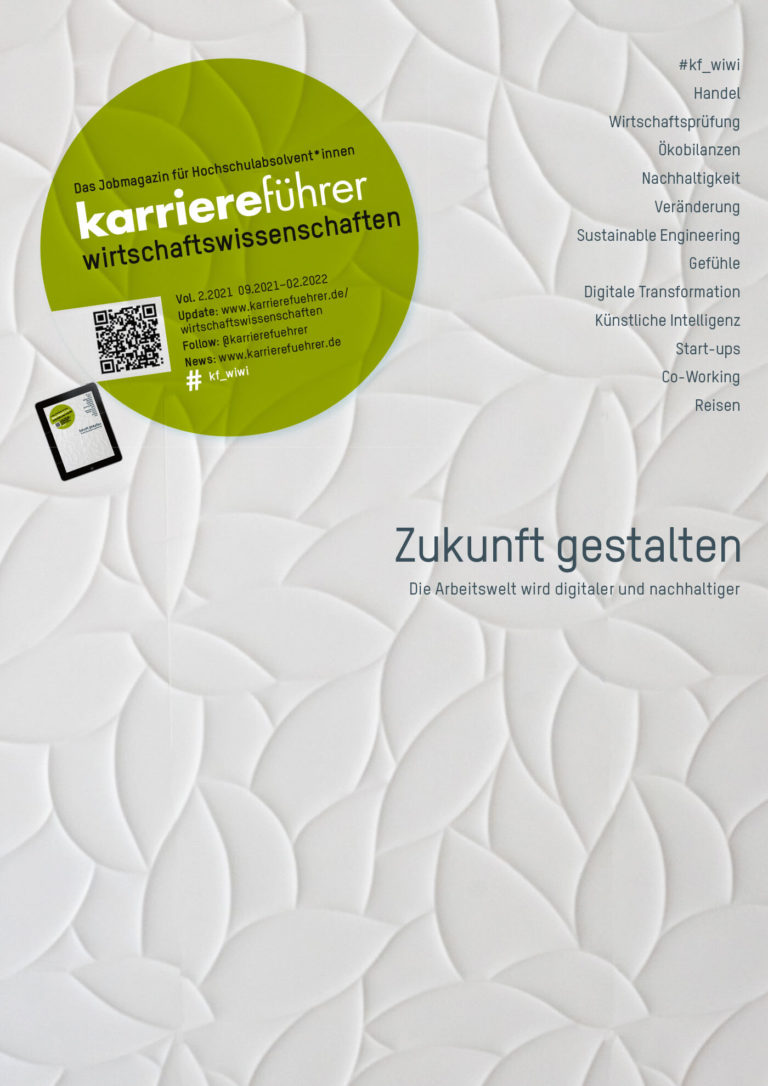Kontinuierliche Prüfungsprozesse, mit Künstlicher Intelligenz und Big Data, hohen Compliance-Standards und permanenter Vernetzung mit dem Mandanten: Die digitale Transformation definiert den Beruf des Wirtschaftsprüfers neu. Dabei ist weiterhin der Mensch gefragt: als Vertrauensgarant, Berater und Möglichmacher. Dass es aktuell an Nachwuchs mangelt, könnte sich bald ändern: Durch die steigende IT-Affinität gewinnt der Job an Attraktivität. Von André Boße.
Die Sache kippt im Jahr 2026. Dann, so schätzen Verantwortliche der 25 führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland, werden erstmals mehr Maschinen als Menschen Prüfungs-Dienstleistungen erbringen. Das ist das Ergebnis der aktuellen Marktstudie des Analyse- Unternehmens Lünendonk. Werden also in fünf Jahren keine Wirtschaftsprüfer*innen mehr benötigt? Die Antwortet lautet: doch! Aber andere. Den tiefgreifenden Wandel erkennt man auch daran, welche neuen Begriffe im Bereich der Wirtschaftsprüfung schon heute zum Alltagsvokabular zählen: Big Data Analytics und Process Mining, IT Audit und TaxTech – die Sprache in der Branche ändert sich. Auf die Industrie 4.0 folgt die Wirtschaftsprüfung 4.0: Zur Anwendung kommen vernetzte Systeme mit Künstlicher Intelligenz und Big Data. Was das konkret für die Arbeitsweisen- und inhalte bedeutet, macht Lünendonk-Geschäftsführer Jörg Hossenfelder deutlich:
„Der Wirtschaftsprüfer der Zukunft muss nicht nur die digitalen Geschäftsideen verstehen, sondern in diesen auch beraten. Er beherrscht den Jargon aus der IT-Branche und kann sein bestehendes Know-how in die digitale Welt übertragen.“ Wirtschaftsprüfer*innen werden damit zu Begleitern von Mandant*innen, deren Geschäftsbeziehungen sich komplett ändern. Für die Unternehmen werden aus Wertschöpfungsketten Netzwerke, die Intensität der notwendigen Kommunikation mit Partnern nimmt zu, geführt wird diese mit Hilfe digitaler, häufig vollautomatisierter Tools. „Dies alles führt zu einer immer engeren Verflechtung von Unternehmen und deren Lieferanten auf der einen Seite und Kunden auf der anderen“, beschreibt Jörg Hossenfelder den Wandel. Die Wirtschaftsprüfung erhält in diesem Geflecht ganz neue Aufgaben. Erstens arbeiten die Gesellschaften mit hoher Priorität daran, die Netzwerkstruktur der Mandant*innen mitzugestalten. Zweitens ergeben sich mit Blick auf diese Veränderungen „Fragen hinsichtlich Investitionen, Compliance und Cyber Security“, sagt Hossenfelder. Und, klar, die Prüfungen selbst stehen natürlich auch noch an.
„Causa Wirecard“: Kontrolle in der Komplexität
„Muss das denn alles sein?“, werden sich konservative Wirtschaftsprüfer fragen. Expert*innen sagen: Ja. Für diese notwendigen Schritte der Digitalisierung sprechen einmal die enormen Potenziale, mit Hilfe des Wandels Prozesse effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Doch diese simple Kosten-Nutzenrechnung darf heute nicht der einzige Grund sein, in der Wirtschaftsprüfung neue Wege zu finden. Was hinzu kommt: Die komplexe Gemengelage ruft nach neuen Formen der Kontrolle.
Es gab in den vergangenen Monaten nicht viele Ereignisse, die sich gegen das Dauerthema Pandemie durchsetzen konnten. Die „Causa Wirecard“ war eines davon. Abseits der gerichtlich zu entscheidenden Fragen über Schuld und Verantwortung zeigte sich, dass die turbodigitalisierte Wirtschaft mit ihren unzähligen internationalen Verflechtungen nach neuen Methoden verlangt, um sie wirksam durchleuchten zu können. Zumal weiterhin mit zusätzlichen regulatorischen Vorgaben zu rechnen ist, die eine höhere Compliance-Qualität nötig machen.
Eine Methode, auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Mandanten setzen, ist das „Continuous Auditing“, also eine Art kontinuierliche Abschlussprüfung. Was widersprüchlich klingt ergibt Sinn, wenn man sich genauer anschaut, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaftsprüfer und Mandant zuletzt gestaltet hat.
Eine Methode, auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Mandant* innen dabei setzen, ist das „Continuous Auditing“, also eine Art kontinuierliche Abschlussprüfung. Was widersprüchlich klingt (ein Abschluss kann eigentlich nicht kontinuierlich sein) ergibt Sinn, wenn man sich genauer anschaut, wie sich die Zusammenarbeit zwischen Wirschaftsprüfer* innen und Mandant*innen zuletzt gestaltet hat. „Der Druck auf Unternehmen, externe und interne Anforderungen einzuhalten, wächst stetig und erreicht in Unternehmen mit unterschiedlichen Standorten und ITSystemen eine herausfordernde Komplexität“, heißt es in einem Newsletter des Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen Rödl & Partner. Wichtig werden daher Methoden eines „Continuous Auditing & Control Monitoring“ (CACM), das kontinuierliches Risikomanagement gewährleistet. „Ziel des CACM ist es, permanent Transparenz über die Wirksamkeit von wichtigen KPIs und Kontrollen zu erreichen sowie Abweichungen in Echtzeit zu erkennen“, heißt es im Newsletter.
Darüber hinaus könne das CACM auch prüfungsunterstützend für die Interne Revision oder externe Prüfung dienen, um Prüfungsnachweise bereitzustellen oder den Umfang von Stichprobenprüfungen zu reduzieren. Ergänzt werde diese Effizienz durch ein gesteigertes Sicherheitsgefühl: „Fehler werden durch automatisierte Kontrollen sofort erkannt, definierte Personen automatisch informiert.“ Die CACM-Experten von Rödl & Partner geben an, dass auf diesem Wege „Einsparungen von bis zu 60 Prozent der Prozess-, Überwachungs- und Audit-Kosten“ keine Seltenheit seien. Zudem spare sich das Unternehmen eine Reihe von manuellen Tätigkeiten, um Informationen und Daten zu sammeln, aufzubereiten und zu analysieren.
Warum eigentlich 4.0?
Abgeleitet von der Industrie 4.0 lässt sich in vielen Bereichen beobachten, dass die dort formulierten Standards der vierten industriellen Revolution auch in anderen Sektoren zu Megatrends werden. So zum Beispiel auch in der Wirtschaftsprüfung. Kurz die Schritte von der ersten bis zur vierten Revolution:
1.0: Durch die Mechanisierung mit Hilfe von Dampf und Hydraulik blüht der Maschinenbau auf.
2.0: Die Elektrisierung ermöglicht den Aufbau moderner Fabriken mit Fließbandarbeit.
3.0: Speichermedien und EDV eröffnen das digitale Zeitalter.
4.0: IT-Systeme vernetzen sich intelligent miteinander.
Deutlich wird, dass sich die Rolle von Wirtschaftsprüfer* innen durch solche digitalen Methoden ändert. Das Continuous Auditing & Control Monitoring ist tief in der IT der Organisation verankert, es kommt daher auf ein enges Zusammenspiel zwischen der internen IT und den ITExpert* innen des Wirtschaftsprüfungsunternehmens an. Dort wieder gilt es, Know-how in Sachen IT und Wirtschaftsprüfungen so zusammenzubringen, dass bei den – zu Beginn vielleicht noch kritischen – Mandant*innen schnell der Nutzen der Umstellung deutlich wird. Entsprechend wichtig sind Leistungen wie Beratung und Begleitung der Prozesse – wobei gerade der Erfolg digitaler Transformationen davon abhängig ist, dass sich die Beteiligten Vertrauen.
Gleicher Personalbedarf, höhere Anforderungen
Diese Einschätzung deckt sich mit einer aktuellen Studie der Personalberatung Maxmatch für den Finanzbereich: Zwar gaben mehr als 80 Prozent der Befragten an, dass die Zahl der benötigten Mitarbeiter*innen trotz der digitalen Transformation konstant bleibt – dass also der Wandel weder dazu führt, dass weniger Leute gebraucht werden, noch dazu, dass der Personalbedarf sinkt. „Doch was sich für die Teamzusammenstellung eindeutig geändert hat, sind die Anforderungen, die Mitarbeiter erfüllen müssen“, heißt es in der Studie. „79,1 Prozent der Studienteilnehmer bestätigen, dass durch die digitale Transformation neue Kompetenzen von Mitarbeitern verlangt und erwartet werden.“ Als besonders wichtig eingeschätzt werden dabei Anwender-Kenntnisse in kollaborativen Technologien, Kenntnisse im Bereich Datenbanken sowie Erfahrungen im Umgang mit großen Datenmengen.
So klar die Herausforderungen für die befragten Verantwortlichen der Unternehmen aus dem Finanzbereich sind, so unklar ist, wie es gelingen soll, Nachwuchskräfte zu rekrutieren, die diese mitbringen. „Mehr als jeder Zweite der Umfrageteilnehmer bewertete die Suche nach Mitarbeitern mit den entsprechenden digitalen Kompetenzen als ‚schwer‘ oder ‚sehr schwer‘“, heißt es in der Studie. Ein Ergebnis, dass das Marktforschungsunternehmens SWI Finance in einer Befragung bestätigt: 86 Prozent aller befragten Steuerberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen – und sogar 95 Prozent der großen Kanzleien – sehen sich auch in diesem Jahr vor die kontinuierliche Herausforderung gestellt, qualifiziertes Personal zu finden.
Recruiting: IT-Affinität kommunizieren
Das Bild des Wirtschaftsprüfers, der sich aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch immer wiederholende Aufgaben und Tätigkeiten wühlt, ist überholt.
Was hilft? Ein anderes Image. Und auch das ergibt sich durch die digitale Transformation. Das Bild von Wirtschaftsprüfer* innen, die sich aufgrund gesetzlicher Vorschriften durch immer wiederholende Aufgaben und Tätigkeiten wühlen, ist überholt. „Kenner der Branche verbinden mit dem Berufsstand Eigenschaften wie abwechslungsreich, analytisch, attraktiv bezahlt und kommunikativ sowie krisensicher. Das Bild der Wirtschaftsprüfung in der heutigen Zeit ist deutlich vielfältiger, komplexer und anspruchsvoller geworden“, findet Jörg Hossenfelder von Lünendonk. Nun bringt dieses intern empfundene Image nichts, wenn der Wiwi-Nachwuchs es nicht auch so sieht – und sich für eine Karriere in diesem Bereich begeistern lässt. Hier sei es Aufgabe der Unternehmen und der Lehrenden an den Hochschulen, den jungen Interessierten zwei Dinge klarzumachen: Erstens sorge die Digitalisierung dafür, dass die Wirtschaftsprüfer* innen von einfachen, sich wiederholenden Tätigkeiten befreit werden – „was eine verstärkte Beschäftigung mit Sach- und Sonderthemen ermöglicht“, wie Jörg Hossenfelder es formuliert. Zweitens, dass es bei dieser Arbeit viel mehr IT-Kenntnisse ankommt, als man denken könnte.
Hier komme es auch auf die Art und Weise an, wie Hochschulen die kommenden Absolvent*innen auf das Examen und das anschließende Berufsleben vorbereiten: Fast neun von zehn Umfrageteilnehmer*innen der Lünendonk-Studie gaben bei der Umfrage an, dass sich in der internen Weiterbildung sowie der Vorbereitung auf das Wirtschaftsprüfungs- Examen etwas ändern müsse. Eine solche Zahl zeigt: Der Wandel ist im vollen Gange.
Was Wirtschaftsprüfungen bei der Digitalisierung bremst
Die Lünendonk-Studie hat Verantwortliche der größten Prüfungsgesellschaften gefragt, welche Hürden sie bei der digitalen Transformation als besonders restriktiv erachten.
Das Ergebnis:
- 91 Prozent halten die mangelnde Datenqualität ihrer Mandant*innen für einen Behinderungsfaktor.
- 67 Prozent sehen die Umsetzung des erlernten WP-Know-hows in automatisierte Prozesse als problematisch.
- 62 Prozent nennen die Zurückhaltung der Mandant*innen bei diesem Thema.
- 48 Prozent verweisen auf den strengen Datenschutz als Hürde.
Wirtschaftsprüfung digital: Was sich ändert…
- Algorithmen übernehmen Standard- und Routinetätigkeiten.
- Prüfungen sind nicht mehr an Zeiten und Orte gebunden, da Daten jederzeit über die Cloud abrufbar sind.
- Big Data-Methoden und automatisierte Audit Bots prüfen in hohem Tempo. riesige Datenmengen, sodass statt Stichproben Vollprüfungen möglich werden.
- Tools prüfen auch die Daten-Qualität der/des Mandant*in.
- Vorteil für Mandant*innen: Versteckte Verschwendungen und Potenziale werden aufgezeigt, Risiken minimiert.








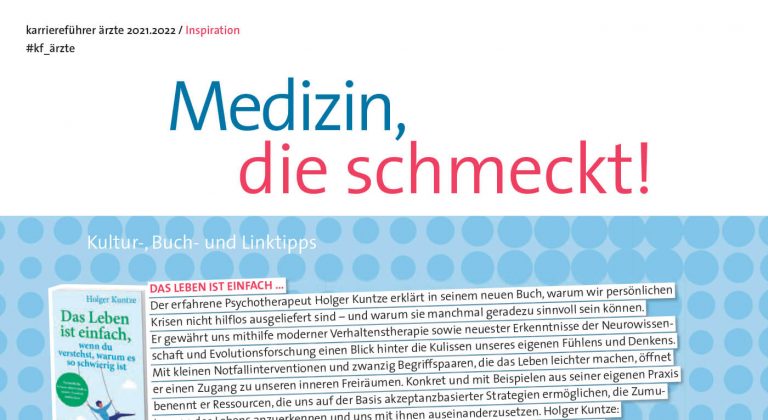
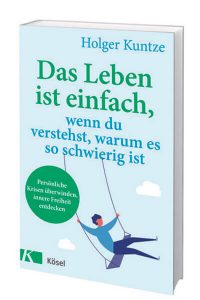 Der erfahrene Psychotherapeut Holger Kuntze erklärt in seinem neuen Buch, warum wir persönlichen Krisen nicht hilflos ausgeliefert sind – und warum sie manchmal geradezu sinnvoll sein können. Er gewährt uns mithilfe moderner Verhaltenstherapie sowie neuester Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Evolutionsforschung einen Blick hinter die Kulissen unseres eigenen Fühlens und Denkens. Mit kleinen Notfallinterventionen und zwanzig Begriffspaaren, die das Leben leichter machen, öffnet er einen Zugang zu unseren inneren Freiräumen. Konkret und mit Beispielen aus seiner eigenen Praxis benennt er Ressourcen, die uns auf der Basis akzeptanzbasierter Strategien ermöglichen, die Zumutungen des Lebens anzuerkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Holger Kuntze: Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist. Kösel 2021. 18 Euro.
Der erfahrene Psychotherapeut Holger Kuntze erklärt in seinem neuen Buch, warum wir persönlichen Krisen nicht hilflos ausgeliefert sind – und warum sie manchmal geradezu sinnvoll sein können. Er gewährt uns mithilfe moderner Verhaltenstherapie sowie neuester Erkenntnisse der Neurowissenschaft und Evolutionsforschung einen Blick hinter die Kulissen unseres eigenen Fühlens und Denkens. Mit kleinen Notfallinterventionen und zwanzig Begriffspaaren, die das Leben leichter machen, öffnet er einen Zugang zu unseren inneren Freiräumen. Konkret und mit Beispielen aus seiner eigenen Praxis benennt er Ressourcen, die uns auf der Basis akzeptanzbasierter Strategien ermöglichen, die Zumutungen des Lebens anzuerkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Holger Kuntze: Das Leben ist einfach, wenn du verstehst, warum es so schwierig ist. Kösel 2021. 18 Euro.
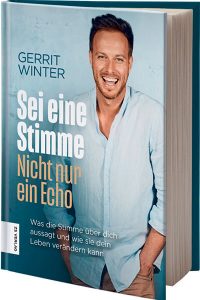 Starke Stimme – starker Auftritt: Unsere Stimme ist der Spiegel unserer Seele. Sie hat großen Einfluss darauf, wie unsere Umwelt uns wahrnimmt. Habe ich überhaupt eine Stimme? Was habe ich der Welt zu sagen? Wie verschaffe ich mir Gehör? Wer bin ich? Was sagt meine innere Stimme? Der Musikwissenschaftler, Theologe und Coach Gerrit Winter macht in seinen Trainings den Menschen ihre schlummernden Fähigkeiten bewusst und birgt lange vergessene Potenziale. Gerrit Winter: Sei eine Stimme, nicht nur Echo. ZS-Verlag 2021. 16.99 Euro.
Starke Stimme – starker Auftritt: Unsere Stimme ist der Spiegel unserer Seele. Sie hat großen Einfluss darauf, wie unsere Umwelt uns wahrnimmt. Habe ich überhaupt eine Stimme? Was habe ich der Welt zu sagen? Wie verschaffe ich mir Gehör? Wer bin ich? Was sagt meine innere Stimme? Der Musikwissenschaftler, Theologe und Coach Gerrit Winter macht in seinen Trainings den Menschen ihre schlummernden Fähigkeiten bewusst und birgt lange vergessene Potenziale. Gerrit Winter: Sei eine Stimme, nicht nur Echo. ZS-Verlag 2021. 16.99 Euro.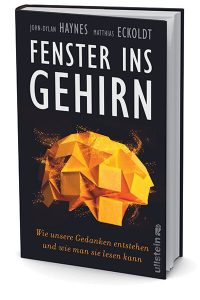 Zu wissen, was im Kopf des Gegenübers vor sich geht, ist seit jeher eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Tatsächlich kann die Forschung bereits Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen. Der Neurowissenschaftler und Psychologe John-Dylan Haynes hat es geschafft, verborgene Absichten in den Hirnen seiner Probanden zu entschlüsseln. Aus seiner Forschung ergeben sich provokante Fragen: Sind unsere Gedanken wirklich so frei und sicher wie wir glauben? Oder wird man irgendwann per Gehirnscan unsere Wünsche und Gefühle oder gar unsere PINs auslesen können? Kann die Werbung unsere Hirnprozesse gezielt beeinflussen? Haben wir überhaupt einen freien Willen oder sind unsere Entscheidungen durch unser Gehirn vorherbestimmt? John-Dylan Haynes und Matthias Eckoldt zeigen, was heute schon möglich ist, und worauf wir uns in den kommenden Jahren einstellen sollten. John-Dylan Haynes und Matthias Eckoldt: Fenster ins Gehirn. Ullstein 2021. ISBN 978-3-550-20003-8. 24 Euro.
Zu wissen, was im Kopf des Gegenübers vor sich geht, ist seit jeher eine tiefe Sehnsucht des Menschen. Tatsächlich kann die Forschung bereits Gedanken aus der Hirnaktivität auslesen. Der Neurowissenschaftler und Psychologe John-Dylan Haynes hat es geschafft, verborgene Absichten in den Hirnen seiner Probanden zu entschlüsseln. Aus seiner Forschung ergeben sich provokante Fragen: Sind unsere Gedanken wirklich so frei und sicher wie wir glauben? Oder wird man irgendwann per Gehirnscan unsere Wünsche und Gefühle oder gar unsere PINs auslesen können? Kann die Werbung unsere Hirnprozesse gezielt beeinflussen? Haben wir überhaupt einen freien Willen oder sind unsere Entscheidungen durch unser Gehirn vorherbestimmt? John-Dylan Haynes und Matthias Eckoldt zeigen, was heute schon möglich ist, und worauf wir uns in den kommenden Jahren einstellen sollten. John-Dylan Haynes und Matthias Eckoldt: Fenster ins Gehirn. Ullstein 2021. ISBN 978-3-550-20003-8. 24 Euro.
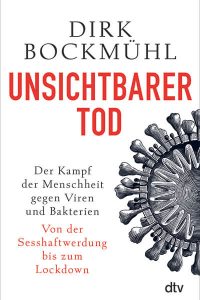 Am Anfang war der Lockdown: Menschen wurden sesshaft, Tiere gesellten sich zu ihnen. Das war praktisch. Aber tödlich. Weil sich unsere Vorfahren das Sterben nicht erklären konnten, suchten sie Antworten bei den Göttern. So entstanden religiöse Hygiene- und Nahrungsvorschriften. Man fand heraus, welchen Wert saubere Straßen, frisches Wasser, gut belüftbare Wohnungen besaßen, man entdeckte die Keime und das Penicillin. Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie, nimmt uns mit auf einen faszinierenden Streifzug durch die Geschichte der Zivilisation, der Religionen, der Architektur, der Medizin und der Wissenschaften. Er erzählt eine Geschichte ohne Ende, ein wesentliches Kapitel schreiben wir alle gerade selbst … Dirk Bockmühl: Der unsichtbare Tod. Dtv 2021. ISBN 978-3-423-28304-5. 24 Euro.
Am Anfang war der Lockdown: Menschen wurden sesshaft, Tiere gesellten sich zu ihnen. Das war praktisch. Aber tödlich. Weil sich unsere Vorfahren das Sterben nicht erklären konnten, suchten sie Antworten bei den Göttern. So entstanden religiöse Hygiene- und Nahrungsvorschriften. Man fand heraus, welchen Wert saubere Straßen, frisches Wasser, gut belüftbare Wohnungen besaßen, man entdeckte die Keime und das Penicillin. Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie, nimmt uns mit auf einen faszinierenden Streifzug durch die Geschichte der Zivilisation, der Religionen, der Architektur, der Medizin und der Wissenschaften. Er erzählt eine Geschichte ohne Ende, ein wesentliches Kapitel schreiben wir alle gerade selbst … Dirk Bockmühl: Der unsichtbare Tod. Dtv 2021. ISBN 978-3-423-28304-5. 24 Euro.
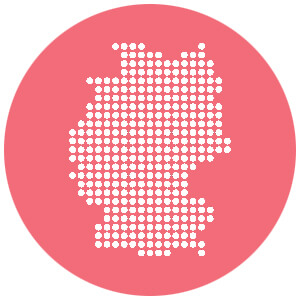

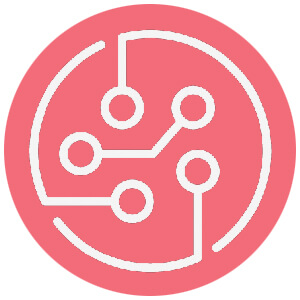






 Nach dem Vorbild amerikanischer Business Schools beruht der
Nach dem Vorbild amerikanischer Business Schools beruht der