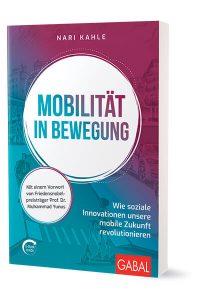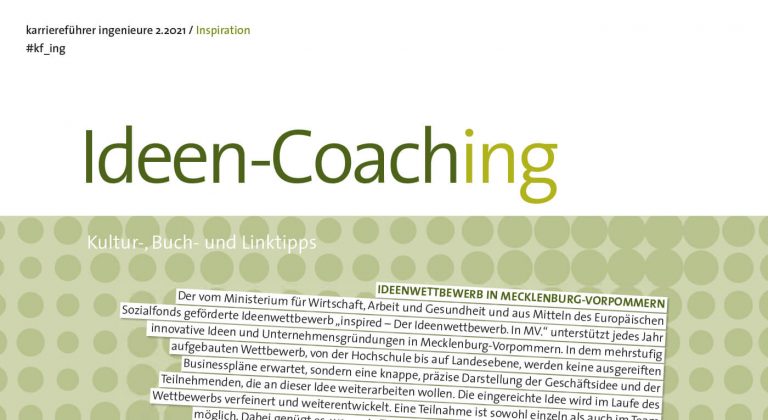Der Ingenieurberuf steht vor einem bahnbrechenden Wandel. Selbstbewusst und mit hoher Kompetenz stellen sich Ingenieur*innen der Aufgabe, Innovationen voranzutreiben und das Wirtschaftssystem nachhaltiger zu machen. Die Kraft dafür finden sie in der Tiefe ihres Wissens und in ihren Denkstrukturen. Denn wenn technische Kompetenz zu einem führt, dann zu dem Talent, zu jeder Zeit die Lösung im Blick zu haben. Ein Essay von André Boße
An der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg sollen die Studierenden im Studiengang Maschinenbau und Produktion ihre Kenntnisse künftig direkt auf die Straße bringen. „Digital Engineering & Mobility“ heißt eine neue Studienrichtung, das Ziel formuliert die Hochschule in einer Pressemeldung wie folgt: „Innovative Lösungen für reale Aufgabenstellungen zu erarbeiten“. Das klingt zunächst einmal nicht revolutionär, schließlich ließe sich das Job-Profil von Ingenieur*innen genau so beschreiben. Neu jedoch ist, dass bereits Bachelorstudierende sehr konkret dazu angeleitet werden, Produkte im Zukunftsfeld der digitalen Mobilität zu entwickeln. „Mit der neuen Studienrichtung bilden wir Ingenieur*innen aus, die mobile und digitalisierte Produkte verstehen und gestalten wollen – samt den zugehörigen Prozessen und Systemen“, wird Tankred Müller, Professor für Elektrotechnik an der HAW, in der Pressemitteilung zitiert. Sein Kollege Dr. Hans-Joachim Schelberg, Professor für Produktentwicklung, ergänzt: „Im Studium stehen für uns drei Aspekte im Vordergrund: Praxisbezug, Kreativität und Innovationsfreude.“
Wissen in die Anwendung bringen
Richtig gelesen: Die Theorie hat Professor Schelberg nicht mit in die Aufzählung genommen. Zwar gebe es selbstverständlich auch weiterhin klassische Lehrangebote, darüber hinaus aber nehmen die Studierenden an interdisziplinären Projekten teil und bekommen professionelle Werkzeuge für die Projektplanung an die Hand. „Um die digitale Zukunft des Maschinenbaus zu gestalten, sind fundierte Kenntnisse in Robotik und künstlicher Intelligenz ebenso erforderlich wie das nötige Know-how im Bereich der Entwicklung und Anwendung“, heißt es in der Meldung der HAW. Diese Kompetenzen sollen in der neuen Studienrichtung vermittelt werden – und zwar mit Blick auf sehr konkrete Anwendungsfälle: „Man denke nur an elektrische Fahrzeuge für den Transport von Menschen und Waren, die speziell auf den Einsatz in Städten zugeschnitten sind – emissionsarm und über digitale Servicesysteme flexibel verfügbar“, nennt Tankred Müller ein Szenario. Auch „schwarmfähige mobile Service-Roboter, die künftig unsere Grünflächen pflegen“ oder „Roboter, die technische Systeme autonom warten“ schweben den Verantwortlichen des neuen Studiengangs vor. Keine Frage: Hier blickt der Maschinenbau in die Zukunft – und zeigen die Ingenieurwissenschaften,, worauf es heute und in den kommenden Jahren ankommen wird: Gesucht sind Macher*innen, die mit ihrem fachlichen und interdisziplinären Know-how die technische Zukunft mitgestalten. Als Ingenieur*innen, Projektmanager* innen, Unternehmer*innen.
Lange galt das Thema Nachhaltigkeit in erster Linie als Kostentreiber, mit dem sich höchstens Imagegewinne erzielen ließen. Doch das ändert sich gerade.
Dass für Ingenieur*innen die Zeit für Gründungen, in Top-Positionen oder als CEOs gekommen ist, daran glaubt Henning Groß, Ingenieur mit Schwerpunkt Technische Informatik und Managing Director des Technik-Consulting-Unternehmens Zeile Sieben. Nach beruflichen Erfahrungen in technischen Unternehmen wie VW sowie in einem Medienkonzern, wo er Digitalisierungsprozesse verantwortete, arbeiten er und seine Agentur zusammen mit den Kunden daran, neue Strukturen zu schaffen und somit Prozesse in den Bereichen Digitale Transformation, New Leadership oder New Work umzusetzen. Was er dabei beobachtet: Themen, die noch vor wenigen Jahren ein „nice to have“ waren, sind heute „Schlüssel-Enabler für unternehmerischen Erfolg“. Das zeige sich insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit: Lange galt das Thema in erster Linie als Kostentreiber, mit dem sich höchstens Imagegewinne erzielen ließen. „Es schien“, sagt Henning Groß, „aufgrund seiner idealistischen Ideen sogar im Widerspruch zu kapitalistischen Werten zu stehen, also zum Streben nach Gewinn.“ Doch das ändere sich gerade. Groß: „Unternehmen verstehen, dass es ökologisch, aber auch ökonomisch nicht nachhaltig ist, immer mehr oberflächliche Produkte zu launchen, die niemals in die Tiefe gehen und deren Wertschöpfung begrenzt ist.“
Ingenieur*innen besser im Management?
Für diese Tiefe sowie für eine nachhaltige Wertschöpfung können Ingenieur*innen sorgen. „Wir erleben aktuell eine Renaissance von erfolgreichen Unternehmen, die von Technikern, Ingenieuren und Wissenschaftlern gegründet und geführt werden“, sagt Henning Groß. Über Jahrzehnte habe das abgenommen: „Obwohl die Firmenhistorie vieler großer Unternehmen zurückgeht auf Menschen, die erfinderisch und begeistert Probleme gelöst und die Lösung in Produkte überführt haben, haben wir lange angenommen, ein BWL-Studium sei eine bessere Qualifikation für eine Firmengründung als die Begeisterung für ein Thema, für Probleme und deren Lösung.“ Dabei sei dies doch die Grundlage, die offensichtlich zum Erfolg führe. „Ich bin daher überzeugt, dass wir mehr Ingenieure in der ersten Reihe sehen werden, dass die Business-Profis dabei als Enabler der Unternehmensführung fungieren – und dass diese Struktur zu mehr Nachhaltigkeit beitragen wird.“
Was Ingenieur*innen mit Blick auf die großen Herausforderungen dieser Zeit auszeichnet? „Wir sind es gewohnt, das wichtigste und kritischste Problem zu priorisieren, zu isolieren und: zu lösen“, sagt Henning Groß. Das klinge trivial, beinhalte aber die Fähigkeit, „alles andere auszublenden, sich wirklich in ein Problem zu vertiefen, immer wieder zu scheitern – dabei aber nicht den unbedingten Glauben daran zu verlieren, dass es am Ende doch eine Lösung gibt“. Was Ingenieur*innen auch beherrschten: Die Kunst, Probleme zur Seite zu legen – um sie später wieder aufzunehmen. Das, sagt Henning Groß, helfe ihm, dem Ingenieur, beim Management seiner Agentur: „Ich bearbeite an einem Tag bis zu 80 verschiedene Themen. Das sind eine Menge Kontextwechsel, das erfordert eine hohe Taktung. Wie priorisiere ich ein Thema, wie viel Zeit investiere ich, wann muss ich es abschließen, und an welcher Stelle delegiere ich es weiter – die Antworten auf solche Fragen sind in meiner vom Ingenieurdenken geprägten Gehirnarchitektur modelliert. Und ich bin überzeugt: Das macht mich zu einem deutlich besseren Manager.“
Neue Zielsysteme für die Wirtschaft
Welche Kompetenzen müssen technische Fachkräfte auf- und ausbauen, um in Wirtschaft oder Forschung ihre Stärken einzubringen? Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat aktuell unter dem Titel „Automation 2030: Zukunft gestalten – Szenarien und Empfehlungen“ eine Publikation veröffentlicht, die sehr konkret die zentralen Fähigkeiten beschreibt – nicht mit Blick auf individuelle Karrieren, sondern auf die gesellschaftliche Wirksamkeit. Wobei beides gerade für die junge Generation Hand in Hand geht. Grundlage der Handlungsempfehlungen für Ingenieur*innen ist dabei laut VDI die Feststellung, dass „Erfolge und Verdienste der Vergangenheit immer weniger ein Garant für den Erfolg von morgen“ seien, wie es in der Studie heißt. Der Appell der Autor*innen an die Ingenieurgeneration: „Wir müssen neue Zielsysteme für die Wirtschaft erarbeiten.“ Diese seien nötig, denn: „Wirtschaftliche Systeme dauerhaft nach den Prinzipien der minimalen Kosten und des maximalen kurzfristigen Profits auszurichten, erweist sich gerade in diesen Zeiten als wertfreie und nicht nachhaltige Handlungsmaxime.“
Gefragt sind technische Macher*innen und Manager*innen, die das Lösen der Probleme in den Fokus nehmen – und daraus Innovationen, Geschäftsmodelle und nachhaltige Unternehmensstrategien ableiten.
Der VDI macht klar: Die Ingenieur*innen sind gefordert, die Wirtschaft zu wandeln. Gelingen soll dies auf Grundlage von sechs Kompetenzen (siehe Kasten oben), die – verbunden mit Handlungsempfehlungen – „in Summe den gewünschten Zustand einer stabilen und gleichzeitig innovativen und agilen Wirtschaft Deutschlands erreichen“. Was der VDI mit diesem Positionspapier fordert: Ingenieur*innen, die neu denken, die sich einbringen, die dabei auf ihre Fähigkeiten als Treiber einer neuen Wirtschaft setzen und bereit sind, sich in der Lehre und Förderung weiterzuentwickeln. Studierende, Absolvent*innen und Nachwuchskräfte sollten sich daher auf ein ganz neues Arbeitsumfeld vorbereiten: Gefragt sind technische Macher*innen und Manager*innen, die das Lösen der Probleme in den Fokus nehmen – und daraus Innovationen, Geschäftsmodelle und nachhaltige Unternehmensstrategien ableiten. Der Anspruch an diese neue Ingenieurgeneration ist hoch. Ihr Selbstbewusstsein sollte es auch sein: Gesellschaft und Wirtschaft benötigen in diesen komplexen Zeiten genau das, was Ingenieur*innen können.
Klimaschutz macht Kunden froh
Einen Zusammenhang zwischen technischen Maßnahmen zum Klimaschutz und Kundenzufriedenheit stellt eine Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Deloitte her. Für den „Climate Check Pulse Survey“ wurden Anfang 2021 insgesamt 750 Führungskräfte in 13 Ländern befragt, darunter 50 in Deutschland. Dabei macht das Top-Managment mehrheitlich die Aussage, dass sich durch Bemühungen der Unternehmen um den Klimaschutz die Kundenzufriedenheit verbessert hat, heißt es in einer Pressemitteilung zur Studie. Auch Profitabilität und Umsatzwachstum entwickelten sich als Folge der Nachhaltigkeitsbemühungen positiv: Fast die Hälfte der Unternehmen habe dank dieser Initiativen eine Verbesserung der Finanzkennzahlen festgestellt, in Deutschland lag der Anteil bei 60 Prozent. „Unsere Studie zeigt, dass Unternehmen mit effizienten Nachhaltigkeitsinitiativen nicht nur ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und den Erwartungen ihrer Kunden gerecht werden, sondern auch einen langfristigen, finanziell messbaren Mehrwert schaffen“, wird Volker Krug, CEO Deloitte Deutschland, zitiert.
Klimaneutrales Deutschland: Fünf Jahre früher
Eine Studie der drei Klimaschutzorganisationen Stiftung Klimaneutralität, Agora Energiewende und Agora Verkehrswende kommt zu dem Schluss, dass Deutschland seine für 2050 gesteckten Klimaziele fünf Jahre früher erreichen könnte, um somit bis 2045 treibhausgasneutral zu werden. Das Gutachten mit dem Titel „Klimaneutrales Deutschland 2045“ zeige laut einer Pressemeldung, dass ein um fünf Jahre vorgezogenes Zieljahr knapp eine Milliarde Tonnen CO2-Emissionen einsparen würde. Voraussetzung: Klimaschutztechnologien wie Energieeffizienz, Erneuerbare Energien, Elektrifizierung und Wasserstoff müssten noch schneller hochgefahren werden. „Die globalen Leitmärkte in Nord-Amerika, Europa und Asien orientieren sich jetzt alle am Leitbild der Klimaneutralität. Wenn die deutsche Industrie der Technologielieferant für die Welt in Sachen Klimaneutralität sein will, muss sie der Entwicklung in anderen Ländern immer ein Stück voraus sein“, sagt Patrick Graichen, Direktor von Agora Energiewende.
Automation 2030: Sechs wichtige Kompetenzen
1 Emotionale Kompetenz: „Veränderungen sind nötig. Seien wir offen für neue Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft. (…) Nutzen wir unser Wissen und seien wir stolz darauf, schneller und besser zu sein.“
2 Technologische Kompetenz: „Nutzen wir alle zugänglichen Informationen und Technologien konsequent. (…) Offenheit von Anfang an erlaubt lebenslange Flexibilität.“
3 Geschäftsmodell-Kompetenz: „Nutzen wir unseren Wissensvorsprung aktiv. Entwickeln und realisieren wir innovative Geschäftsmodelle, die sich im Lebenszyklus weiterentwickeln und Daten produktiv nutzen.“
4 Forschungs- und Entwicklungskompetenz: „Entwickeln wir die vier Enabler ‚Modularität‘, ‚Konnektivität‘, ‚digitaler Zwilling‘ und ‚Autonomie‘ zielgerichtet und gestalten sie.“
5 Organisatorische Kompetenz: Schaffen wir ein innovatives Umfeld und messen wir unsere Organisationen daran, dass sie zügiges Handeln ermöglichen, risikobehaftete Entscheidungen zulassen und angemessene Freiräume einrichten.“
6 Personelle Kompetenz: „Entwickeln wir Spitzen-Führungskräfte – durch (…) attraktive Studiengänge, ständige Weiterbildungsanstrengungen sowie eine systematische Förderung und Forderung. Toptechnologie erreichen wir nur mit gut ausgebildeten Fachkräften.“
Quelle: VDI: „Automation 2030 – Zukunft gestalten: Szenarien und Empfehlungen“, April 2021