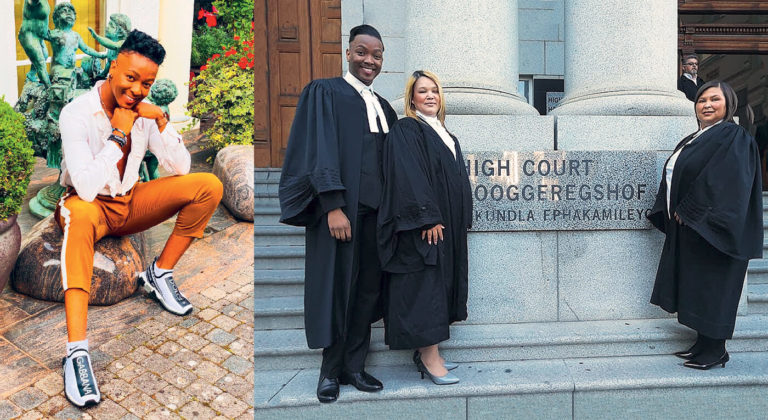LegalTech, NewLaw, neue Business Cases: Im Zuge der Digitalisierung fächert sich der Rechtsmarkt auf, angetrieben wird die Entwicklung durch die Folgen der Pandemie. Gewohnte Abläufe verlieren an Bedeutung. Was zählt, sind neue Konzepte und Abrechnungsmodelle. Für die junge Generation ergeben sich Chancen, vor allem dann, wenn ihre digitalen Kenntnisse zu einem Wissens- und Erfahrungsvorsprung führen. Ein Essay von André Boße
„Business as usual“? Klingt nach gepflegter Langeweile. Wer „business as usual“ betreibt, gehört zwar nicht zu den Innovationsführern, doch steht der Ansatz in einem gewissen Maße für Stabilität. Gerade in einer Branche wie dem Rechtsmarkt, in der Veränderungen mit Blick auf die Arbeitskultur sowie die Geschäftsmodelle der Kanzleien lange Zeit eher vorsichtig angegangen wurden. Nun aber beginnt der „Future Ready Lawyer 2021“-Report des Informationsdienstleisters Wolters Kluwer mit folgender Formulierung: „Für viele Juristen wurde im Jahr 2020 ‚Business as usual‘ zu einem Überlebenskampf.“
Ausschlaggebend dafür sei, schreiben die Studienautoren, die Pandemie gewesen, die den generellen Megatrend der Digitalen Transformation zusätzlich befeuert habe. Den Wandel hätte es auch ohne das Corona-Virus gegeben. Mit ihm hat er sich mit einem Tempo und einer Radikalität vollzogen, die der Rechtsmarkt so bislang nicht kannte. „Es galt, die Organisationen im Rechtsmarkt durch nie dagewesene Zeiten zu steuern – von der Krise und der Reaktion darauf bis zur Erholung“, heißt es in der Studie. Jetzt, im Herbst 2021, müssten sich die Organisationen auf ein neues „Business as usual“ einstellen. Wobei der Trend wohl eher dahin geht, dass die Ungewöhnlichkeit permanent bleibt.
Digitalisierung beherrscht Komplexität
Wie das aussieht? Der Report skizziert Punkte, die ab jetzt eine zentrale Bedeutung besitzen. Für die Anwält*innen kam es darauf an, „mithilfe von Technologien die Leistungserbringung aufrecht zu erhalten, um vom Home-Office aus Remote mit Mandanten, Kollegen und den Gerichten zu interagieren.“ Dabei habe die Krise verdeutlicht: „Technische Lösungen sind für die Belastbarkeit der Organisation und den Service für Mandanten unabdingbar.“ Sprich: Die Digitale Transformation der Kanzleien folgt keinem Selbstzweck und keinem Zukunftsplan –, sondern ist hier und heute die Voraussetzung dafür, die Qualität der juristischen Beratung und Dienstleistung aufrecht zu erhalten. „Experten sehen den digitalen Wandel und die Technologie als Haupttreiber für eine verbesserte Leistungserbringung“, heißt es in der Studie. Die Rechtsbranche werde daher weiter in technologische Lösungen investieren sowie diese stärker nutzen.
Legal Tech und das Anwaltsmonopol
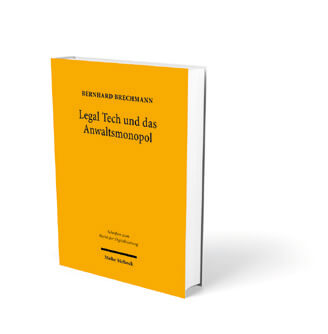 Legal Tech ist in aller Munde. Die Möglichkeit des Einsatzes von Legal Tech wirft dabei vor allem die Frage auf, ob Rechtsdienstleistungen weiterhin primär nur durch Rechtsanwälte erbracht werden dürfen. Diese Fragestellung wurde bisher allein mit Blick auf die Regelungen im deutschen Recht betrachtet. Bernhard Brechmann untersucht hingegen die Zulässigkeit des Einsatzes von Legal Tech im europäischen und internationalen Kontext. Denn im Gegensatz zu Deutschland kennt eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU kein entsprechendes Anwaltsmonopol für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Frage ist daher, ob diese ausländischen Vorschriften in Deutschland zur Anwendung gebracht werden können. Bernhard Brechmann: Legal Tech und das Anwaltsmonopol. Mohr Siebeck 2021, 80 Euro.
Legal Tech ist in aller Munde. Die Möglichkeit des Einsatzes von Legal Tech wirft dabei vor allem die Frage auf, ob Rechtsdienstleistungen weiterhin primär nur durch Rechtsanwälte erbracht werden dürfen. Diese Fragestellung wurde bisher allein mit Blick auf die Regelungen im deutschen Recht betrachtet. Bernhard Brechmann untersucht hingegen die Zulässigkeit des Einsatzes von Legal Tech im europäischen und internationalen Kontext. Denn im Gegensatz zu Deutschland kennt eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU kein entsprechendes Anwaltsmonopol für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Frage ist daher, ob diese ausländischen Vorschriften in Deutschland zur Anwendung gebracht werden können. Bernhard Brechmann: Legal Tech und das Anwaltsmonopol. Mohr Siebeck 2021, 80 Euro.
Dass viele Kanzleien dabei vor einer großen Herausforderung stehen, zeigen zwei zentrale Kennzahlen der Studie. Befragt wurden 700 Jurist*innen aus neun europäischen Ländern und den USA nach den für sie bedeutsamsten Trends der kommenden drei Jahre? Die „steigende Bedeutung von ,Legal Technology’“ sowie die „Bewältigung zunehmender Informationsmengen und Komplexität“ erhalten mit jeweils 77 Prozent die höchste Zustimmung. Das Problem: Nur 33 Prozent der Befragten halten ihre Organisation für „sehr gut“ auf die „steigende Bedeutung von ,Legal Technology’“ vorbereitet, nur 32 Prozent fühlen sich „sehr gut“ auf die „Bewältigung zunehmender Informationsmengen und Komplexität“ vorbereitet. Zu wissen, was wichtig wird – aber zu glauben, hier noch nicht optimal aufgestellt zu sein: Der Report zeigt deutlich, dass der Wandel des Rechtsmarkts für die Kanzleien anspruchsvolle Aufgaben mit sich bringt.
Die papierlose Kanzlei
Ein Blick in eine Organisation, die von sich selbst sagt, „vollständig durchdigitalisiert“ zu sein. Renz Schuhknecht Baumann mit Sitz in Stuttgart ist eine interdisziplinäre, stark auf Steuer- und juristische Wirtschaftsberatung ausgerichtete Kanzlei. Sowohl im steuerlichen als auch im anwaltlichen Bereich erfolge die Aktenführung komplett digital, sagt Michael Renz. „Alle in die Kanzlei eingehenden Dokumente werden – sofern sie uns nicht ohnehin schon digital erreichen – digitalisiert.“ Lediglich ein kleiner Auszug davon – nämlich, soweit er für Gerichtstermine relevant ist – werde zusätzlich als herkömmliche Papierakte geführt. „Das ist wegen der schlechten digitalen Anbindung der Gerichte leider auch heute noch notwendig.“ Die Kanzlei nutzt dabei das Portfolio des Software-Entwicklers und IT-Dienstleisters DATEV, der gezielt für die Arbeit von Jurist*innen und Steuerberater*innen digitale Lösungen konzipiert.
Das Unternehmen ist als Berufsgenossenschaft organsiert, rund 40.000 Rechtsanwält*innen, Steuerberater*innen oder Wirtschaftsprüfer*innen sind Mitglied. Michael Renz ist als stellvertretender Vorsitzender des DATEV-Vertreterrats mit dafür verantwortlich, den Unternehmensvorstand aus Sicht der Anwenderschaft zu beraten. Es ermöglicht, die gesamte Korrespondenz mit anderen Kanzleien, Notar*innen oder Gerichten komplett zu digitalisieren, „in diesem Bereich verlässt unser Büro kein Stück Papier mehr“, sagt Michael Renz. Dazu nutze die Kanzlei im anwaltlichen Bereich das Tool einer „juristischen Textanalyse“, das zum Beispiel bei aufwändigen Due-diligence-Verfahren für Effizienz sorgt.
Kreative Tätigkeiten statt Fleißarbeit
Bei solchen Prozessen zeigten sich die direkten Vorteile der Digitalisierung, doch Michael Renz glaubt, der „wirkliche Nutzen“ zeigte sich nur dann, „wenn auch die Randbereiche digital aufgestellt sind“. Diktat-Software, digitale Telekommunikation über CTI, elektronische Arbeitszeiterfassung, Gebührenrechner, datenschutzkonforme Videokonferenz-Systeme – der Stand der Digitalisierung hängt von vielen Elementen ab. Für die Kanzlei zahlte sich das aus: Innerhalb von drei Tagen sei es gelungen, die komplette Belegschaft ins Homeoffice „auszulagern – und dies im ersten Lockdown für drei und im zweiten Lockdown für acht Monate aufrecht zu erhalten“, sagt Michael Renz – und verweist darauf, dass der Nutzen deutlich größer sei als die Nebenwirkungen der Digitalisierung.
Stichwort Security? „Ich bin überzeugt, dass der größte Sicherheits-Schwachpunkt der Digitalisierung menschlichen Ursprungs ist“, sagt Michael Renz. „Wir legen daher großen Wert darauf, unsere Belegschaft im Umgang mit der EDV zu schulen und das Problembewusstsein für mögliche Angriffsszenarien zu schärfen.“ Thema Update-Wahnsinn? „Natürlich halten wir unsere EDV immer auf dem aktuellen Softwarestand, aber als ‚Update-Wahnsinn‘ würde ich das nicht bezeichnen. Jeder Schreiner schärft seine Sägen und erneuert seinen Maschinenpark regelmäßig – anders ist das mit dem Werkzeug EDV in der Kanzlei letztlich nicht.“ System-Ausfall? „In den ganzen Jahren hatten wir genau dreimal einen zeitweisen Technikausfall. Einmal war die Ursache ein mehrstündiger lokaler Stromausfall, die beiden anderen Stillstände waren deutlich kürzer und waren Folge eines Hardwaredefekts, den wir aber bis zur Reparatur ohne fremde Hilfe durch eigene Backup- und Ausweichsysteme ausgleichen konnten.“
Während auf diese Weise immer mehr Kanzleien mit Hilfe der Digitalisierung neue Wege gehen, etablieren sich parallel auf dem deutschen Rechtsmarkt neue Anbieter, die mit ihren Geschäftsmodellen die juristische Arbeit anders angehen und abrechnen.
Der nächste Schritt ist für Michael Renz nun ein „gezielter Einsatz von künstlicher Intelligenz, als eine gute Basis für die im Anwaltsgeschäft erforderliche Kreativität: Fleißarbeit und Recherchezeit könnte dann sinnvoller zur eigentlichen juristischen Arbeit eingesetzt werden.“ Keine technische Entwicklung ohne die andere Seite der Medaille: Mit Sorge beobachtet Michael Renz eine Tendenz zur „Industrialisierung des Anwaltsberufes“, zum Beispiel mit Blick auf die Klagen zum „Diesel-Skandal“: „Da werden Massenverfahren geführt und Schriftsätze aus Baukästen zusammengestellt. Die eigentliche juristische Arbeit hat vielleicht zu Beginn der Verfahren noch eine Rolle gespielt, zwischenzeitlich ist das aber zu Copy & Paste ‚verkommen‘.“
NewLaw: Recht on-demand
Während auf diese Weise immer mehr Kanzleien mit Hilfe der Digitalisierung neue Wege gehen, etablieren sich parallel auf dem deutschen Rechtsmarkt neue Anbieter, die mit ihren Geschäftsmodellen die juristische Arbeit anders angehen und abrechnen. Eine Bezeichnung, die dabei die Runde macht, ist die von „NewLaw“. Centurion Plus ist einer der ersten Anbieter auf dem deutschen Markt, der NewLaw zum Markenkern macht mit dem Ansatz, „hochqualifizierte Anwälte ondemand“ zu bieten. „Das NewLaw Modell unterscheidet sich von der traditionellen Erbringung von Rechtsdienstleistungen vor allem in drei Bereichen: in der Art und Weise, wie Firmen Kunden gewinnen, der Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird und der Art und Weise, wie die Firma geführt wird“, beschreibt das Unternehmen seinen Ansatz in Form eines „NewLaw-Guides“, zu finden auf der Homepage des Anbieters.
Vergleichbar mit Dienstleistungsunternehmen anderer Branchen finden NewLaw-Firmen ihren Kundenstamm „durch Marketing, Geschäftsentwicklung und ein Alleinstellungsmerkmal“; der Mandantenstamm werde durch die Bekanntheit der Kanzleimarke aufgebaut, nicht durch individuelle Netzwerke oder persönliche Beziehungen. „Dies bedeutet, dass es einer NewLaw Firma leichtfallen sollte, von zeitbasierten Abrechnungen wegzukommen, da der Kunde den Dienstleister für ein bestimmtes Ergebnis beauftragt“, heißt es im „NewLaw-Guide“ von Centurion Plus.
NewLaw: Definition
Der US-Strategieberater mit Rechts-Schwerpunkt Eric Chin hat in einem Blog- Eintrag bereits 2013 den Begriff NewLaw wie folgt definiert: „Jedes Modell, Verfahren oder Instrument, das einen wesentlich differenzierteren Ansatz für die Schaffung oder Bereitstellung von Rechtsdienstleistungen darstellt als das, was die Rechtsberufe traditionell anwenden.“ (im englischen Original: „Any model, process, or tool that represents a significantly different approach to the creation or provision of legal services than what the legal profession traditionally has employed.“)
Dadurch ändere sich das Abrechnungssystem der juristischen Arbeit: NewLaw-Firmen entfernten sich von Stundensätzen, tendierten dazu, alternative Modelle zu entwickeln, zum Beispiel: „Abrechnung auf Projektbasis oder eine feste Gebühr für die Dienstleistungen.“ Wer heute in den Beruf einsteigt, darf davon ausgehen, dass die Frage „herkömmliche Kanzlei oder NewLaw?“ keine Entweder-oder-Entscheidung darstellt. Offensichtlich jedoch ist, dass sich der Rechtsmarkt weiter ausdifferenziert, mit der Digitalisierung als Treiber, die neue Geschäftsmodelle und Kommunikationsformen ermöglicht, den Workflow der in den Organisationen tätigen Jurist*innen verändert und bei den Mandanten Ansprüche weckt. Für die junge Generation sind das positive Entwicklungen. Denn überall dort, wo Veränderungen stattfinden, sich Strukturen verändern und eine innovationsgetriebene Offenheit gefordert ist, ergeben sich für Nachwuchskräfte Chancen. „Die Digital Natives sind mit digitalen Hilfsmitteln groß geworden. Insofern darf man erwarten, dass sie damit auch gewandt und zielführend umzugehen verstehen“, sagt Michael Renz von der Kanzlei Renz Schuhknecht Baumann. Wenn daraus ein Wissens- und Erfahrungsvorsprung resultiere, sei dieser „eine gute Voraussetzung für die Karriere als auch für eine gesunde Work-Life- Balance“.
Das Vario-Geschäft der Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons
Vario ist ein 2013 von der internationalen Wirtschaftskanzlei Pinsent Masons eingeführtes Angebot im Bereich innovativer Rechtsberatungskonzepte. Vario arbeitet weltweit mit einem Pool von über 1000 Projektjuristen zusammen und zählt damit zu den führenden Anbietern von flexiblen Rechtsbratungsdienstleistungen. Vario ist nicht VC-, Private Equity- oder börsenfinanziert. Von anderen Anbietern flexibler Rechtsberatungsdienstleistungen unterscheidet sich Vario durch die enge Anbindung an eine führende internationale Anwaltskanzlei. „Das Angebot flexibler Rechtsberatungsdienstleistungen ist noch neu auf dem deutschen Markt. Aber mehr und mehr Unternehmen erkennen, dass Projektjuristen, die einer Kanzlei wie Pinsent Masons nahestehen, einen ganz erheblichen Mehrwert für sie schaffen können“, sagte Dr. Carl Renner im Zuge seiner Ernennung zu einem der Co-Heads von Vario in Deutschland im Juli 2020.
Alternative Anbieter im Kommen
Die Studie „Future Ready Lawyer 2021“ fragte Anwält*innen nach den großen Trends, die in den kommenden drei Jahren eine Auswirkung auf die Arbeit der großen Kanzleien haben werden. Der größte Zuwachs mit sechs Prozentpunkten auf nun 74 Prozent gelingt dem Trend „Zunahme Alternativer Anbieter von Rechtsdienstleistungen“. Zugleich glauben 74 Prozent der befragen Jurist*innen, dass die Themen Preiswettbewerb/alternativen Gebührenstrukturen/Kosteneinsparungen in den kommenden drei Jahren die Abrechnungsmodelle stark prägen und verändern werden.






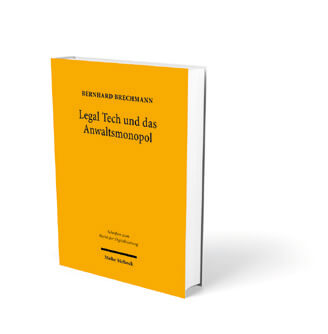 Legal Tech ist in aller Munde. Die Möglichkeit des Einsatzes von Legal Tech wirft dabei vor allem die Frage auf, ob Rechtsdienstleistungen weiterhin primär nur durch Rechtsanwälte erbracht werden dürfen. Diese Fragestellung wurde bisher allein mit Blick auf die Regelungen im deutschen Recht betrachtet. Bernhard Brechmann untersucht hingegen die Zulässigkeit des Einsatzes von Legal Tech im europäischen und internationalen Kontext. Denn im Gegensatz zu Deutschland kennt eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU kein entsprechendes Anwaltsmonopol für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Frage ist daher, ob diese ausländischen Vorschriften in Deutschland zur Anwendung gebracht werden können. Bernhard Brechmann: Legal Tech und das Anwaltsmonopol. Mohr Siebeck 2021, 80 Euro.
Legal Tech ist in aller Munde. Die Möglichkeit des Einsatzes von Legal Tech wirft dabei vor allem die Frage auf, ob Rechtsdienstleistungen weiterhin primär nur durch Rechtsanwälte erbracht werden dürfen. Diese Fragestellung wurde bisher allein mit Blick auf die Regelungen im deutschen Recht betrachtet. Bernhard Brechmann untersucht hingegen die Zulässigkeit des Einsatzes von Legal Tech im europäischen und internationalen Kontext. Denn im Gegensatz zu Deutschland kennt eine Reihe von Mitgliedstaaten der EU kein entsprechendes Anwaltsmonopol für die Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Frage ist daher, ob diese ausländischen Vorschriften in Deutschland zur Anwendung gebracht werden können. Bernhard Brechmann: Legal Tech und das Anwaltsmonopol. Mohr Siebeck 2021, 80 Euro.

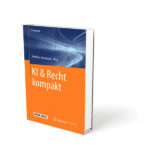 Matthias Hartmann (Hrsg.): KI & recht kompakt. Springer Vieweg 2020, 20 Euro
Matthias Hartmann (Hrsg.): KI & recht kompakt. Springer Vieweg 2020, 20 Euro
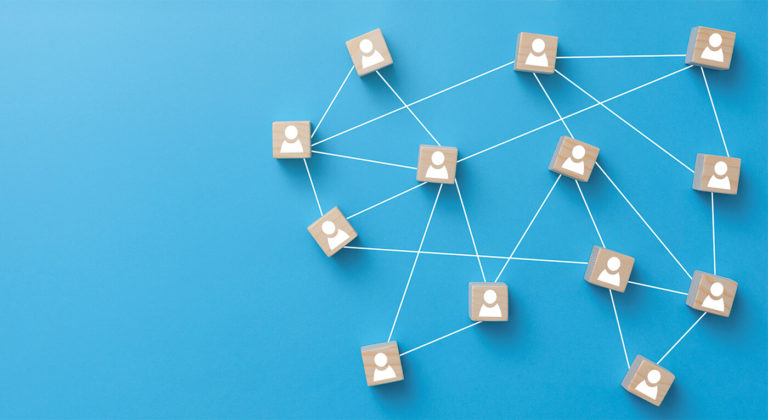


 Die juristische Tätigkeit muss nachhaltig werden: Diesen Ansatz verfolgt die neue Zeitschrift „Nachhaltigkeitsrecht“, die eine Plattform für den Austausch und die Auseinandersetzung mit der ganzheitlichen Betrachtung des Rechts als Instrument zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bietet.
Die juristische Tätigkeit muss nachhaltig werden: Diesen Ansatz verfolgt die neue Zeitschrift „Nachhaltigkeitsrecht“, die eine Plattform für den Austausch und die Auseinandersetzung mit der ganzheitlichen Betrachtung des Rechts als Instrument zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bietet.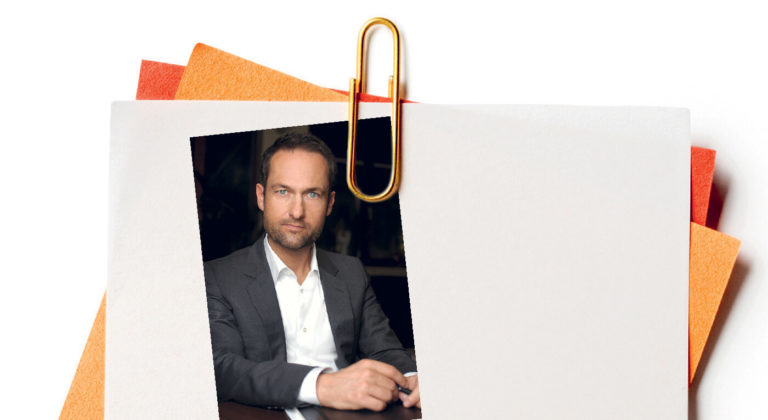
 Markus Schollmeyer:
Markus Schollmeyer: