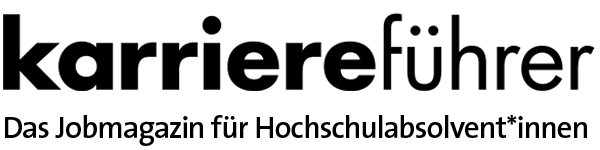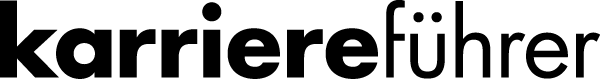Als Anwalt bei KPMG Law ist Philipp Glock mit seinen Schwerpunkten Legal Technology, Managed Services und Legal Project Management häufig in sehr engem Kontakt mit den Mandanten. Was dem Juristen dabei auffällt: In Sachen Digitalisierung hat sich bei den Unternehmen einiges getan. Entsprechend hoch sind die Ansprüche an juristische Beratung mit Hilfe neuer Techniken. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Philipp Glock studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Lausanne und an der HU Berlin. Seinen Referendariatsdienst leistete er in Berlin ab, nachdem er in Kapstadt und Stellenbosch/Südafrika den Titel eines Magister Legum (LL.M.) erworben hatte. Vor seiner Zeit bei KPMG Law war er in einer anderen großen deutschen Rechtsanwaltskanzlei sowie bei Sony Deutschland GmbH tätig. Zu seinen Schwerpunkten gehören die Digitalisierungs-, Technologie- und Prozessberatung von Rechtsabteilungen sowie das Gesellschafts- und Handelsrecht. Als Co- Head der Solution Legal Process & Technology ist Philipp Glock mit den aktuellen digitalen Lösungen für Unternehmen jeder Größe vertraut und berät die Mandanten sowohl bei der Auswahl und Einführung der entsprechenden Tools als auch bei der Implementierung sowie Überarbeitung von Prozessen in der Rechtsfunktion.
Herr Glock, über Ihrem Anwaltsprofil bei KPMG Law haben Sie einen Satz von Albert Einstein zitiert: „Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“ Wie häufig treffen Sie als Jurist auf diese Einstellung?
Das kommt schon mal vor, ist aber natürlich nicht die Regel. Um es salopp zu formulieren: Juristinnen und Juristen sind nicht unbedingt das verrückteste Völkchen. Will heißen, dass ein gewisser Anteil von denjenigen, die in dieser Berufsgruppe tätig sind, bei Wandlungsprozessen nicht unbedingt zu den Pionieren zählen.
Wenn Sie diesen digitalen Wandel beziffern müssten, wie sehr greift er generell in die juristische Arbeit ein?
Noch nicht so radikal, wie man glauben könnte. Ich schätze mal, dass durchschnittlich bei 90 Prozent der Arbeit weiterhin klassisches juristisches Know-how gefragt ist. Dieser Anteil lässt sich vielfach auch kaum digitalisieren, weil es hier zum Beispiel um individuelle Beratung geht. Oder um juristische Expertise, die nicht von Bots oder Künstlicher Intelligenz übernommen werden kann. Richtig ist aber auch, dass der Raum für Arbeiten, die sich digitalisieren lassen, kontinuierlich wächst.
Sprich: Tendenz steigend.
Genau. Ich vergleiche das Profil eines Juristen gerne mit einer Torte: Es gibt die klassische Anwalts-Torte, einhundert Prozent Jura. Meine persönliche Torte würde ich vielleicht so beschreiben: Die Hälfte der Stücke sind klassisch juristisch geprägt, die andere Hälfte digital. Wichtig ist: Für alle Tortenarten gibt es noch passende Deckel.
Welche juristischen Arbeiten können heute sinnvoll digitalisiert werden?
Tätigkeiten, die so häufig vorkommen, dass sie standardisierbar sind. Darunter gibt es durchaus Arbeiten, die eine große Komplexität besitzen. Zum Beispiel die juristische Ausgestaltung von Verträgen. Sind diese in gewisser Weise repetitiv, kann die digitale Technik hier vieles übernehmen. Schon heute gibt es im Kanzleialltag viele sich wiederholende Arbeiten, die ganz selbstverständlich von digitalen Tools übernommen werden. Steht eine Tätigkeit eher für einen einzelnen Fall, lohnt sich dieser Schritt nicht, da ist es effektiver, die Arbeit auf traditionelle Weise zu übernehmen.
In den Kanzleien kommt es also darauf an, zu entscheiden: Was machen wir digital – was weiterhin analog.
Ja, das sind neue Fragen, die sich in den Kanzleien stellen. Interessant wird es, wenn zwei Kulturen aufeinandertreffen. Vereinfacht gibt es diejenigen, die noch gerne die Idee bedienen, dass Juristen nur in der juristischen Manufaktur arbeiten. Dazu stoßen nun immer mehr aus einer jungen Generation, die mit Begriffen wie New Law oder Alternative Legal etwas anfangen können.
Stehen junge Jurist*innen vor der Entscheidung: Entweder-oder?
Ich glaube, dass man sich sein Profil heute noch selbst erstellen kann, ohne dabei Gefahr zu laufen, abgehängt zu werden. Jedoch steigen die Potenziale für alle, die diesen Beruf neu denken.
Wie wichtig ist juristisches Know-how, um die digitalen Tools zu implementieren?
Das ist in der Tat eine neue zentrale Aufgabe. Um repetitive Abläufe in standardisierte Prozesse zu überführen, wird juristisches Verständnis benötigt, zum Beispiel, um bei skalierbaren Fällen die richtigen Wenn-dann-Verknüpfungen zu erstellen. Bei diesen Themen kommt es darauf an, Jura- und IT-Kenntnisse zu verknüpfen. Die Teams, die an diesen Projekten arbeiten, sind entsprechend interdisziplinär besetzt. Junge Juristinnen und Juristen, die verstehen, wie IT-Prozesse funktionieren, haben gute Chancen, in diesen Teams eine wichtige Rolle zu spielen.
Die Aufgabe ist, das, was wir Anwälte in unserer juristischen Sprache klar benennen können, in die Technologie, in die Tools zu übersetzen.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen bei der Transformation von juristischen Abläufen in IT-Prozesse?
Ein Thema ist hier sicherlich die Kommunikation. Juristen nutzen eine eigene Fachsprache, Informatiker auch. Die Aufgabe ist, das, was wir Anwälte in unserer juristischen Sprache klar benennen können, in die Technologie, in die Tools zu übersetzen. Je komplexer die juristischen Themen sind, desto wichtiger ist es, hier Fehler und Missverständnisse zu vermeiden. Ich glaube daher, dass das Finden einer gemeinsamen Sprache weiter an Bedeutung gewinnen wird.
Erkennen Sie, dass sich die Ansprüche der Mandanten ändern? Dass Sie auf digitale Lösungen pochen?
Ja, hier bewegt sich was. Wenn wir vor fünf, sechs Jahren in die Unternehmen kamen, waren diese häufig vergleichsweise wenig digitalisiert. Brachten wir digitale Lösungen mit, konnten wir damit punkten. Das ist heute schon nicht mehr der Fall, mittlerweile haben die Unternehmen digital und auch personell aufgerüstet, sie kennen die Möglichkeiten der Digitalisierung – entsprechend sind die Ansprüche gewachsen.
Wie reagieren Sie als Anwalt auf diese Entwicklung?
Ich finde das grundsätzlich gut, weil höhere Ansprüche meine Arbeit am Ende des Tages besser machen. Wobei wir auch hier festhalten sollten, dass nicht alle Kanzleien gezwungen sind, mit dieser Entwicklung mitzugehen. Es gibt welche, die ihren Markenkern nicht verändern. Weil sie sich treu bleiben wollen – oder auch, weil sie sich als kleinere Kanzleien schwertun, digitale Innovationen umzusetzen. Und ich denke schon, dass auch diese Kanzleien in bestimmten Bereichen weiterhin die Chance haben, sich am Markt zu behaupten.
Um repetitive Abläufe in standardisierte Prozesse zu überführen, wird juristisches Verständnis benötigt, zum Beispiel, um bei skalierbaren Fällen die richtigen Wenn-dann-Verknüpfungen zu erstellen.
Können Sie die gehobenen Ansprüche der Mandanten konkret machen?
Auf den Punkt gebracht: Wollen wir unsere Mandanten mit Legal-Tech-Anwendungen überzeugen, dann müssen sich diese am Niveau der Marktführer (oder großen Player etc.) orientieren. Sprich: Es kommt auf den Komfort und intuitive Bedienbarkeit an. Putzige Legal-Tech-Tools, die vor fünf Jahren noch für große Augen gesorgt haben, werden heute schon nicht mehr ernst genommen. Ein Beispiel, unsere Mandanten wissen, dass ihre Mitarbeitenden Plattformen für Budget-Reports oder Vertragsmanagement kaum nutzen werden, wenn sie sich immer wieder neu anmelden und immer die gleichen Daten eingeben müssen. Hier bedarf es einer möglichst einheitlichen Umgebung. Die Benchmark für Legal-Tech-Lösungen liegt heute sehr hoch, gerade was die Nutzerfreundlichkeit und den Ertrag betrifft. Und der Anspruch wird weiter steigen, da immer mehr große Anbieter in den Legal-Markt reingehen: Große Software- Konzerne erkennen, dass es eine große Nachfrage im Legal-Bereich gibt.
Was können digitale Plattformen, die mit Algorithmen und Big Data arbeiten, im besten Fall an Mehrwert generieren?
Durch das Zusammenführen von Daten über eine Plattform ergibt sich eine nie dagewesene Transparenz. Denken Sie zum Beispiel an Themen wie Korruption oder Geldwäsche. Wenn ich vorhandene Daten nutze und mit juristischen Prüflogiken verbinde, kann ich deutlich schneller und einfacher Verdachtsfälle aufzeigen. Oder nehmen Sie das Thema Ausschreibungen: Wenn man in der Lage ist, mit digitalen Tools Ausschreibungen zu durchleuchten, um anhand von Daten und Mustern eventuelle Verstöße gegen das Kartellrecht ausfindig zu machen, zeigt sich der Mehrwert: Das Unternehmen schützt sich vor Risiken durch böse Überraschungen. Wobei auch in diesem Fall die juristische Beratung nicht an Bedeutung verliert: Das Muster richtig in das Tool zu überführen ist auch Jura. Und dann ist die eine Sache, dass das Tool das Muster erkennt. Wie damit umzugehen ist, die andere.
Zum Unternehmen
KPMG Law Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) ist eine international ausgerichtete multidisziplinäre Kanzlei, die mit mehr als 350 Anwält*innen an 16 deutschen Standorten vertreten ist. KPMG Law ist als rechtlich eigenständige Wirtschaftskanzlei mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft assoziiert und eng verbunden. Schwerpunkte der rechtlichen Beratung sind der öffentliche Sektor, Financial und Corporate Services sowie Beratung bei M&ATransaktionen, Joint Ventures sowie Reorganisations- oder Sanierungsprojekte im In- und Ausland.