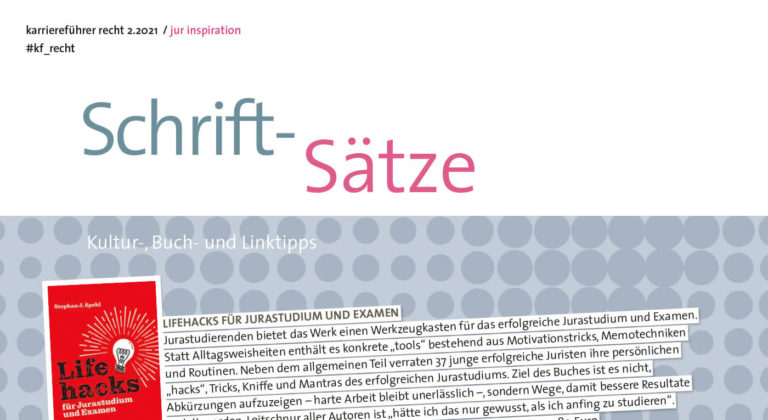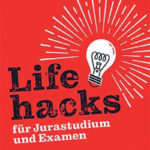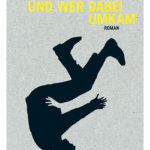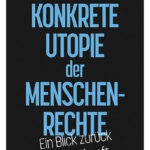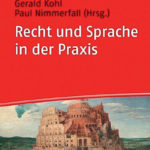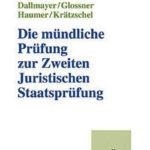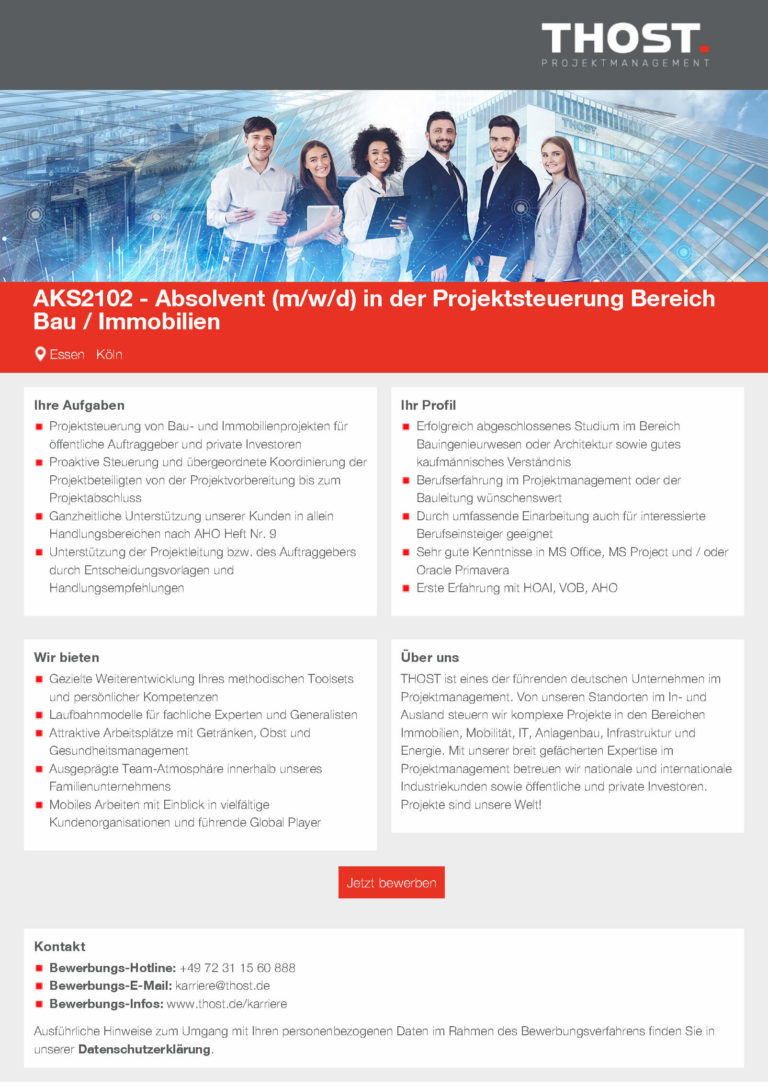Bereits die Suche nach geeigneten Bewerbern ist heutzutage schwer genug. Darüber hinaus haben Personaler immer wieder mit falschen Angaben in Bewerbungsunterlagen und gefälschten Zeugnissen zu kämpfen. Welche arbeitsrechtlichen Maßnahmen stehen Arbeitgebern zur Verfügung, wenn ein Bewerber „manipulierte“ Unterlagen verwendet? Von Dr. Kerstin Giehler, Rechtsanwältin | Associate bei KLIEMT.Arbeitsrecht
In einem aktuellen Urteil des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern (LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 19. Mai 2020 – 5 Sa 217/19) stritten die Parteien über die Wirksamkeit einer Anfechtung des Arbeitsvertrags durch die beklagte Arbeitgeberin wegen falscher Angaben in den Bewerbungsunterlagen. Der Kläger hatte im Bewerbungsbogen eine Staatsprüfung angegeben, die er nicht abgelegt hatte, und gefälschte Zeugnisse über die erste und zweite Staatsprüfung für das Lehramt an Haupt- und Realschulen vorgelegt. Nachdem die Beklagte ein gutes Jahr nach der Einstellung des Klägers herausfand, dass es sich bei den Zeugnissen um Fälschungen handelt, focht sie das Arbeitsverhältnis gemäß § 123 Abs. 1 BGB innerhalb eines Tages wegen arglistiger Täuschung an. Vorsorglich sprach sie eine fristlose und hilfsweise eine fristgerechte Kündigung aus. Das LAG gab der Beklagten recht. Die wirksame Anfechtung führte zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
Das LAG führte aus, der Kläger habe die Beklagte durch Vorlage der gefälschten Zeugnisse getäuscht und wahrheitswidrig eine Lehrbefähigung vorgespiegelt, über die er nicht verfüge. Er habe auch arglistig gehandelt. Dies ist der Fall, wenn der Täuschende die Unrichtigkeit seiner Angaben kennt und zumindest billigend in Kauf nimmt, der Erklärungsempfänger könnte durch die Täuschung beeinflusst werden. Zudem sei die Vorlage des Zeugnisses auch kausal für den Abschluss des Arbeitsvertrags gewesen, wobei Mitursächlichkeit ausreiche.
Auf die Frage, ob auch die fristlose Kündigung wirksam gewesen wäre, kam es daher nicht mehr an. In aller Regel stellt jedoch die Vorlage gefälschter Zeugnisse oder eine schriftliche Lüge in den Bewerbungsunterlagen einen wichtigen Grund im Sinne des § 626 Abs. 1 BGB dar, der den Arbeitgeber zum Ausspruch einer fristlosen Kündigung berechtigt.
Wenn ein Arbeitgeber von der Fälschung eines Zeugnisses erfährt, kann er den Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten und/oder dem Arbeitnehmer möglicherweise außerordentlich kündigen.
Zusammengefasst lässt sich festhalten: Wenn ein Arbeitgeber von der Fälschung eines Zeugnisses erfährt, kann er den Arbeitsvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten und/oder dem Arbeitnehmer möglicherweise außerordentlich kündigen. Hierbei sind die gesetzlichen Fristen der § 124 Abs. 1 BGB bzw. § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB einzuhalten. Insbesondere, wenn er eine fristlose Kündigung aussprechen will, muss der Arbeitgeber schnell – innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis des Kündigungsgrundes – reagieren.
Zusätzlich kommt unter Umständen ein Schadensersatzanspruch des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer in Betracht. Zu einer Rückzahlung der erhaltenen Vergütung kommt es indes nur in Ausnahmefällen. Sowohl für die Anfechtung als auch für die Kündigung und mögliche Schadensersatzforderungen ist entscheidend, dass dem Arbeitgeber die gefälschten Unterlagen vor der Entscheidung über die Einstellung vorlagen. Ansonsten fehlt es an der erforderlichen Kausalität.
Neben arbeitsrechtlichen Maßnahmen ist die Stellung von Strafanzeige und Strafantrag bei der zuständigen Staatsanwaltschaft möglich. Strafrechtliche Konsequenzen, insbesondere aufgrund des Tatbestands der Urkundenfälschung, sind auch dann möglich, wenn es aufgrund der manipulierten Bewerbungsunterlagen gar nicht erst zum Abschluss eines Arbeitsvertrages kommt.