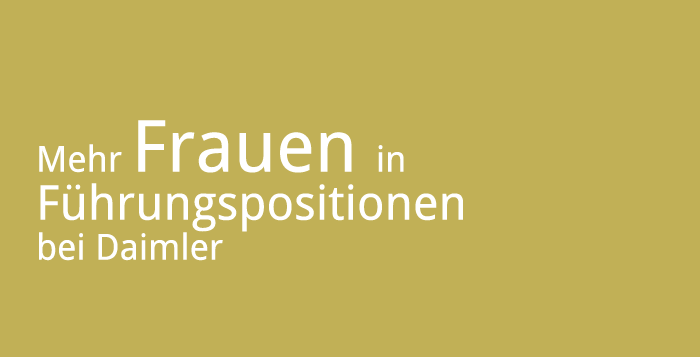Dr. Christine Hohmann-Dennhardt hat es als erste Frau in den Vorstand des Automobilkonzerns Daimler geschafft. Eine der Kernaufgaben der 63 Jahre alten ehemaligen Bundesverfassungsrichterin: die nachhaltige Verankerung einer integren Unternehmenskultur. Im Interview erklärt sie, worauf es dabei ankommt und wie es ihr gelang, als Juristin in den Vorstand eines internationalen Konzerns zu rücken. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Dr. Christine Hohmann-Dennhardt, geboren am 30. April 1950 in Leipzig, studierte in Tübingen Rechtswissenschaft und schloss ihr Studium 1975 mit dem zweiten Staatsexamen ab. Im selben Jahr wurde sie Lehrbeauftragte für Sozialrecht an der Universität Hamburg. Ihre juristische Promotion legte sie 1979 an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ab und war ab 1981 als Richterin an hessischen Sozial- und Landessozialgerichten tätig, 1984 wurde sie Direktorin des Sozialgerichts Wiesbaden. 1989 wechselte sie als Dezernentin für Soziales, Jugend und Wohnungswesen in die Verwaltung der Stadt Frankfurt. 1991 wurde sie für die SPD zur Justizministerin des Landes Hessen berufen, ab 1995 war sie hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst. 1999 wechselte Christine Hohmann-Dennhardt zum Bundesverfassungsgericht, wo sie dem Ersten Senat angehörte und vor allem für Familienrecht zuständig war. Seit dem 16. Februar 2011 ist sie Vorstandsmitglied der Daimler AG und in dieser Funktion verantwortlich für das Ressort „Integrität und Recht“.
Sie waren Politikerin, Verfassungsrichterin – jetzt sitzen Sie im Daimler Vorstand. Welches Ihrer Talente war und ist in allen drei Bereichen besonders wichtig?
Keine Scheu vor neuen Herausforderungen zu haben, Freude am Lösen von Problemen zu finden und gern Verantwortung zu übernehmen.
Sie füllen ein neu geschaffenes Vorstandsressort mit Leben. Was ist der besondere Reiz dieser Aufgabe?
Nachdem ich mich während meines davor liegenden Berufslebens dem Recht, seiner Steuerungsfähigkeit und seiner Durchsetzung im öffentlichen Bereich gewidmet habe, ist es für mich mit einem solchen Erfahrungshintergrund sehr reizvoll, der gleichen Aufgabe nun in einem privaten, prestigereichen und weltweit agierenden Unternehmen nachzugehen, noch dazu mit dem Einfluss und der Verantwortlichkeit, die eine Vorstandsposition mit sich bringt. Außerdem hat mir zugesagt, dass das mir übertragene Ressort die Bezeichnung „Integrität und Recht“ trägt. Denn dies bringt zum Ausdruck, dass es dem Unternehmen nicht allein darum geht, für die Wahrung staatlich vorgegebener Gesetze durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sorge zu tragen. Vielmehr will man neben allem verständlichen Gewinnund Erfolgsstreben, dass Werthaltungen das Handeln wie Entscheiden bei Daimler bestimmen, die der gesellschaftlichen Verantwortung des Unternehmens Rechnung tragen. Dies zu erreichen, ist eine spannende und lohnenswerte Aufgabe. Und natürlich hat mich darüber hinaus gereizt, nicht immer nur davon zu reden, dass mehr Frauen auch in der Wirtschaft Spitzenpositionen erlangen sollten, sondern dann auch das Angebot anzunehmen, als erste Frau in den Vorstand bei Daimler einziehen zu können.
Wo liegen die besonderen Herausforderungen Ihres Jobs?
Zum einen darin, unternehmensinterne Regeln vorzuhalten, die unter Beachtung geltenden Rechts so abgefasst sind, dass sie nicht als Belastung, sondern als Hilfestellung empfunden werden, also überschaubar, verständlich, verhältnismäßig und einleuchtend sind. Zum anderen zu überzeugen, dass integres Handeln den Unternehmenserfolg nicht hemmt, vielmehr ihn nachhaltig befördert und auf Dauer sichert. Des Weiteren klarzumachen, dass Führung sich nicht darin erschöpft, hehre Ziele vorzugeben, sondern Vorbild zu sein und selbst konsequent danach zu handeln. Und schließlich glaubhaft zu vermitteln, dass auf Kontrollen nicht verzichtet werden kann, dass Daimler aber vor allem auf seine Mitarbeiter setzt, ja ihnen den Rücken dabei stärkt, aus eigenem Ansporn und mit eigenem Wertekompass verantwortlich und integer zu handeln und damit Erfolg wie Ansehen des Unternehmens zu befördern. Bei alledem sind wir schon sehr gut vorangekommen, wie uns dies unser von den US-Behörden eingesetzte Monitor am Ende seiner Tätigkeit mit seinem Zeugnis, wir hätten „Goldstandard“ erreicht, bestätigt hat.
Wie gelingt es Ihnen, Ihre Auffassung von Recht in einem Konzern wie Daimler zu integrieren? Sind dafür neue Regeln, neue Werte und eine neue Art von Führung nötig?
Von allem ein maßvolles Quantum. Wir haben zum Beispiel im Dialog mit den Beschäftigten eine neue, konzernweit geltende Verhaltensrichtlinie geschaffen, dafür etliche andere Richtlinien zum Wegfall gebracht, weil sie überflüssig waren und nur zur Verwirrung beigetragen haben, und darüber hinaus andere Regeln zusammengefasst und unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten überarbeitet. So konnten wir das interne Regelwerk von vorher rund 1800 auf mittlerweile rund 700 Regeln herunterfahren, was die Akzeptanz dieser Vorgaben sichtlich erhöht hat. Bei den Werten als Leitmotive des Handelns im Unternehmen wiederum musste nichts neu aufgestellt werden, hier galt und gilt es, sie wieder mehr ins Bewusstsein zu rufen und zu reaktivieren. Das kostet Überzeugungskraft, doch ich habe dabei die nötige Ausdauer sowie gute Argumente und eine ausreichende Zahl von Unterstützern zur Seite. Zuhören, argumentieren, überzeugen, entscheiden und dann eigenes stringentes Voranschreiten wie Handeln – das ist meine Art zu führen, mit der ich bisher Erfolg hatte.
Wie gerecht kann es in einem Unternehmen dieser Größe überhaupt zugehen?
Gerechtigkeit ist bei aller Ungerechtigkeit, die es gibt, ein nur schwer erreichbares Ziel, auf das jedoch hingearbeitet werden muss: in der Gesellschaft wie in Unternehmen und in der Wirtschaft. Das fängt bei der Wertschätzung des Einzelnen an, betrifft den Schutz vor Diskriminierung, die Akzeptanz von Unterschiedlichkeiten, die Förderung der Entfaltung individueller Fähigkeiten und reicht bis zur leistungsgerechten und auskömmlichen Entlohnung oder zur Unterstützung, wenn Hilfe angesagt ist. Das Streben nach Erfolgen und Gewinnen ist ein guter, treibender Motor für Unternehmen, es darf aber nicht um jeden Preis erfolgen: Gesetzestreue, Verantwortungsbewusstsein, Fairness wie Anstand gegenüber Mitarbeitern, Geschäftspartnern und dem gesellschaftlichen Umfeld dürfen nicht unter die Räder kommen, sondern müssen hochgehalten und praktiziert werden. Im Daimler-Konzern ist man sich dessen bewusst. Man ist deshalb schon vor Jahren als Gründungsmitglied dem von Kofi Annan initiierten „Global Compact“ beigetreten, mit dem sich Unternehmen freiwillig verpflichten, ihr Handeln an bestimmten, universell geltenden ethischen Maßstäben wie zum Beispiel den Menschenrechten auszurichten. Wesentliche Aufgabe ist dabei, dafür zu sorgen, dass dies auch immer wieder und überall in die Tat umgesetzt wird.
Was muss man als Juristin mitbringen, um sich im Vorstand eines Automobilkonzerns – noch dazu unter Männern – zu bewähren?
Wie überall: eine gute Menschenkenntnis, ein taktisches Händchen, ein offenes Visier, eine hinreichende Portion Selbstbewusstsein, eine gewisse Beharrlichkeit, geschicktes Durchsetzungsvermögen und einen langen Atem.
Sie haben als Juristin häufig die Seiten gewechselt, waren Teil der Judikative und der Legislative und sind nun Managerin in der freien Wirtschaft. Wie gelingen diese Wechsel, ohne dass ein Makel der Beliebigkeit entsteht?
Ja, es ist richtig, ich habe mehrfach Seitenwechsel vorgenommen, aber immer erst, wenn ich einer Aufgabe längere Zeit erfolgreich nachgegangen war oder sie zum Abschluss gebracht hatte, und nur, was die jeweilige Funktion und Rolle betroffen hat. Meinen Grundeinstellungen bin ich dabei stets treu geblieben. Es ist eine große Bereicherung, Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven sammeln zu können, damit Zusammenhänge und Verhaltensweisen besser zu verstehen und diese Erkenntnisse im Interesse der Anliegen, die man verfolgt, zur Anwendung bringen zu können.
Ob als junge berufstätige Mutter, Ministerin oder jetzt Mitglied des Daimler Vorstands: Sie kennen sich mit Druck von außen aus. Was sind ihre wertvollsten Bewältigungsstrategien, um abends gut einschlafen und morgens gut gelaunt aufzuwachen?
Ein gutes Gewissen ist nach wie vor das beste Ruhekissen, wie es schon ein altes Sprichwort empfahl. Man bewältigt Druck von außen leichter, wenn man überzeugt ist, richtig zu handeln, oder bereit ist, Fehler, die man gemacht hat, offen zuzugeben.
Was raten Sie abschließend einer jungen Juristin, die noch keinen blassen Schimmer hat, wie sie später Familie, Karriere, persönliche Weiterentwicklung und ein gesundes Leben vereinbaren soll?
Sich nicht einschüchtern zu lassen und vorschnell vor Alternativen zu stellen, sondern das anzustreben, was sie sich erhofft vom Leben. Mit Selbstvertrauen, Willen und Elan gelingt mehr, als man denkt – auch Beruf und Familie zufriedenstellend unter einen Hut zu bekommen.
Zum Unternehmen
Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses sowie Daimler Financial Services gehört die Daimler AG weltweit zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Im Jahr 2012 setzte der Konzern mit 275.000 Mitarbeitern rund 2,2 Millionen Fahrzeuge ab.
Die Unternehmensleitung besteht aus acht Vorständen, inklusive dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Dieter Zetsche. Christine Hohmann-Dennhardt ist die erste Frau im Vorstand des Automobilkonzerns. Ihr 2011 neu geschaffener Vorstandsbereich umfasst konzernweit den Rechtsbereich und die Compliance-Organisation sowie die Bereiche Corporate Data Protection und Corporate Responsibility Management. Auch die Verantwortlichkeit für die Achtung und Wahrung von Menschenrechten sowie für die nachhaltige Verankerung einer integren Unternehmenskultur (Integrity Management) liegt in diesem Ressort.