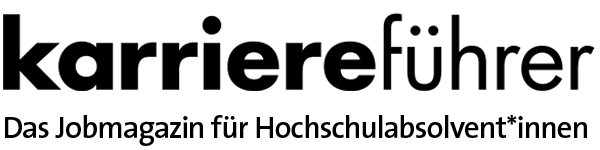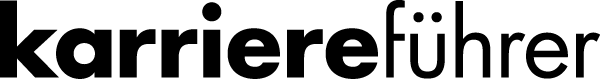Der Schlips – unverzichtbar oder obsolet?
Spielend aufs Vorstellungsgespräch vorbereiten
 Onlinebestellung bei Amazon.de
Onlinebestellung bei Amazon.de
Markus Mörl
Mit dem Ohrwurm „Ich will Spaß“ tobte sich Markus Mörl in der Neuen Deutschen Welle aus. 20 Jahre später ist er Geschäftsführer eines New Media-Unternehmens und Chefredakteur des Personalienmagazins „SesselWechsel“. Dem karriereführer erzählte er, welche Sessel er selbst schon in seinem Leben gewechselt hat. von Anne Thesing
In frühen Jahren deutete noch nichts auf eine erfolgreiche Musikerkarriere hin. „Meine Eltern wollten immer, dass ich einen sicheren Beruf ergreife. Und ich hatte als Kind den Wunsch, Rechtsanwalt zu werden“, erinnert sich Markus Mörl. Doch dieser Kindheitswunsch hatte nicht lang Bestand. Zwar verließ er nach dem Abitur seine Heimatstadt Camberg im Taunus, um in Berlin Jura zu studieren, doch schon bald nistete sich ein neuer Zukunftstraum bei ihm ein: die Musik. „Besonders die Freude an der Kreativität in der Musik veranlasste mich dazu, ins Musikgeschäft einzusteigen“, begründet der heute 43-Jährige seinen Richtungswechsel. Als eingefleischter Punkrock-Fan schwärmte er für die Sex Pistols und begann seine eigene Musikkarriere mit der Band „The Deutschmarks“. Statt sein Studium fortzusetzen, tourte er schließlich als Solosänger durch Musikläden und Tonstudios – zunächst noch ohne das Wissen seiner Eltern. Doch als seine Lieder im Radio liefen, ließ sich sein Musikerdasein nur noch schwer verheimlichen. Und als seine Mutter eines Morgens 10000 Mark in seiner Bühnenhose fand, war das Versteckspiel endgültig vorbei.Neue Deutsche (Erfolgs-)Welle
Das war auch gut so, denn „Ich will Spaß“ war alles andere als ein heimlicher Hit. Das Lied lief 1982 die Charts rauf und runter und wurde zum Kultsong der Neuen Deutschen Welle. „Markus“ war jedem Deutschen zwischen 20 und 35 Jahren ein Begriff – erst Recht, als er 1983 an der Seite von Nena die männliche Hauptrolle in dem Kinofilm „Gib Gas – Ich will Spaß“ spielte. Ebenfalls mit Nena erreichte er mit dem romantischen Lied „Kleine Taschenlampe brenn‘“ Platz fünf der deutschen Charts. Doch irgendwann war die Neue Deutsche Welle nicht mehr neu und Markus‘ Lieder waren nicht mehr erfolgreich. Zwar gelang ihm in Italien mit seiner neuen Band TXT noch der Nummer 1 Hit „Girl‘s got a brand new Toy“. Doch danach war die Zeit endgültig reif für einen Wechsel ins „seriöse“ Leben.Spaß im Management
Der zweite Versuch, ein Studium zu absolvieren, verlief erfolgreicher als der erste: Von 1987 bis 1991 studierte der NDW-Star Betriebswirtschaft in Frankfurt am Main. Nebenher arbeitete er in verschiedenen Medienunternehmen – nicht mehr in der Funktion des Sängers, sondern in der des Managers. Dabei ist es bis heute geblieben: Als Geschäftsführer leitet er ein New Media-Unternehmen und als Chefredakteur wirkt er beim Branchenblatt „SesselWechsel“ mit – einer Publikation, die über Wechsel und Personalien in Deutschlands Chefetagen berichtet. Und wo bleibt da der Spaß? Der spielt im Leben von Markus Mörl, der mittlerweile Ehemann und Vater ist, immer noch eine wichtige Rolle. „Aufgaben und Arbeiten, die ich mit Spaß an der Sache beginne, erledige ich besser und schneller“, ist er überzeugt. Damit bleibt er seinem NDW-Hit treu. „Gib Gas!“ ist immer noch sein Lebensmotto. Selbst seine Aufgabenfelder haben sich nicht in dem Maße gewandelt, wie es auf den ersten Blick scheint: „Die Musik- und die Managementwelt ähneln sich in vielen Dingen“, meint er. „Mit einem Unterschied: Im Wirtschaftsleben gibt es keine Proben.“Visionär mit Realitätssinn
Vielleicht war es diese Sehnsucht nach Proben, die ihn vor einem Jahr noch einmal ins Musikgeschäft zurückführte. 2001, knapp 20 Jahre nach seinem musikalischen Durchbruch, betrat er erneut ein Tonstudio und veröffentlichte zusammen mit zwei befreundeten DJ’s das Album „Kopfüber“. Darin: ein Song für den Grand Prix-Wettbewerb. Leider verpassten die Musiker die Anmeldefrist… Hat dieses Album nach so langer Pause einen alten Traum wieder aufleben lassen? Bei Markus Mörl ist alles möglich. Die Aussage „Geht nicht!“ hemmt seiner Meinung nach jede Karriere. Visionen sind dagegen für ihn unverzichtbarer Bestandteil eines erfolgreichen Werdegangs. Einzige Voraussetzung: Ein Teil dieser Visionen muss auch realisierbar sein. „Will jemand Karriere machen, muss er seine Talente und Fähigkeiten ausbauen und zumindest einige seiner Ziele erreichen“, rät der Chefredakteur. Ihm selbst ist das gelungen. Er konnte seinen großen Musiktraum verwirklichen, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren. Das Ergebnis ist ein facettenreicher Werdegang voller Überraschungen. Mit Vollgas in die Zukunft „Der Wechsel allein ist das Beständige“, zitiert Markus Mörl abschließend den Philosophen Arthur Schopenhauer. Diesen Spruch hat er nicht nur zum Motto seiner „SesselWechsel“-Redaktion erhoben, er hat ihn sich auch selbst zu Eigen gemacht. Seine abwechslungsreiche Vergangenheit zeigt, dass er nicht sein Leben lang auf ein und demselben Sessel sitzen bleiben könnte. Gas geben ist immer noch besser als Stillsitzen. Wer könnte das besser wissen als der Erfinder der Liedzeile „Ich will Spaß, ich geb Gas!“?Ich will Spaß!
Der Text zum Song
„Mein Maserati fährt 210 Schwupp, die Polizei hat’s nicht geseh’n, das macht Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas! Will nicht spar’n, will nicht vernünftig sein, tank nur das gute Super rein, ich mach Spaß! Ich mach Spaß, ich geb Gas! Ich will Spaß, ich will Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas! Ich schubs die Enten aus dem Verkehr Ich jag‘ die Opels vor mir her, ich mach Spaß! Ich mach Spaß, ich mach Spaß! Und kost‘ Benzin auch drei Mark zehn Scheißegal, es wird schon geh’n. Ich will fahr’n! Ich will fahr’n, ich will fahr’n! Deutschland, Deutschland, spürst du mich? Heut nacht komm ich über dich. Das macht Spaß! Das macht Spaß, das macht Spaß! Der Tankwart ist mein bester Freund Hui, wenn ich komm, wie der sich freut. Er braucht Spaß! Er hat Spaß, er hat Spaß! Ich will Spaß, ich will Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas! Ich will Spaß, ich will Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas!”
Interview mit Zygmunt Mierdorf
Zygmunt Mierdorf ist bei der Metro nicht nur für weltweit 260.000 Mitarbeiter verantwortlich, sondern auch für den Future Store bei Düsseldorf, wo neue Technologien wie Computerchips und ein Personal Shopping Assistant getestet werden. Im karriereführer sprach er über die Faszination und den Ruf der Handelsbranche und die Veränderungen, die auf Einsteiger zukommen. Die Fragen stellte Sabine Olschner.
Kann man mit der Verantwortung für 260.000 Mitarbeiter eigentlich noch gut schlafen? Glücklicherweise lastet diese Verantwortung nicht allein auf meinen Schultern. In einem so großen Konzern wie der Metro Group gibt es hoch qualifizierte Mitarbeiter, die mein Vertrauen besitzen und mit denen ich gemeinsam meine Personalaufgaben erfüllen kann. Bei konzernübergreifenden Personalfragen sitzen wir am großen Tisch und erarbeiten bestmögliche Lösungen. Über aktuelle Themen und Projekte wird im kleineren oder größeren Kreis diskutiert und gearbeitet. Was fasziniert Sie an der Handelsbranche? Seine Schnelligkeit: Die Wünsche des Kunden zu erfühlen, bevor er sie selbst real wahrnimmt, ist eine große, manchmal sogar visionäre Aufgabe. Sie dann auch noch in kürzester Zeit zu bewältigen, bedeutet im Vorfeld, schnell Entscheidungen zu treffen. Dieses Tempo fordert natürlich eine sehr hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter. Aber immer wieder höre ich auch von ihnen, wie viel Spaß es macht, die Verantwortung für die Umsetzung neuer Ideen zu übernehmen und zu guten Ergebnissen zu gelangen. Warum hat die Branche bei Hochschulabsolventen noch immer einen so schlechten Ruf? Viele denken auch heute noch beim Thema Handel ans Kisten schleppen und Kittel tragen. Das ist jedoch ein Irrtum, den es auszuräumen gilt. Der Handel ist heute ein hochkomplexer Wirtschaftssektor, wo modernste Technologien und Management- Methoden zum Einsatz kommen. Hier arbeiten Vertriebsspezialisten am profitablen Einkaufserlebnis und Category Manager an der Attraktivität der Sortimente. Und im strategischen Einkauf werden die bestmöglichen Preise und Qualitätsstandards ausgehandelt. Was kann der Handel Einsteigern bieten, was andere Branchen nicht haben? 75 Prozent aller Führungspositionen sind bei uns mit Leistungsträgern aus den eigenen Reihen besetzt. Wenn wir sehen, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter Engagement und Eigeninitiative zeigt, übertragen wir ihr oder ihm schon früh Verantwortung. Es ist durchaus möglich, dass ein junger Mann oder eine junge Frau eine Filiale leitet – und damit bis zu 50 Millionen Euro Nettoumsatz, 100 Mitarbeiter und das Ergebnis verantwortet. Damit führt er oder sie praktisch ein mittelständisches Unternehmen. Wird der Anteil an Hochschulabsolventen in der Branche weiter steigen? Der Handel ist mit 22 Millionen Beschäftigten der zweitgrößte Arbeitgeber Europas. Die Metro ist dabei die Nummer eins in Deutschland und weltweit der viertgrößte Handelskonzern. Mit der Expansion unseres Konzerns im In- und Ausland ist der Bedarf an Akademikern in den vergangenen Jahren ständig gestiegen und wird auch weiter steigen. Unser Einstellungsbedarf liegt jährlich weltweit bei rund 200 bis 250 Hochschulabsolventen. Meist handelt es sich um Absolventen mit betriebswirtschaftlichem Studium mit den Schwerpunkten Einkauf, Controlling, Vertrieb oder Category Management. Welche Eigenschaften sind im Handel unverzichtbar? Wer sich für einen Einstieg im Handel interessiert, sollte möglichst schon während des Studiums praktische Phasen durchlaufen, bei der Diplomarbeit mit Handelsunternehmen kooperieren oder das Studium international ausrichten. Das rasante Tempo und die permanente Veränderung unserer Zeit betreffen den Handel natürlich ebenso, und damit auch die Anforderungen an seine Mitarbeiter. Die Fähigkeit, sich selbst stetig neu zu erfinden, ist die Grundlage dafür, Kundenwünsche zu erkennen und zu erfüllen. Der ideale Bewerber sollte daher kundenorientiert denken, interkulturelle Kompetenz, ein hohes Maß an Lernbereitschaft und die Fähigkeit mitbringen, das Unternehmen als permanenten Lernort zu nutzen. Gibt es für Einsteiger die Möglichkeit, international tätig zu sein? Neben dem nationalen Markt bietet gerade das Auslandsgeschäft dem Führungsnachwuchs interessante Optionen. Schon während unseres Traineeprogramms absolvieren einige Nachwuchskräfte ihre ersten Auslandsstationen. Später bieten wir interessierten Mitarbeitern die Chance, sich über die Grenzen von Ländern und Gesellschaften hinweg zu entwickeln. Steht dann ein Auslandseinsatz an, werden die Mitarbeiter speziell vorbereitet und im Rahmen eines Expatriate-Programms betreut. Aber auch am Standort Deutschland arbeiten wir in Teams, in denen mehrere Nationen vertreten sind. Sie sind der Vater des Metro Future Stores. Was verbirgt sich dahinter? Der Future Store in Rheinberg ist der Supermarkt der Zukunft. In diesem Verbrauchermarkt testen wir zusammen mit über 60 Kooperationspartnern neue Lösungen für das Lagermanagement und den Verkauf. Im Mittelpunkt steht dabei der Nutzen für den Verbraucher. So haben wir beispielsweise Selbstzahlerkassen getestet, die wir nun schrittweise in anderen Märkten einsetzen. Aber es geht uns nicht darum, die traditionellen Kassen zu ersetzen. Vielmehr wollen wir ein zusätzliches Angebot schaffen. Der Kunde soll selbst entscheiden, ob er lieber eine traditionelle Kasse nutzt oder eine Selbstzahlerkasse. Sieht so der Handel der Zukunft aus? Der Future Store ist zunächst einmal so etwas wie ein Labor, in dem wir neue Technologien zusammen mit unseren Partnern erproben. Jede einzelne neue Technologie muss hier beweisen, ob sie tatsächlich alltagstauglich ist. Erst wenn eine Neuerung diesen Testlauf erfolgreich absolviert hat, kann sie in anderen Märkten zum Einsatz kommen. Was bedeuten diese Veränderungen für den Einsteiger? Das Thema Zukunft spielt insgesamt eine große Rolle. Der Arbeitsalltag unserer Mitarbeiter ist längst geprägt durch den Einsatz modernster Technologien. Aus diesem Grund erwarten wir auch von unserem Führungsnachwuchs, dass er nicht nur offen ist gegenüber Veränderungen, sondern insbesondere auch für den Umgang mit neuen Technologien.Zur Person
Zygmunt Mierdorf wurde 1952 in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Wiesbaden. Nach Geschäftsführerpositionen bei Betrix Cosmetics, LRE Inc. Group (Leach Relais & Electronic) und Black & Decker Deutschland nahm er seit 1991 verschiedene Führungsaufgaben innerhalb der Metro wahr. 1999 wurde Zygmunt Mierdorf in den Vorstand der Metro AG berufen . Er ist Arbeitsdirektor und zuständig für Personal und Soziales, Informatik, Logistik, E-Business und Immobilien. Darüber hinaus ist er als Coach verantwortlich für die Vertriebslinien Media/Saturn und Real. Zygmunt Mierdorf ist verheiratet, hat zwei Kinder und widmet sich in seiner Freizeit seinen Hobbys Tennis, Golf, Radfahren und Joggen.
Interview mit Dr. Konstantin Mettenheimer
Er verbindet bei seiner Tätigkeit deutsches mit internationalem Wirtschaftsrecht, Tradition mit Zukunft, aber vor allem Menschen miteinander. Der ständige Kontakt mit ihnen macht ihm bei seiner Arbeit den meisten Spaß. Deswegen legt er beim beruflichen Nachwuchs auch größten Wert auf ihre menschlichen Fähigkeiten. Mit dem karriereführer spricht er über Verantwortung, Erfolg und was damit einhergeht. Das Interview führte Meike Nachtwey.
Sie wurden kürzlich als „Brückenbauer zwischen europäischer Rechtstradition und einem sich weltweit fortbildenden Wirtschaftsrecht“ bezeichnet. Wie gefällt Ihnen diese Bezeichnung? Gut! Ein Brückenbauer schafft Verbindungen zu neuen Ufern und die Brücke dazwischen. Die organisatorischen Aufgaben und der ständige Kontakt mit Menschen sind die Dinge, die mir an meiner Aufgabe am besten gefallen. Sehen Sie sich als Vorbild für junge Juristen? Ob ich ein Vorbild bin, weiß ich nicht, aber ich bemühe mich. Mir selbst macht es Spaß, Dinge erfolgreich zu planen und umzusetzen, das versuche ich vorzuleben. Jedoch sollte jeder Mensch seinen eigenen Plan haben und nicht bloß Vorbildern nacheifern. Wie viele Stunden pro Woche muss ein aufstrebender Anwalt bereit sein zu arbeiten, damit er eines Tages auf eine Karriere wie die Ihre blicken kann? Unter 50 Stunden kommen Sie, wenn Sie wirklich erfolgreich sein wollen, nicht weg. Aber bei einem Anwalt geht es nicht nur um die Stunden im Büro, sondern auch darum, wie man sich in der Wirtschaftswelt zurechtfindet. Es ist wichtig, ein kluger juristischer Kopf zu sein und ein unternehmerisches Element zu haben. Sie müssen Kontakte zu Menschen mögen und pflegen. Bei aller Arbeit sollte aber eine vernünftige Work- Life-Balance nicht vergessen werden. Wie kann man sich auf die spätere Tätigkeit in einer Law Firm wie Freshfields vorbereiten? Zunächst mal: engagiertes Studium und gute Noten. Was Sie im Studium leisten, um gute Noten zu bekommen, ist das gleiche, was Sie später als Anwalt leisten müssen, um einen guten Mandanten zu bekommen. Zweitens: Promotion, LL.M., Praktikum im Ausland. Diese Qualifikationen sind kein Muss, aber sie zeigen, aha, da will jemand etwas aus sich machen. Drittens: menschliche Qualitäten, Teamplayer sein, mit Mandanten umgehen können. Und nicht zuletzt benötigt man auch einige wirtschaftliche Kenntnisse. Arbeiten Sie als einer von zwei weltweiten Seniorpartnern überhaupt noch anwaltlich? Ja, daran liegt mir viel. Etwa ein Drittel meiner Tätigkeit ist anwaltlich. Dabei bin ich in den Bereichen Corporate Governance und Compliance sowie Risk Management tätig. Vor allem treffe ich viele Mandanten, um nachzuhören, ob sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Das ist vielleicht nicht mehr Jura im engeren Sinn, aber dennoch Anwaltstätigkeit und juristische Dienstleistung. Das Wirtschaftsrecht wird immer internationaler. Welche Rolle spielt dabei noch das deutsche Jura-Studium? Wenn man Anwalt sein will – egal wie international – dann muss man erst einmal ein nationales Recht erlernen. Ansonsten hat man keine Basis und keinen juristischen Denkansatz. Danach kommt die spannende Frage: Wie geht man damit um? Künftig werden wir auch mit deutschen Juristen vermehrt im Ausland tätig sein. Die Nachfrage wächst. Ich rate jungen Anwälten immer, Zeit im Ausland zu verbringen. So lernen sie, in einer internationalen Struktur zu agieren. Würden Sie einem Hochschulabsolventen raten, in eine Boutique einzusteigen oder eher in eine Großkanzlei? Das ist immer eine Frage der Zielrichtung. Wenn ich nur in einem speziellen deutschen Rechtsbereich mit deutschen Mandanten praktizieren möchte, dann ist es sinnvoll, in eine Boutique zu gehen. Will ich aber erst einmal einen Überblick bekommen und mich breit aufstellen, ist der Einstieg in eine Großkanzlei sinnvoller. Was sind die Vorteile einer Großkanzlei wie Freshfields? Die spannenden Mandate, über die Sie in der Zeitung lesen und bei denen Rechtsgeschichte geschrieben wird, – die bearbeiten Sie bei uns. Natürlich hat man bei einer Kanzlei unserer Dimension nicht gleich den Überblick. Aber dafür bekommt man eine starke und kollegiale Förderung – auch in Gebieten, die das Studium nicht vermittelt. Die Wurzeln der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer gehen bis ins 18. Jahrhundert. Welche Rolle spielt Tradition heute noch? Das spielt insofern eine Rolle, als dass wir hier alle Treuhänder sind. Wir haben eine Sozietät mit vielen hundert Jahren Geschichte übernommen, und jeder bei Freshfields ist dazu aufgerufen, eine noch bessere Sozietät zu schaffen und zu hinterlassen, als die, bei der er angefangen hat. Sie sind nicht nur Partner derer, die heute da sind, Sie sind auch Partner derer, die vor Ihnen da waren und die nach Ihnen kommen. Sie tragen eine große Verantwortung in Ihrer Position – wie lernt man, damit umzugehen? Wenn man Glück hat, von seinen Eltern. Man lernt es auch, indem man sich bewusst macht, ob man in der Lage und willens ist, sie zu tragen. Zuhören ist außerdem wichtig. Und über das Gehörte nachdenken. Das ist wichtig für die Kommunikation und hilft dabei, zu führen und Verantwortung wahrzunehmen. Trägt ein einflussreiches Unternehmen wie Freshfields Verantwortung für die Gesellschaft? Unternehmerische gesellschaftliche Verantwortung, Corporate Social Res – ponsibility, ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir engagieren uns sehr vielfältig, auch außerhalb der Kanzlei. Es ist vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin ein Beitrag. Freshfields wurde erst neulich von PLC Which Lawyer als Kanzlei des Jahres in Westeuropa und Internationale Kanzlei des Jahres ausgezeichnet. Macht Sie das stolz? Ja, das macht mich sehr stolz. Das ist eine Anerkennung für harte Arbeit und die Zufriedenheit der Mandanten. Aber nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es ist also auch eine Aufforderung, sich weiter zu engagieren und sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Meine größte berufliche Herausforderung ist, dass ich die Sozietät ganz oben auf dem internationalen Treppchen sehen möchte. Haben Sie einen Karriere-Tipp für Hochschulabsolventen? Für besonders wichtig halte ich drei Eigenschaften: erstens Einsatz und Ehrgeiz, zweitens Menschlichkeit und drittens das nötige Selbstbewusstsein, gepaart mit einer angemessenen Bescheidenheit.Zur Person
Dr. Konstantin Mettenheimer wurde 1955 in Frankfurt am Main geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Deutschland und der Schweiz und promovierte ebenfalls in den Rechtswissenschaften. Er erwarb zudem einen Master of Business Administration an der Wharton School der University of Pennsylvania. Bei Freshfields Bruckhaus Deringer ist er seit 1987 tätig. Bereits nach drei Jahren wurde er Partner. Von 2000 bis 2004 war er Geschäftsführender Partner für Deutschland, Österreich und Zentralosteuropa. Seit Mai 2004 ist er Co-Seniorpartner der Sozietät und der einzige Deutsche, der an der Weltspitze einer Law Firm dieser Größe steht. Seine Beratungsschwerpunkte sind Corporate Governance und Compliance.
Zum Unternehmen
Freshfields Bruckhaus Deringer besteht in ihrer heutigen Form seit 2000, als sich die britische Anwaltssozietät Freshfields mit der deutschen Kanzlei Deringer und der deutsch-österreichischen Sozietät Bruckhaus zusammenschloss. In 15 Ländern vertreten verfügt Freshfields über 26 Büros weltweit. Mehr als 2500 Anwälte und über 400 Partner sind bei dem Unternehmen tätig. Allein in der Bundesrepublik ist Freshfields Bruckhaus Deringer an sechs Standorten mit 600 Anwälten vertreten. Die Schwerpunkte der Kanzlei liegen in der Beratung nationaler und multinationaler Unternehmen, Finanzinstitute und Institutionen. Zu den deutschen Kunden zählen Porsche, Deutsche Bahn, E.on, Deutsche Telekom, Continental und mehrere Landesbanken.
Interview mit Frank Mattern
Hoch hinaus wollte er schon immer – und das ist ihm gelungen. In doppeltem Sinne: Frank Mattern, 45, ist neuer Deutschland-Chef von McKinsey und sitzt in der 21. Etage des Japan Towers am Taunustor.
Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie im Januar 2007 McKinsey Deutschland-Chef geworden sind? Mein Leben und meine Arbeit sind noch vielfältiger geworden. Ich habe eine der attraktivsten Führungsaufgaben in der deutschen Wirtschaft übernommen. Denn als Beratungsfirma, deren höchstes Gut das Wissen ist, sind wir in einem ganz besonderen Maße auf die Qualität und die Motivation unserer Mitarbeiter angewiesen. Das stellt hohe Anforderungen an meine Führungsrolle. Ich lerne viel, aber ich kann auch viel weitergeben. Welchen Anspruch haben Sie an sich selbst als Führungskraft? Wir wollen der nächsten Generation eine stärkere Firma überantworten, als wir sie vorgefunden haben. Als Partnerschaft verfolgen wir im Gegensatz zu vielen börsennotierten Unternehmen, die ja zum Teil sehr kurzfristig denken müssen, längerfristige Ziele. Das gilt auch für mich als deutscher Office Manager. Ich will uns als globale Organisation weiterentwickeln – mit Beharrlichkeit, aber auch mit Geduld. Das bietet ein enormes Entwicklungspotenzial für junge, offene Menschen. Für uns gehören Recruiting und Talentmanagement zu den wichtigsten langfristigen Erfolgsfaktoren. McKinsey hat bereits vor Jahren den Begriff „War for Talent“ dafür geprägt. Was macht generell eine gute Führungskraft aus? Vor allem: zuhören können. Sie muss ihre Mitarbeiter motivieren und eine Perspektive prägen – andere würden sagen: eine Vision. Jede gute Führungskraft sollte ihren Stil an die unterschiedlichen Bedürfnisse anpassen, die sich je nach Entwicklungsphase des Unternehmens ändern können. Es gibt „Evergreens“ unter den Qualitäten, die von Führungskräften gefordert werden, Lernfähigkeit zum Beispiel oder Kommunikationsverhalten. Doch das Umfeld hat sich entscheidend verändert: Führungskräfte sind immer weniger Teil des operativen Geschäfts, sondern zunehmend Manager unterschiedlichster Stakeholder-Interessen. Welche neuen Skills braucht eine Führungskraft also? Die jungen Mitarbeiter stellen Fragen, die weit über interne Angelegenheiten hinausgehen. Fast alle Branchen müssen sich mit den teils dramatischen Konsequenzen der Globalisierung auseinandersetzen. Der Druck der Stakeholder wächst, die heute aus eigenen Überlegungen heraus Strategien entwickeln, unabhängig von den Zielen des Managements. Dazu kommt die rasante Digitalisierung unserer Welt, die unsere Art zu arbeiten oder zu kommunizieren fast täglich neu verändert. Die Nachhaltigkeit unseres Handelns erhält eine immer stärkere Bedeutung. Nehmen Sie nur die Diskussion um das Thema Corporate Social Responsibility oder den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Wirtschaft. Diesen Fragen muss ich mich als Führungskraft stellen können. Gab es auf Ihrem Weg nach oben Hürden, die Sie nehmen mussten? In einer professionellen Karriere gibt es natürlich viele formale Hürden: die Schule, das Studium, die Business School. Ich zum Beispiel musste dafür ein Stipendium gewinnen, sonst hätte ich sie nicht besuchen können, und McKinsey ist ein anspruchsvolles Unternehmen, auch seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber. Ich habe all dies aber nie als Hürde empfunden. Wenn Sie mich hingegen fragen, welche Herausforderungen für mich schwierig waren, kann ich sagen: Gerade als junger Berater habe ich viel mit der Frage gekämpft, wie ich mich als 28-Jähriger mit Menschen auseinandersetzen kann, die einen ganz anderen Hintergrund haben als ich, die aus einer anderen Welt kommen. Wie kann ich sicherstellen, dass sie mir vertrauen und zuhören? Wie kann ich es schaffen, eine persönliche Bindung zu ganz unterschiedlichen Menschen aufzubauen? Das war nicht immer einfach und ist mir anfangs schwergefallen – vor allem, wenn man gerade eine stark akademisch orientierte Ausbildung hinter sich hat. Wir bei McKinsey versuchen, diese Einstellung zu ändern: Wir wollen aus den oft kopfgesteuerten jungen Hochschulabsolventen Menschen machen, die mit der Seele, dem Herzen und dem ganzen Verstand arbeiten können. Diese Reise musste ich auch machen. Gab es Niederlagen, aus denen Sie gelernt haben? Ich habe Niederlagen nie als Niederlagen empfunden – eher als Enttäuschungen, wenn zum Beispiel etwas nicht funktioniert hat oder ich mich bei einem Klienten blamiert habe. Auch das kommt vor. Ich habe von einem älteren Kollegen, der mittlerweile im Ruhestand ist, gelernt: Solche Enttäuschungen sollte man immer als Chance verstehen, von der man lernen kann. Was hat nicht funktioniert? Warum konnte ich nicht erfolgreich sein? Was mache ich beim nächsten Mal anders? Solche Situationen gibt es oft: Je höhere Ziele man sich setzt, umso häufiger wird man mit Enttäuschungen konfrontiert. Damit konstruktiv umzugehen, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Karriere als Führungspersönlichkeit. Wie wichtig waren Mentoren auf Ihrem Weg nach oben? Enorm wichtig. Als ich vor 17 Jahren bei McKinsey in Frankfurt anfing, lernte ich dort Partner kennen, die ich sehr interessant und überzeugend fand, und ich habe gemerkt, dass ich bei denen Wichtiges lernen kann. Diese Kollegen haben sich dann über viele Jahre als meine Mentoren entwickelt. Für ein erfolgreiches Mentoring braucht man jedoch immer zwei: einen Mentor, aber auch jemanden, der sich „mentoren“ lassen will – bezeichnenderweise gibt es dafür kein deutsches Wort. Was ist wichtiger für die Karriere: Spezialisierung oder Generalisierung? Ich würde nicht das Wort Spezialisierung verwenden, das hört sich zu sehr nach Verengung an. Besser ist es, sich in einem bestimmten Feld Expertise aufzubauen. Es gibt Berufe, bei denen Spezialisierung manchmal sogar unabdingbar ist: in der Wissenschaft, als Rechtsanwalt oder als Mediziner. Viel wichtiger bei der Entwicklung von Führungskräften fürs Management ist die „Diversity“, also die Vielfalt von Erfahrungen in unterschiedlichen Aufgaben. Hinzu kommt die regelmäßige Erneuerung. Wir nennen das „Renewal“. Welche Rolle spielt das „Renewal“ für beruflichen Erfolg? Nach sechs bis acht Jahren kommt man im Management, egal auf welche Ebene, erfahrungsgemäß an einen Punkt, an dem eigentlich alles gesagt und getan ist, was gesagt und getan werden konnte. Dann sollte man den nächsten Schritt machen und sich weiterentwickeln, indem man das Umfeld verändert, in dem man arbeitet. Auch ich habe das getan. Die Veränderung kann eine geografische sein oder auch ein Rollenwechsel innerhalb der Firma. Entscheidend ist dabei die Frage, ob ich mich eigentlich noch weiter entwickle oder schon anfange, mich zu wiederholen. Ich sehe bei vielen Führungskräften, dass sie diesen Zeitpunkt verpassen – weil es natürlich bequem ist: Man kennt sich aus, man weiß, wie die Arbeit funktioniert, man hat sein Netzwerk. Doch das reicht nicht. Ein geradliniger Lebenslauf ist Ihrer Meinung nach nicht mehr unabdingbare Voraussetzung für eine Karriere? Wichtig ist Weiterentwicklung. Und die ist natürlich auch innerhalb eines geradlinigen Lebenslauf möglich – wenn man ausreichend für Renewal und Bewegung sorgt. Wer sich immer weiter spezialisiert und glaubt, irgendwann unersetzbar zu sein, hat einen Fehler gemacht. Ich würde jedem empfehlen, sich sehr vielfältig zu entwickeln und Expertise aufzubauen, auch in verwandten Feldern. Ich warne auch vor einer sehr linearen Karrierelogik: Bei McKinsey ist der Begriff Karriereorientierung negativ belegt. Wir mögen es nicht, wenn Mitarbeiter ständig die Frage stellen, welche Belohnung sie für eine Aufgabe bekommen. Unsere Antwort ist: Mach deine Sache gut, dann werden schon weitere gute Dinge passieren. Ist es nicht einfacher, in Zwei-Jahres-Zyklen innerhalb mehrerer Unternehmen Karriere zu machen als langfristig in einer Position? In zwei Jahren kann man in einer Führungsaufgabe nicht wirklich etwas verändern. Man muss sich schließlich erst einen Namen machen, sich beruflich qualifizieren und gegenüber anderen hervortun, wenn man weiterkommen will. Sehr schnelle Wechsel kann man sich vielleicht am Anfang der Karriere ein- oder zweimal leisten. Aber irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man nicht nur lernen kann, sondern auch Ergebnisse liefern muss, und dafür braucht man Zeit, das lässt sich nachhaltig orientiert nicht in zwei Jahren machen. Ich finde es insgesamt auch viel befriedigender, Dinge über ein paar Jahre zum Erfolg zu führen und dann tatsächliche Ergebnisse zu sehen. Wie kann man sich für ein Unternehmen unverzichtbar machen? Ich finde, man sollte sich überhaupt nicht unverzichtbar machen. Auch ich bin nicht unverzichtbar. Niemand ist das. Es ist falsch für das Unternehmen und auch für den Menschen selbst. Stattdessen sollte man überlegen, wo die Leute sind, die einen irgendwann einmal ersetzen können – und wie man sie fördern kann. Ich kann mich immer nur weiterentwickeln, wenn ich Leute hinter mir habe, die ich herangezogen habe. Die Geschichte zeigt: Erfolgreiche Führungskräfte ziehen immer eine ganze Gruppe von guten Leuten nach. Wie können junge Führungskräfte in der Wirtschaft demotivierte Mitarbeiter zu guter Arbeit anspornen? Führungskräfte müssen verstehen, wie die Motivationslage jedes einzelnen Menschen ist. Jedes Unternehmen hat bestimmte Ziele. Die Frage ist: Wie kann ich diese Ziele in Einklang bringen mit den persönlichen Zielen und der Lebenswelt des Mitarbeiters? Wenn ich es nicht schaffe, mich in das sogenannte „Mindset“ meines Mitarbeiters hineinzuversetzen, dann kann ich lange Reden und Predigten halten – ich werde den Menschen nicht wirklich erreichen. Anreiz- und Bonussysteme sind sicher gut und richtig, um Motivation zu steigern. Aber gehen sie wirklich auf die tiefer liegenden Motivationsstrukturen eines Menschen ein? Ich bezweifle das. Motivationsprobleme haben meist überhaupt nichts mit Geld zu tun, sondern eher mit der Frage, wie ich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter seinen Wertbeitrag vermitteln und wie er seine besonderen Fähigkeiten dafür einsetzen kann. Sich in diesem Maße in einen Menschen hineinzuversetzen, ist die wirkliche Kunst einer Führungskraft. Auf diesem Weg wird sie Leute nicht nur motivieren, sondern begeistern können. Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus: Wird unbegrenzte Mobilität künftig unverzichtbar werden? Auf der einen Seite nimmt die Notwendigkeit, sich international zu bewegen, erheblich zu. Weltweit tätige Unternehmen brauchen Führungsnachwuchs, der bereit und imstande ist, in allen Ländern der Welt zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist diese Art zu arbeiten nicht für jeden geeignet. Denn der zweite große Trend neben der Mobilität heißt Work-Life-Balance. Vor allem junge Mitarbeiter haben eine andere Einstellung zur Work-Life-Balance: Sie arbeiten hart, sind anspruchsvoll, wollen in ihrem Beruf etwas leisten. Aber sie wollen auch ihr Privat- oder Familienleben schützen. McKinsey reagiert darauf mit mehr Flexibilität, Teilzeitmöglichkeiten oder Vaterschaftsurlaub. Wir ermöglichen es gerade jungen Beraterinnen und Beratern in einem neuen Programm, während ihrer ersten Jahre bei McKinsey auf drei Kontinenten zu arbeiten. Aber wer eine junge Familie hat, hat vielleicht kein Interesse daran, innerhalb von zwei Jahren an drei verschiedenen Orten der Welt zu leben. Die meisten machen das vorher – oder deutlich später, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Worauf legen junge Mitarbeiter aus Ihrer Sicht heutzutage bei der Wahl ihres Arbeitgebers besonderen Wert? Die Qualität von Produkten und Dienstleistungen spielt bereits seit Jahren eine große Rolle, wie unterschiedliche Studien zeigen. Ich finde das etwas überraschend, weil es auch viele Unternehmen mit weniger bekannten oder attraktiven Produkten gibt, die herausfordernde Aufgaben bieten können. Darüber hinaus legen junge Menschen schon lange Wert auf Karrierechancen, Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen. Neue Themen, die für die Wahl eines Arbeitgebers eine Rolle spielen, sind: Internationalisierung und wie kann ich an ihr teilhaben. Und, besonders bei Frauen, die soziale Verantwortung der Firma. Wie wichtig ist unternehmerisches Denken der Mitarbeiter? Unternehmerisches Denken ist das Gegenteil von Angestelltenmentalität. Solche Menschen denken: Du willst, dass ich was mache – sag mir, was ich dafür bekomme. Wir hingegen erwarten, dass unsere Leute leistungsbereit sind, dass sie in Vorlage gehen, sich anstrengen, dass sie Dinge ausprobieren und stark eigenengagiert sind. Das sind die Voraussetzungen, auf denen junge Mitarbeiter bei uns eine Karriere aufbauen können.Zur Person
Es geschah in der Zeit um 1961, als McKinsey-Mann John G. McDonald die Eröffnung des ersten Büros auf dem europäischen Festland vorbereitete: Am Heiligen Abend des Jahres 1961 wird Frank Mattern in Krefeld am Niederrhein geboren. 45 Jahre später ist er Deutschland-Chef von McKinsey. Dazwischen liegen die Jahre seines BWL-Studiums in Münster und London und die Zeit an der Wharton School in Pennsylvania, USA – dort erlangte er seinen Master of Business Administration. Bei McKinsey ist er seit 1990, wo er schnell zum Experten der Bankenbranche avancierte: Fünf Jahre später ist er Partner, nach weiteren vier Jahren Director, seit Januar 2007 Deutschland-Chef. Frank Mattern ist begeisterter Golfer und Geschichts-Fan, verheiratet und hat drei Kinder. Ein Weihnachtskind mit einem guten Stern im Leben.
Interview mit Lovro Mandac
Was auf dem Kassenzettel steht, sind zum Beispiel Jeans, Weingläser, CDs oder ein Hut – was dahinter steht, ist das „Erlebnis: Einkauf“. Und wiederum dahinter steht er. Bei allem, was Lovro Mandac – Vorstandsvorsitzender der Kaufhof Warenhaus AG – macht, hat er eines fest im Visier: Die Zukunft. Ein Gespräch mit ihm über Japan und Harmonie, Fernsehen zum Frühstück, Marotten und Krawatten, Mitarbeiter und Muskelspiele, Glühbirnen und Macht. Von Viola Strüder
„Nachdem Sie genug genervt haben,“ hat Lovro Mandac den charmanten Satz der Schulleitung noch im Ohr, mit dem man ihm zum Abitur gratulierte. 18 Jahre und 363 Tage war er – und Schülersprecher dazu. Dabei war sein Verhältnis zu den Lehrern ein gutes, hatten sie doch sein Interesse für Philosophie und Archäologie geweckt. Warum er dennoch einem Studium der Betriebwirtschaftlehre den Vorzug gab? „Ganz simpel: Geld verdienen. Zukunft“, führt er aus und die geldtypische Hand-Geste vor. Von oben nach oben Als Vorstandsvorsitzender ist Lovro Mandac oben – und von oben kommt der 52-Jährige auch: aus Flensburg. Erste Pluspunkte sammelte er als Praktikant in der Auslandsabteilung einer Bank. Bevor er an seinem Wahlstudienort Hamburg loslegen durfte, erging es ihm wie den meisten Studenten: Er kämpfte sich durch die Aufnahmeprüfung für Mathematik und Statistik. „Furchtbar“, verzerrt er das Gesicht „was man dort mit uns angestellt hat“. Danach befragt, ob er die höhere Mathematik denn gegenwärtig brauche, gibt er augenzwinkernd zu: „Heute geht es nur um Plus und Minus.“ Seine Fächerkombination Finanzen, Personal sowie Recht der Öffentlichen Verwaltung würde er „nie mehr“ wählen. Stattdessen: „Internationales Management, Personal und Volkswirtschaftlehre.“ Letztere, weil er die wirtschaftlichen Zusammenhänge dort für besser erklärt hält. Seine Diplomarbeit hatte mit der „Zusammenarbeit der Volks- und Raiffeisenbanken“ zu tun. „Die hat wahrscheinlich gar keiner gelesen“, hakt er ab. Das BWL-Studium unterbrach er für zwei Jahre, um einer Tätigkeit im Auslands-Ressort der Deutschen Bank nachzugehen, „aus Begeisterung, nicht aus finanziellen Motiven“. Die Rahmenbedingungen für seine Ausbildung seien dank Elternhaus gut gewesen, was er zu schätzen wisse. Einstiegsformel: 2.7 x 14 + Auto Gab es damals Ängste bei den Studierenden, keinen Job zu finden? „Es gab keinen Grund, Angst zu haben.“ 1977, als er sein Studium beendet hatte, waren die Zeiten für Akademiker durchweg gut. „Ich konnte damals aus drei Angeboten wählen,“ erinnert er sich. Der junge Diplom-Kaufmann entschied sich für eine Mitarbeit bei der Thorn/EMI GmbH in Hamburg. Die Formel für den Einstieg lautete so: „2.700 Mark brutto mal 14. – Plus Auto.“ Die Freude über dieses „Plus“ ist ihm heute noch anzumerken: „Mit 27 Jahren ein allzeit bereites Auto samt Benzin vor der Tür zu haben, das war damals glatt einen Tausender wert.“ Zwischen Yen und Zen Als Höhepunkt seines jungen Berufslebens empfand Lovro Mandac den Aufenthalt in Japan. „Es war eine Ehre für einen Deutschen, in dieses Camp aufgenommen zu werden.“ Die Managementlehre dort, die Mentalität und Lebensweise, die Art des Glaubens, letztlich die japanische Kultur haben ihn tief beeindruckt und nachhaltig beeinflusst. Das hohe Maß an Disziplin der Japaner schildert Lovro Mandac anhand eines Alltagsbeispiels: „Sie stehen morgens in der U-Bahn, auf das Dichteste gedrängt, bei über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit und brauchen beim Verlassen der Bahn wieder 20 Minuten, um sieben Etagen höher ans Tageslicht zu gelangen. – Wenn Sie in Japan nicht diszipliniert sind, gehen Sie unter.“ Eine Form der Strategischen Planung lernte er dort kennen, die hier zu Lande und besonders in diesen Wirtschaftszeiten wie aus dem Märchenbuch klingt: „Die Firma, für die ich in Japan tätig war, machte Ein-, Drei-, Zehn- und Fünfzig-Jahrespläne. Die Vision ging auf: Nach Fünfzig Jahren stand das Unternehmen exakt da, wo es die Planung vor einem halben Jahrhundert vorsah.“ Das Unternehmen – das ist in Japan die Familie. Harmonie sei wichtig, damit man erfolgreich sein könne, und dafür habe das Familienoberhaupt Sorge zu tragen. Eine Philosophie, die Lovro Mandac übernommen hat – die zu ihm passt. So wie er am Konferenztisch sitzt, Fenster und Türe gleichermaßen im Blick, zugewandt und konzentriert auf das Gespräch vermittelt er nicht das Bild des wild fuchtelnden Direktors, sondern in der Tat das des „Familienvaters“ und durch Erfahrung geschulten Beraters. Eine Bärenruhe strahlt er aus. Man stellt sich vor, dass er stets ein wachsames Auge über allem hat, er die ihm anvertrauten 30 000 Mitarbeiter als Team zusammenhält und, wenn’s angebracht ist, sich aufbäumt und kämpft. Einkaufs-Erlebnis als Arbeits-Ergebnis Eine Karrierelaufbahn im Kaufhof richtet sich nicht allein nach Formal-Abschlüssen. Ob Lehre oder Berufsakademie, ob Diplom einer Fachhochschule, Abschluss einer Universität oder Quereinstieg steht hier nicht im Vordergrund. Lovro Mandac nennt ein ihm wichtiges Kriterium der Mitarbeiterauswahl: „Eigenverantwortung erwarte ich von jedem Einzelnen.“ Dies solle Freiheit schaffen für eigenständiges Denken und Handeln. Selbstbewusstsein und Urvertrauen sollen gestärkt werden. Loyalität setzt er voraus. Dass Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit haben, wünsche er sich. Schließlich verkauft das Unternehmen eine Erlebnis-Welt. Ritualisierte Ansporntherapien gibt es bei ihm nicht. „Motivation kann auch in einem Lächeln bestehen“. Muskelspiele „Wie ich mit Menschen umzugehen habe,“ ist nach seiner Auffassung das wichtigste, was er lernen musste und was keine Ausbildung vermitteln konnte. Lovro Mandac beugt sich etwas vor und untermalt die goldene Regel: „Schenke den Menschen ein Lächeln“. Ein Ansatz, den er gerade jungen Führungskräften heute empfiehlt und den eigenen vermitteln möchte. „Schon deshalb, weil es Kraft spart, weniger Gesichtsmuskeln beansprucht.“ Und weiter: „Das Lächeln, das Du aussendest, kehrt zu Dir zurück.“ – Je bedeutsamer Lovro Mandac etwas ist, desto mehr senkt er die Stimme. „Man darf den Menschen nicht die Haut vom Gesicht ziehen. Ich habe oft erlebt, dass dies passiert“, sagt er nachdenklich. Diese Erfahrung habe ihn sensibel gemacht für das Miteinander auch oder gerade in schwierigen Situationen. Frühstück mit Fernsehen und drei Zeitungen Worin besteht eigentlich die Haupttätigkeit eines Vorstandsvorsitzenden? „Ich kommuniziere – persönlich, per Telefon, per Brief oder per E-Mail“, bringt Lovro Mandac den Job auf einen Nenner. Und wie sieht ein normaler Arbeitstag bei ihm aus? Um sechs Uhr startet er mit drei Zeitungen: „Kölner Stadt-Anzeiger, Süddeutsche und Welt“, zählen zur Pflichtlektüre; dazu „eine Sequenz Frühstücksfernsehen“. Der Tag endet um 20 oder 21 Uhr, je nach Anlass auch später. Aussicht mit Weitsicht „Macht ist immer nur an Aufgaben gebunden, nicht an Personen. Ich habe viele erlebt, die Angst davor haben, sich morgen die Türe wieder selbst aufmachen zu müssen. Ich gehöre nicht dazu.“ Mit 60 Jahren möchte er gehen. Ein „Bellheim“ ist er ohnehin nicht. Das Weitermachen bis 70 halte er für Unsinn, irgendwann müsse man jüngere Leute ranlassen. Die Betonung weist darauf hin, dass er den alters- und hierarchiebedingten Sesselkleber nicht erfunden hat. Vielmehr hat Lovro Mandac seine Zukunft nach dem offiziellen Arbeitsleben bereits geplant: „Im Lobbyismus“ will er dann tätig sein, denn es liege so viel im Argen in diesem Land. Was alles würde er machen, wenn er „König von Deutschland wär’“? „Für Deregulierung sorgen“, lautet die Antwort und sein Stichwort. – Als engagierter Streiter in Sachen Ladenöffnungszeiten ist er seit Jahren bekannt. Es ist anzunehmen, dass seine Themen Gehör finden werden, schon deshalb, weil er vor großem Publikum Entertainer-Qualitäten vorzuweisen hat – sich mühelos bewegt zwischen harten Fakten, Erzürnung und Humor. Von Marotten, Krawatten und Glühbirnen Eigenheiten zum Finale: Es stand zu lesen, dass er ein Faible für schrille Krawatten haben soll. „Stimmt.“ Bloß heute nicht, da trägt er Kaufhof-Corporate-Green, ein weißes Hemd und einen hellgrauen Anzug. Nobel-Hobbys sind nicht seine Sache. Urlaub? Den verbringt er gerne mit „Wandern auf Mallorca“. Ob er neben der Kopfarbeit auch handwerkliche Begabungen habe? „Nein, überhaupt nicht.“ Schon das Eindrehen einer Glühbirne sei nichts für ihn. Irgendwelche Marotten? „Da fällt mir nichts ein, ich bin nicht nervös, schneide keine Grimassen“, sinniert er. Ein freundliches Lächeln gibt’s zum Abschied. Lovro Mandac geht aus dem Raum – und dreht schwungvoll die Brille ums Handgelenk.Zur Person
Alter: 53 Jahre Studium: Wirtschaftswissenschaften in Hamburg; Abschluss 1977 als Diplom-Kaufmann Berufliche Stationen: Thorn/EMI, Hapag-Lloyd-Flug, Panasonic Kaufhof-Karriere: Seit 1987 in verschiedenen Positionen beim Kaufhof-Konzern tätig. Seit 1994 ist Lovro Mandac Vorstandsvorsitzender der Kaufhof Warenhaus AG
Das Unternehmen
Geschichte: Gegründet 1879 von Leonhard Tietz als Einzelhandelsgeschäft. Heute: Die Kaufhof Warenhaus AG unterhält 134 Filialen in über 80 deutschen Städten. Dazu 15 Filialen in belgischen Städten. Netto-Umsatz 2001: Vier Milliarden Euro. Anzahl der Kunden: Täglich zwei Millionen. Anzahl der Mitarbeiter: 30 000
Interview mit Helge Malchow
Er hat lebenslänglich, Sicherheit. Ist verbeamtet. Gelangweilt. Neugierde treibt ihn: weiter. Mit 31 Jahren tauscht er 1981 seinen Lehrer-Job gegen ein Dreihundert-Mark-Praktikum. Der Beginn einer langen Buch-Bindung: Seither züchtet der „Literatur-Motivator“ vielblättrige KiWis. Von Viola Strüder
„Fever Pitch“ von Nick Hornby, „Crazy“ von Benjamin Lebert, Bret Easton Ellis’ „American Psycho“ und Ethan Hawkes „Hin und Weg“ sind bei ihm erschienen. Er ist Verleger der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez und Heinrich Böll, Lektor von Joschka Fischer und Wolf Biermann, Entdecker von Erzählstimmen, wie die der Schauspieler Mario Adorf und Renan Demirkan. Doch wer ist der Mann, der mit seinem Programm besonders junge Leser fasziniert? Ein Gemäuer aus den frühen 1920er-Jahren, eine literarische Villa – kunterbunt. Es riecht nach altem Holz und neuem Papier. Schwarz-weiß schmücken Autorenköpfe den Treppenaufgang, Schwarz auf Weiß finden sie sich wieder: Gedruckt, gebunden, geschätzt – lebensfarbenprächtig im Regal. Der Verleger: Hoch gewachsen, mit sympathisch offenem Lachen. Eine Mischung aus Literatur-Professor und Jeans-Jacket-Rock’n’Roller, rhetorisch geschliffen in seinem Wort-Reich, begeistert er zwischen den Sätzen. EXPRESSis verbis Zwischen 9 und 10 Uhr kommt Helge Malchow ins Büro. „Dann lese ich zu allererst meine Lieblingszeitung: ‚Express’“ erzählt er, „gefolgt von ‚FAZ’ und ‚Süddeutsche’“. Montags den „Spiegel“, donnerstags „Die Zeit“. „Danach bin ich informiert über die politische und kulturelle Diskussion der Woche.“ Als „Mittelpunkt eines Netzwerkes“ verbringt er den Tag „mit Kommunikation“: Konferenzen mit Mitarbeitern, Telefonate mit Autoren, mit Journalisten, mit, mit, mit. So geht es bis zirka 19 Uhr. An vier von sieben Tagen gehört der Abend Veranstaltungen: Lesungen, Treffen mit Schriftstellern – meist in Köln, Berlin, München, Hamburg, aber auch in New York und London. Textarbeit steht nach Sonnenuntergang an oder am Wochenende, denn eine Reihe von Autoren betreut Helge Malchow nach wie vor selbst. Feder-Führung Der 52-Jährige ist seit zehn Monaten verlegerischer Geschäftsführer von Kiepenheuer & Witsch und somit Nachfolger des Unternehmensgründers Reinhold Neven DuMont. „Er hat mich geprägt“, sagt Helge Malchow über seinen ehemaligen Vorgesetzten, bei dem er zwölf Jahre Cheflektor und zuvor neun Jahre Lektor war. Angebote anderer Verlage habe er abgelehnt, die Identifikation mit diesem Haus ist hoch. Seine Initiative sei stets mit der Möglichkeit zur Umsetzung eines Vorhabens belohnt worden. Dieses sich einbringen können, die Freiheit, Neues anzugehen, zeichnete die Zusammenarbeit aus, die vor über 20 Jahren ungewöhnlich begann. Entflammt 1968. Helge Malchow ist 18 Jahre alt, Abiturient, Erstsemester-Student: Mit Germanistik, Sozialwissenschaften und Philosophie peilt er das Lehramt an – originaler kann ein 68er kaum sein. „Ich kam nach Köln, als die Uni ‚in Flammen stand’.“ Auf Lösch-Papier schreibt er nicht. Im Gegenteil. Die politischen Engagements, das aktive Mitwirken in Gremien spielt eine große Rolle. Es war „mehr Segen als Bremse“ auch im Hinblick auf den Studien- und Lebenslauf. „Wir haben dort gelernt, uns nicht blind auf Autoritäten zu fixieren, haben doppelt so viel für eine Vorlesung getan, um die Auseinandersetzung mit dem Professor führen zu können.“ Inhaltlich sei es nicht so, dass er heute noch alles unterschreiben würde. „Aber diese Mentalität, Dinge zu analysieren, die Diskussion zu suchen und zu führen, Alternativen aufzuzeigen – das ist besser als einfach ein Referat zu schreiben“, drückt er seine Erkenntnis aus. Eine Zeit schließlich, der er heute noch viele spannende Themen verdankt. Bloß nicht jung und DINamisch Was denkt er, wenn er junge Menschen heute beobachtet, hat er eine Botschaft zum Nachdenken für Sie? „Ja“, nickt er energisch und setzt gleich an: „Ich habe den Eindruck, dass viele heute zu sehr ihre Gedanken an Strategie und Taktik verschwenden. Aus der Erfahrung habe ich gelernt, dass das unmittelbare Reagieren, Neugierde mitzuteilen, den eigenen Interessen zu folgen, erfolgreicher ist als jedes Taktieren.“ Helge Malchow ist in seinem Element: „Das Unerwartete brachte mir Erfolg. Was ich aus Leidenschaft tat, was mich persönlich interessierte, wofür ich mich eingesetzt habe, das hat sich positiv ausgewirkt.“ In Fahrt ergänzt er: „Irgendwie trichtert man den 20-, 25-Jährigen ein: Ihr müsst das tun, um eine bestimmte Stufe zu erreichen, und danach jenes für die nächste. Diese Idee, das Leben verlaufe nach dem Funktionalprinzip, das ist es doch genau, was nicht funktioniert.“ – Sätze, denen Mimik und Gestik die Ausrufezeichen hinterherschmettern. Mit Biss – auch mit Hundebiss Sein Studium finanziert Helge Malchow mit BAFöG und diversen Jobs. Post austragen gehört dazu, für eine Woche: „Als Briefträger hat man mich rausgeschmissen. Studenten bekamen immer die schwersten Pakete ab.“ Er zudem einen Hundebiss. So wie er die Geschichte erzählt, klingt sie wie der live erlebte „Mann mit der Ledertasche“ von Charles Bukowski, der sich einst durch Amerikas Straßen schleppte. Leben. Literatur. Literatur-Leben. Helge Malchow stammt aus einer Flüchtlingsfamilie, hat oft zurückgesteckt, Geld fehlte. „Das war gut so“, sagt der in Bad Freienwald an der Oder Geborene „denn ich habe beobachtet, dass die besser Verdienenden Antriebsprobleme hatten.“ Lebensluxus gab es wenig. Ein Auto gar hat er erst seit drei Monaten. Die scherzhafte Begründung: „Das gehört jetzt zum Verleger sein dazu.“ Nach wie vor findet er Taxi- und Bahnfahren „ideal in diesem Beruf“. Stunden.Plan.Mäßig. Nach Abschluss des Studiums verläuft der Weg planmäßig. Helge Malchow wird Deutsch-Lehrer an einem Gymnasium. Literatur lebendig zu vermitteln ist ihm inneres Anliegen. Werke von Heinrich Böll nimmt er in den Lehrplan auf und lädt zur Unterrichtsstunde dessen Verleger Reinhold Neven DuMont als Diskussionspartner ein – nicht ahnend, dass er mit ihm noch häufig diskutieren wird. „Der Lehrerberuf an sich war o.k., die Arbeit mit den Schülern hat Spaß gemacht.“ Nur ist sie nicht, was er aus tiefstem Herzen will. Den Rot-Stift abgesetzt „Irgendwann habe ich gemerkt, dass mich die Inhalte mehr interessieren als Pädagogik. Und inhaltlich kommt man als Lehrer nicht weiter.“ Diese Zeit des Bewusstwerdens beschreibt Helge Malchow als einen „sich lange aufbauenden Prozess“. Da ist der Zustand des Beamtendaseins. Die Langeweile. Der Hunger nach neuen Erfahrungen. Er schmiedet den Plan zu promovieren, kehrt hierfür dem Paukerleben den Rücken, Deutschland obendrein und macht sich auf den eigentlichen Lebensweg. Italien wird erste Wahlstation des Suchenden, ein Stipendium macht sie möglich: Unter der Sonne des Südens wird ihm klar, was er wirklich will: Literatur – aber anders. Chronik eines angekündigten Berufes Rückkehr nach Deutschland. Kurze journalistische Tätigkeit. Dann: Die Bewerbung auf das Verlagspraktikum. 31-jährig fängt Helge Malchow bei Kiepenheuer & Witsch an, jenem Verlag dessen Verleger eben dieser Reinhold Neven DuMont aus der Schulstunde war. Statt seines Lehrer-Gehaltes gibt es ein Salär von 300 Mark. Drei Monate dauert das Praktikum. Über diesen Schritt mit Schnitt in seiner Vita sagt Helge Malchow heute: „Das Leben wird bunter, wenn man wechselt, man tut es ja aus eigener Entscheidung, justiert sich neu, hat Abstand, nicht das Gefühl der Fernsteuerung und auch nicht das, etwas verpasst zu haben.“ So manchen Sprach-Schatz gehoben Kurze Zeit später suchte der Verlag jemanden, der die gerade aufgebaute Paperback-Reihe, KiWi genannt und bis heute so bekannt, als Taschenbuch-Lektor betreute. Und so wurde Helge Malchow Paperback-Leiter. „Ich war damals billig, ließ mir aber, weil ich unbedingt noch mal ins Ausland wollte, als Teil des Vertrages drei Monate New York finanzieren.“ Big Apple, das Zentrum amerikanischer Literatur, wird beruflich zweite Heimat für ihn. Normalerweise bekommen Lektoren feste Bereiche zugewiesen: „Als Taschenbuch-Lektor war ich mit allen Themen betraut und dadurch gut auf meine spätere Tätigkeit als Cheflektor vorbereitet.“ An den Start- und Schreib-Block bringen Anfang der 80er-Jahre erweisen sich die meisten literarischen Autorenverlage als nicht tragfähig. Die einen nehmen Fachverlage hinzu, andere schaffen durch Mäzene Finanzquellen. Helge Malchow geht einen anderen Weg: Er entdeckt Menschen und deren Geschichten oder Erzählkunst – aus Gesellschaft, Politik, Kultur, Sport oder einfach aus dem Leben – und drückt ihnen den Stift in die Hand. „Es gab dieses Interesse an populären Themen, und mit diesen Büchern spiegelte es sich in der Literatur wider.“ Potenzielle Autoren an den Schreib-Block zu bringen, das ist oftmals ein akquisitorischer Job, eine Entwicklungsgeschichte. „Da muss man Briefe schreiben“, lächelt er verschmitzt, „aber das ist ja gerade das, was mir Spaß macht: Zum Schreiben verführen und später zum Lesen.“ Mit Trieb-, aber ohne Schreibfeder Hatte er nie den Wunsch, selbst zu schreiben? „Nein, das hat in dem Beruf seine Tücken. Irgendwann muss man sich entscheiden, Schriftsteller oder Lektor zu sein“. Er verstehe sich eben als „Literatur-Motivator“, der Kritiker und Journalisten mit einem „das müsst ihr lesen, sonst geht euer Leben schief“ überzeugt. Nach eigener Einschätzung ist diese Verführungskunst seine beste Eigenschaft. Die Schlechteste dagegen sei, nicht gut delegieren und loslassen zu können. „Das lerne ich gerade erst.“ Gibt es eine Kernkompetenz? „Das Gute am Beruf des Verlegers ist, dass es die nicht gibt. Das Wissen über Psychologie, Betriebswirtschaftslehre, Medien, gesellschaftliche Prozesse“, ist seiner Meinung nach der Einband des Erfolges. „Dazu Verstärker sein, Dinge rüberbringen können.“ Geht er selbst in Buchläden? „Klar, das ist wichtig für mich und jedes Mal wie eine Tankstelle. Zu sehen, was andere Verlage machen, wie Buchläden Bücher vorstellen.“ Die Rente verlegen „Den Verlag weiter erfolgreich fortführen“, hat sich Helge Malchow als Ziel gesteckt. Starre Altersgrenzen gibt es nicht. Erfahrung habe einen hohen Wert in dem Job: „Erinnerung, nicht nur Kenntnis“, betont er, „das ist Kapital“. „Die besten sind nicht die Jüngsten. Man kann auch oder gerade mit 68 ein hervorragender Verleger sein.“ Und so ist es gut vorstellbar, dass auch er in 15 Jahren nicht nur die Brille verlegen wird. Abgefahren: Ideen chauffieren Das Handy klingelt: Es gibt Staumeldungen Richtung Dortmund, wo er heute Abend auf der Ruhr-Triennale ein Theaterstück von Marthaler sehen will. Unterwegs sein ist für Helge Malchow wichtig: Da kommt er auf die besten Ideen, so sieben bis acht pro Fahrt sind drin. „Der Schreibtisch ist einfach zu dicht dran.“ Stau bringt ihn also nicht auf die Palme, vielmehr bringt er in ihm was auf den Palm. Von diesen kleinen Geräten ist er hellauf begeistert, genauso wie von Mailboxen. „Alles, was sortiert, ist eine gute Erfindung“. Abschalten könne er gut, auch das Handy. Irgendwie hätte es zu ihm gepasst, wenn er auf einer alten, wohl klingenden Triumph Adler rhythmisch-klappernd in die Tasten hauen würde. Stattdessen reicht ein Knopf-Druck – und die Aufzeichnungen werden morgen früh auf die Festplatte und den Flachbildschirm gebeamt. Danach schlägt er wieder die Zeitung um, mitreißende Töne an und ein neues Buch-Kapitel auf.Interview mit Henner Mahlstedt
Baustellen faszinierten ihn schon immer, und auf seinem Weg in die Vorstandsetage des Baukonzerns Hochtief hat er im Laufe der Jahre manche Baustelle besucht, geleitet und koordiniert. Im karriereführer erzählt Henner Mahlstedt, wie sich der Beruf des Bauingenieurs gewandelt hat, wo der Kernbereich der Zukunft liegt und warum bei öffentlichen Bauten so oft die Kosten explodieren. Die Fragen stellte André Boße.
Herr Mahlstedt, wie äußert sich die Freude an Ihrem Beruf an einem ganz normalen Tag wie diesem? Als Bauingenieur schafft man etwas. Etwas zum Sehen und Anfassen, etwas von Bestand. Und ich spüre immer eine große Befriedigung, wenn ich durch die Stadt fahre und ein Gebäude sehe, an dem ich in irgendeiner Form mitgearbeitet habe – ob nun früher als junger Ingenieur, später als Bauleiter oder heute in verantwortlicher Position. Zudem begeistern mich bis heute Baustellen, weil sie täglich anders aussehen und uns vor technische oder planerische Herausforderungen stellen. Finden Sie denn die Zeit, die vielen Baustellen von Hochtief zu besuchen? Das ist zwangsläufig weniger geworden, aber mir gelingt es, regelmäßig die größeren zu besuchen. Um mich dort einzubringen, aber auch zu den schönen Anlässen wie Grundsteinlegung, erster Spatenstich, Richtfest oder Übergabe. Diese alten Traditionen sind auch heute noch unverzichtbar, oder? Ja, weil wir darauf bestehen und sich kein Auftraggeber traut, damit zu brechen. Wobei man sagen muss, dass diese Anlässe vor allem bei gewerblichen Bauten natürlich dazu genutzt werden, ein wenig Werbung für das Projekt zu machen. Mit dem Blick eines Bauingenieurs: Haben Sie derzeit eine Lieblingsstadt? Berlin. Die Stadt hat nach der Maueröffnung eine unglaubliche Entwicklung erfahren. Nehmen Sie den Bereich zwischen Hauptbahnhof und Potsdamer Platz: Anfang der Neunzigerjahre war da noch grüne Wiese, heute ist es ein Gebiet, auf dem sich nahezu alle weltweit bekannten Architekten verewigt haben. Aber es sind nicht nur die sichtbaren Projekte, die mich begeistern. Wenn ich am Eingang des Gotthard-Tunnels mit einer Kleinbahn 25 Kilometer tief in den Berg zur Ortsbrust fahre, dann ist das schon sehr spannend, weil das Bauteam dort nie genau weiß, auf was es stoßen wird, wenn der Bohrer einmal läuft. Wie nehmen Sie die Natur wahr, die sich Ihnen bei solchen Projekten in den Weg stellt? Sie verlangt uns einiges ab. Das gilt auch, wenn wir nahe an der Küste oder, wie es verstärkt kommen wird, offshore arbeiten. Wenn da der Wind bläst und hoher Seegang herrscht, sind Mensch und Gerät gefordert. Wer da keinen Respekt hat und kein Risikobewusstsein entwickelt, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren. Wir sprechen nicht ohne Grund von Naturgewalten. Wenn Sie auf den Beginn Ihrer Laufbahn zurückblicken, welchen grundlegenden Wandel hat die Baubranche in den vergangenen Jahren erlebt? Früher war es üblich, dass man als Bauingenieur für den Rohbau sowie erweiterte Rohbauarbeiten zuständig war. Man hat das mit dem eigenen Personal erledigt – und dann zog man weiter. Heute dagegen erschaffen wir ganzheitlich. Bauingenieure erbringen heute zu einem großen Teil eine Managementleistung. Sie müssen daher fachlich breit aufgestellt sein, und ich empfehle angehenden Bauingenieuren, diese Anforderung schon im Studium im Blick zu haben. Koordinieren statt schaffen – befürchten Sie, dass das eigentliche Bauen in einem Unternehmen wie Hochtief immer weniger Gewicht bekommt? Das Pendel ist tatsächlich etwas zu weit ausgeschlagen. Aber ich erkenne bereits einen Trend zurück zur eigenen Wertschöpfung, damit Bauunternehmen am Bau weiter ihre „Hausmacht“ behalten. Man darf aber nicht verkennen, dass sich die Herausforderungen unwiderruflich geändert haben. Was heute in einem Gebäude an Fassaden-, Regelungs- und Haustechnik verlangt wird, ist schon enorm. Wir haben vor 25 Jahren Häuser gebaut, deren Energiebilanz heute nicht mehr ausreichend ist. Wer schätzen soll, wer das meiste CO2 produziert und die meiste Energie verbraucht, nennt zumeist das Auto. Stimmt aber nicht. Es sind die Gebäude. Da gibt es einen riesigen Bedarf, etwas zu tun. Die Sanierung von Häusern ist einer der großen Kernbereiche von morgen. Man fordert von Ihnen Gebäude, die einerseits nachhaltig sein sollen, andererseits aber wenig kosten dürfen. Wie kommen Sie aus dem Dilemma heraus? Indem wir uns bei einem Bauvorhaben möglichst früh mit unserer Kompetenz einbringen. In einer frühen Planungsphase können wir dem Architekten und dem Bauherrn Vorschläge machen und das Gebäude optimieren. Wenn draußen erst einmal gebaut wird, können Sie nicht mehr viel ändern. Für den Bauingenieur von heute bedeutet das: Er muss planerisch fit sein und ganzheitlich denken. Ein Großteil der Kosten entsteht nicht in der Bauphase, sondern im späteren Betrieb. Beim Bau der Elbphilharmonie in Hamburg kam es zu einem heftigen Streit zwischen Ihnen und der Politik, da trotz intensiver Vorplanung die Baukosten in den Himmel stiegen: 241 Millionen waren es 2006, 378 Millionen werden es nun wohl werden. Das ist fast das Doppelte. Was ist da schiefgelaufen? Was sich die Politik in Hamburg mit der Elbphilharmonie vorgenommen hat, ist der Bau eines Unikats. Es werden auf der Welt nicht viele Philharmonien gebaut, das ist kein Routinevorhaben. Am Opernhaus in Sydney hat man 14 Jahre gebaut, die Kosten waren am Ende fast 15mal so hoch wie geplant. Sie können bei Vorhaben dieser Qualität schlichtweg nicht bis ins letzte Detail planen und Vorhersagen treffen. Dafür ist ein Gebäude dieser Art viel zu komplex und einzigartig – zumal wenn es, wie in Hamburg, an einem so herausfordernden Ort wie der Hafencity gebaut wird. Naiv gefragt: Warum dann nicht die Kosten direkt höher ansetzen? Ich glaube, das liegt nicht so sehr in unserem Portfolio. Wir bewegen uns im Wettbewerb und bewerben uns auf eine Ausschreibung, die vorgibt, was zu bauen ist. Wenn wir gewinnen, setzen wir das um, wobei in diesem Fall keiner die Komplexität des Vorhabens einschätzen konnte. Auch für die Planer ist dieses Projekt Neuland. Wir gehen noch heute mit großen Modellen auf die Baustelle, um den Arbeitern dort überhaupt darlegen zu können, was genau sie da gerade bauen. Es wird in der Elbphilharmonie erstklassige Konzertsäle, Wohnungen, Restaurants, Geschäfte sowie ein Hotel geben – und 100 Meter entfernt legen riesige Schiffe an und tröten. Damit all das zusammenpasst, wird so ein Gebäude zum Haus der 100.000 Abhängigkeiten.Zur Person
Henner Mahlstedt (Jahrgang 1953) studierte Bauingenieurwesen an der Technischen Universität in Braunschweig. Anschließend begann er bei Strabag Bau in Hamburg eine praktisch orientierte Laufbahn. Er war zunächst Statiker und Projektkoordinator, später dann Projekt-, Bau- und Bauoberleiter. Seine erste Führungsposition war die des Leiters der Strabag-Niederlassung Hamburg/Schleswig-Holstein. Nach weiteren Führungsstationen bei Unternehmen aus der Bauindustrie in Berlin, Köln und München kam Henner Mahlstedt schließlich 2003 zu Hochtief Construction nach Essen, wo er die Leitung des Bereichs Ost übernahm. Im Jahr 2005 rückte er in den Vorstand auf, seit April 2007 ist er Vorstandsvorsitzender.
Zum Unternehmen
Die Hochtief Construction AG ist der praktische Arm des 1875 gegründeten Essener Baukonzerns Hochtief. Hochtief Construction baut weltweit Wohnungen und Industriebauten, Straßen und Flughäfen. Durch prestigeträchtige Bauvorhaben hat sie sich international einen Namen gemacht. Derzeit arbeitet das Unternehmen am St.-Gotthart-Tunnel in der Schweiz, an Wasserkraftwerken in Schottland und Chile sowie an einer achteinhalb Kilometer langen Luxus-Shopping-Meile in Katar.
Interview mit Dr. Manfred Lütz
(Aus BerufSZiel 1.2008) „Gott“ heisst eines seiner Bücher. Und genau darüber wollen wir mit Dr. Manfred Lütz reden: über die Perspektive von „ganz oben“. Treffpunkt: das Alexianer-Krankenhaus in Köln, wo Lütz Chefarzt ist. Das Krankenhaus ist ein altes Kloster mit malerischen Kreuzgängen – wie geschaffen für ein Gespräch über Glaube, Kirche und was Manager von der Theologie lernen können. Manfred Lütz verspätet sich zum Interview, weil er gerade noch einen psychiatrischen Notfall behandeln musste. Doch dann steht er Interviewer Peter Neumann wortgewandt Rede und Antwort.
Hilft der Glaube an Gott, einen Job im Top-Management auszufüllen? Man glaubt nicht zu einem Zweck. Der Vorstand eines Dax-Unternehmens, der es nützlich finden würde, an Gott zu glauben, um dadurch vielleicht einen besseren Aktienkurs zu erzielen, wäre wahrscheinlich so schlichten Geistes, dass er eine Gefahr für das Unternehmen wäre. Andererseits mag es aber schon sein, dass jemand, der an Gott und einen Sinn im Leben glaubt, auf einem belastbareren Fundament steht. Er muss sich nicht mit der täglichen Neukonstruktion seines eigenen Lebenssinns befassen und kann sich so vielleicht mit mehr Kraft seinem Unternehmen widmen. In Ihrem Buch „GOTT“ schildern Sie eine Managerin, die unter Depressionen litt, ihren Beruf aufgab und ins Kloster ging. Beschreiben Sie hier einen extremen Einzelfall, oder ist das Abtauchen aus dem Stress-Job in Gottes Hand stärker verbreitet, als man es sich vorstellt? Kloster auf Zeit kann gerade für Manager eine gute Idee sein. Da kann man einmal sein Hirn durchlüften und auf neue Ideen kommen. Aber ganz ins Kloster, das ist sicher ein Ausnahmefall. Wenn wir allen depressiven Managern den Eintritt in einen Orden nahelegen würden, wäre zwar das Problem mit dem Ordensnachwuchs bald gelöst. Aber die Stimmung in den Klöstern würde deutlich sinken – dazu würde ich nicht raten (lacht). Wenn nicht ins Kloster – sollten Manager dann regelmäßig in die Kirche gehen? Klar! Denn der Glaube braucht wie die Liebe auch mal die körperliche Anwesenheit. Außerdem tun regelmäßige Unterbrechungen dem Menschen gut. Schon die antike Philosophie wusste, dass der Kult den Menschen herausreißen kann aus dem Alltagstrott. Denn der Gottesdienstbesuch ist mitunter die einzige Zeit in der Woche, in der wir keine Rolle spielen – als Vorgesetzter oder Untergebener, als Sohn oder Vater, als Ehemann oder Nachbar. Im Gottesdienst können wir wenigstens diese eine von 168 Wochenstunden wir selbst sein – wir selbst vor Gott. Und was nimmt der Manager von seinem Kirchgang mit, das ihm in seinem Beruf weiterhilft? Nichts. Und das ist das Tolle. Der Gottesdienst ist völlig zwecklos, aber höchst sinnvoll. Im Berufsalltag muss sich ein Manager stets überlegen: Wozu mache ich das eigentlich, was bringt das? Wenn man sein ganzes Leben lang immer nur Zweckmäßiges tut, wird man von seinen Zwecken gelebt und versäumt das eigentliche Leben. Wir arbeiten, um Muße zu haben, hat Aristoteles gesagt. Muße aber ist die zweckfreie Zeit, in der man geistig anregenden Gesprächen nachgeht, Musik genießt, die Natur erlebt oder einem geliebten Menschen nahe ist. Wer sich nur unterhält, um nützliche Informationen oder Kontakte zu bekommen, Musik und Natur um der Erholung willen einsetzt, merkt gar nicht, dass er auf dem besten Weg ist, das Leben zu verpassen. Gehen gläubige Christen anders mit Problemen um als Atheisten? Konkret: Entscheidet ein christlicher Manager bei Personalentlassungen anders? Eine gefährliche Frage. Man ist versucht, pharisäisch zu antworten: Freut Euch, wenn Ihr christliche Chefs habt, dann herrscht ein besserer Umgangston. Ich hoffe das natürlich, aber selbstverständlich gibt es da den unmenschlichen Chef, dem das Taufwasser nur die Frisur angefeuchtet hat, und den mitmenschlichen Atheisten. Wie steht die Bibel zum Thema Geldverdienen? Erlaubt sie Managergehälter jenseits der Eine-Million-Euro-Marke? Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich – sagt die Bibel. Aber was ist ein Reicher? Im Grunde genommen zählen wir hier in Deutschland alle zu den Spitzenverdienern – verglichen mit Menschen in Bangladesch. Und wenn Reichtum aus biblischer Sicht eine Versuchung zur Sünde ist, haben wir alle ein Problem. Viel Geld zu besitzen ist dann unmoralisch, wenn man damit nicht sozial umgeht. Die soziale Marktwirtschaft ist bekanntlich aus christlichem Geist entstanden. Es geht nicht um die Höhe des Einkommens, sondern darum, wie man damit umgeht. Wer sein Geld sozial einsetzt und nur so viel wie nötig für sich beansprucht, geht verantwortlich damit um. Demonstratives Vorführen von Klunkern ist gewiss nicht im Sinne der Bibel. Darf ein Christ seinen Konkurrenten bekämpfen oder ihn gar in den Ruin treiben? Der Bettelmönch Thomas von Aquin hat stets das Recht auf Eigentum verteidigt als Ausdruck der Freiheit des Menschen. Daher ist bei der sozialen Marktwirtschaft nicht nur das „sozial“ christlich motiviert, sondern auch die „Marktwirtschaft“. Zur Marktwirtschaft gehört aber untrennbar die Konkurrenz, die ja zur Verbesserung der Qualität und des Preises beiträgt. Die Grenze liegt da, wo ein Konkurrent mit illegalen oder unmoralischen Mitteln absichtlich ruiniert wird. Aber es kann natürlich in einem Verdrängungswettbewerb passieren, dass ein nicht qualifiziertes Angebot vom Markt verschwinden muss. Christentum ist kein naives Gutmenschentum. Sind die Kirchenoberen – Bischöfe, Kardinäle und auch der Papst – gute Manager? Ich glaube nicht. Was könnten denn Kirchenführer von Wirtschaftsführern lernen? In der Verwaltung lernen sie ja schon wacker. Auch der Dienstleistungsgedanke wird inzwischen in erfreulichem Maße umgesetzt. Was könnten umgekehrt Manager von Kirchenmännern lernen? Die katholische Kirche hat 2000 Jahre überlebt – eine tolle Leistung. Weltlich gesprochen lautet das Erfolgsgeheimnis: Einheit in Vielfalt. Unterschiedliche Orden, Temperamente, Nationen in der gleichen Kirche, diese Unterschiedlichkeit immer wieder fruchtbar zu machen, das ist wohl das Geheimnis der immer wiederkehrenden Aufbrüche in dieser ältesten und größten Institution der Welt. Manager, die Vielfalt als Bereicherung schätzen, die nicht nur Kommandos von oben geben, sondern genau hinsehen, wo in einem Unternehmen neue Ideen wachsen, können ein Unternehmen weiterbringen. Der Chef der katholischen Kirche wird von den leitenden Mitarbeitern gewählt. Wäre das auch ein Modell für die Wirtschaft? (lacht) Das glaube ich nicht. Wenn man seinen eigenen Chef wählt, fällt die Wahl nicht immer auf starke Gestalten. So muss bei der Papstwahl der Heilige Geist immer etwas gegensteuern. Papst Johannes XXIII. wurde als alter Übergangspapst gewählt – und entpuppte sich als eine innovative Ausnahmegestalt. Ich würde nicht darauf vertrauen, dass der Heilige Geist auf ähnlich humorvolle Weise auch bei General Motors in die Unternehmenspolitik eingreift. Mit welchem Top-Manager würden Sie gern einmal zu Mittag essen? Vielleicht mit dem neuen Siemens-Chef Löscher. Es würde mich interessieren, wie er als jemand, der nicht in die bekannten Affären involviert war, nach seinen Erfahrungen das Thema Moral und Wirtschaft sieht. Welches Kapitel der Bibel sollten Manager lesen und beherzigen? Den ersten Johannesbrief. Manager haben ja immer wenig Zeit. Der erste Johannesbrief hat nur etwa vier Seiten, und er fasst das Wesen des Christentums gültig zusammen. Dort heißt es: Jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und kennt Gott. Mutter Teresa hat einmal gesagt: Wenn wir eines Tages zu Gott gerufen werden, wird er nicht fragen: Wie viel Gutes hast du in deinem Leben getan? Sondern: Mit wie viel Liebe hast du das getan, was du getan hast? Das gilt auch für den Müllmann. Wenn man liebevoll Mülltonnen ausleert, kann man in den Himmel kommen. Wie muss ein Manager sich ein Leben lang verhalten, damit er beim Jüngsten Gericht gute Chancen hat? Er sollte den ersten Johannesbrief lesen und sich daran halten.Zur Person
Dr. Manfred Lütz studierte Medizin, Philosophie und katholische Theologie in Bonn und Rom. Als Facharzt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und Psychotherapie ist er seit 1997 Chefarzt des Alexianer-Krankenhauses in Köln-Porz. Lütz ist Mitglied des Päpstlichen Rates für die Laien, Mitglied der Päpstlichen Akademie für das Leben und Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Bekannt wurde Lütz als Autor diverser Bücher, darunter „Lebenslust“, in dem er sich satirisch zu Diäten, dem Gesundheits- und Fitness-Wahn äußert, oder „Der blockierte Riese. Psycho-Analyse der katholischen Kirche“. Sein Werk „GOTT“ stand monatelang auf den Bestseller-Listen.
Interview mit Frieder C. Löhrer
Seit Juni 2008 tritt er in die Fußstapfen von „Mr. Loewe“ Rainer Hecker: Frieder C. Löhrer übernimmt nach 18 Jahren den Vorstandvorsitz beim bayerischen Fernsehgeräte-Hersteller Loewe. Im karriereführer spricht er über Internationalität, die Zukunft der Unterhaltungselektronik-Branche und darüber, wie wichtig Design sein kann. Die Fragen stellte Meike Nachtwey.
Sie haben bereits eine beachtliche Karriere auch in einem anderen Bereich hinter sich: der Musik. Warum haben Sie sich dennoch für ein Ingenieurstudium entschieden? Der Hauptgrund war die Erkrankung meines Vaters. Er überlebte mit einer Herz-/Lungen-Maschine. Die Technik hat mich fasziniert und gefangen genommen. Da habe ich entschieden, dass ich etwas Sinnvolles und Wertvolles für Menschen tun kann. Ich wollte künstliche Herzen entwickeln, etwas, das dem Menschen hilft. Darüber bin ich zum Ingenieurstudium gekommen. Was haben Musik und Technik gemeinsam? Es geht bei der Musik und der Technik um Struktur und Sinn. Eine Symphonie hat einen Aufbau, im Großen wie im Kleinen. Wer Analogien gebraucht, sieht Atome, Moleküle bis hin zu Armen und Beinen und zum Schluss den Körper. Oder einzelne Noten, Melodien, Sätze, Symphonien. Das große wird durch „smart simplicity“ erst großartig, nicht durch Kompliziertes. Technik und Musik sind schon aus der Zeit der Antike verwandte Musen und Künste. Welche Rolle spielt Ihre technische Ausbildung für Ihre heutige Tätigkeit noch? Loewe ist zu einem hohen Anteil ein technikgeprägtes Unternehmen. Zu unseren zentralen Markenwerten gehört „sinnvolle Innovation“. Die Begeisterung für technische Zusammenhänge hat mich zum Technikstudium gebracht. Diese Faszination habe ich mir erhalten. Heute erleichtert mir mein Studium auch die Beurteilung technologischer Zusammenhänge. Genauso spannend finde ich aber die Verbindung der Technik zur zeitgemäßen Form, zum Design. Themen also, die Loewe wesentlich prägen. Warum haben Sie sich für eine Managerlaufbahn entschieden? Manager können gestalten, können neue Wege gehen und die Zukunft prägen. Das hat mich immer herausgefordert. Ich brauche den Umgang mit Menschen. Die Stärken eines Unternehmens weiter auszubauen, ganz neue Chancen zu entdecken und sich darauf mit ganzer Kraft zu konzentrieren, das fordert mich heraus. Würden Sie manchmal gerne noch technisch arbeiten? Aus meiner Perspektive arbeite ich heute immer noch technisch. Durch das Studium habe ich nicht nur Technik gelernt, sondern auch Denk-Techniken. Methoden, um Aufgabenstellungen zu lösen. So gesehen arbeite ich immer noch technisch. Was ist das für ein Gefühl, in die Fußstapfen von „Mr. Loewe“ zu treten? Die Fußstapfen von Dr. Hecker sind zweifellos groß. Er hat über Jahrzehnte das Unternehmen wesentlich geprägt und konsequent ausgerichtet. Ich bin aber sehr zuversichtlich, diesen Weg aufgrund meiner Erfahrung gut fortsetzen und eigene Akzente einbringen zu können. Mussten Sie auch schon mal Krisen durchstehen? Jeder muss Krisen bewältigen. Daran wird man geformt. Hier hilft das Wissen um das Wort Krise. Im altgriechischen kommt Krise von krinein und das bedeutet urteilen/beurteilen, also nicht schon negativ vorbesetzt, sondern zur Tat, zur Aktion auffordernd. Im Chinesischen steht das Schriftzeichen Krise für Chance und Risiko. Gerade Krisen fordern den Manager. Ohne Krisen wird man keiner. Sie möchten mit Loewe die Internationalität der Marke stärken und erweitern. Ist Internationalität heute eine Karriere-Voraussetzung? Die großen Chancen für Loewe liegen im internationalen Bereich. In Deutschland hat die faszinierende Premiummarke eine ausgezeichnete Marktposition. Wenn es uns gelingt, im ersten Schritt in den europäischen Kernmärkten eine vergleichbare Stellung zu erreichen, dann hat das Unternehmen großes Wachstumspotenzial. Das stellt auch an jeden persönlich große Anforderungen. Sich einlassen auf andere Länder und Kulturen, Sprachkompetenz, Führen im internationalen Netzwerk – diese Themen und Qualifikationen werden tatsächlich für Führungskräfte zu einer zentralen Karriere-Voraussetzung; auch in Unternehmen mittlerer Größe wie Loewe. Was müssen Hochschulabsolventen der Ingenieurswissenschaften beachten, wenn Sie eine Karriere wie die Ihre machen möchten? Studenten sollten möglichst frühzeitig wissen, was sie später beruflich machen wollen. Schon die Ausrichtung des Studiengangs und der Studienschwerpunkte kann Karriere fördern. Sie sollten während des Studiums auch schon praktische Erfahrungen sammeln. Während und nach dem Studium international tätig zu sein, öffnet den Blick und erweitert den Horizont. Und dann gilt: sich das berufliche Umfeld suchen, für das man sich mit Leib und Seele einsetzen will, wofür es sich aus der jeweils individuellen Sicht wirklich zu kämpfen lohnt. Denn was Spaß macht, macht man gut. Was man gut macht, fällt auf. Wer auffällt, kommt weiter. Was sollte ein Hochschulabsolvent sonst noch mitbringen, damit Sie ihn einstellen? Er sollte kein Fachidiot sein. Gesellschaftliches oder fachliches Engagement über den fachlich-beruflichen Tellerrand hinaus ist immer mehr ein ganz wesentliches Persönlichkeitsmerkmal. Es wird zudem in unserer Gesellschaft dringend gebraucht. Unternehmen wie Loewe unterstützen dieses Engagement der Mitarbeiter aktiv. So ist eine Entwicklungsingenieurin von uns seit kurzem Stellvertreterin des Bürgermeisters von Kronach, der Stadt unseres Firmensitzes. Wie sehen Sie die Zukunft der Unterhaltungselektronik- Branche? Unsere Branche ist hoch innovativ. Fast drei Viertel der Produkte unseres Sortiments sind erst seit weniger als einem Jahr am Markt. Neue, wesentlich bessere Fernsehgeräte und Audio-Anlagen mit intelligenten neuen Anwendungen wie dem Festplattenrecorder schaffen neue Nachfrage. Erst gut 25 Prozent der Haushalte haben ein modernes, flaches Fernsehgerät. Auch diese Ersatzbeschaffung bringt Umsatz für die nächsten Jahre. Deshalb hat unsere Branche hervorragende Zukunftsaussichten. Und Loewe – als deutsches Unternehmen – hat im Premiummarkt auch im Wettbewerb mit den internationalen Global Players ausgezeichnete Perspektiven. Loewe hat gerade eine Auszeichnung vom red dot award für den Loewe Connect Fernseher bekommen. Welche Rolle spielt Design und Innovationsforschung heute für ein erfolgreiches Unternehmen? Neben der innovativen Technik ist ausgezeichnetes Design die wesentliche Erfolgsvoraussetzung für Loewe. Design macht nach außen hin sichtbar, was im Gerät steckt. Und es differenziert unser Angebot im Fachgeschäft eindeutig vom Wettbewerb. Konsequent weitergedacht heißt Designorientierung aber auch On-Screen-Design, Kommunikationsdesign, Laden-Architektur, Messestandsgestaltung und, und, und. Design ist für Loewe neben sinnvoller Technik und exklusiver Individualität zu einem von drei zentralen Markenwerten geworden, die wir konsequent in allen Bereichen unserer Arbeit umsetzen. Welche Rolle spielt Kreativität generell im Berufsleben eines erfolgreichen Ingenieurs? Solides Fachwissen, gewissenhafte und ausdauernde Konzentration auf eine Aufgabe sind unerlässlich für den Erfolg. Die Königsdisziplin allerdings ist die Kreativität: bereit zu sein, neue Wege zu entdecken und zu entwickeln. Kreativität darf aber nie zum Selbstzweck werden, sonst wird sie schnell zu Aktionismus. Ihre Partner müssen Beharrlichkeit und Vertiefung auf die wesentlichen Projekte sein. Thomas Alva Edison hat es wunderbar zusammengefasst: „Erfolg ist ein Prozent Inspiration und 99 Prozent Transpiration.“ Und das schöne an diesem Wortspiel: Es geht um „Spirit“, um Geist und Hauch. Wie bekommen Sie Beruf, Familie und Musik unter einen Hut? Das geht nur mit Disziplin bei sich selber und Liebe, Verständnis sowie Hilfe durch die Familie. Ich arbeite viel und gerne. Doch wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringe, dann intensiv. Viel Essen und Trinken mit viel Gespräch, Bergwandern, Skifahren oder Segeln, Tanz oder Konzerterlebnis. Musik ist dann wie ein gemeinsamer Nenner ein unglaublicher Klebstoff.Zur Person
Frieder C. Löhrer wurde 1956 in Aachen geboren. Bereits in jungen Jahren beherrschte er diverse Musikinstrumente. Als Jugendlicher studierte er Komposition an der Musikhochschule Köln. Mit 18 Jahren wurden seine Werke bereits international aufgeführt. Mit Karlheinz Stockhausen verband ihn zu dessen Lebzeiten eine enge Freundschaft. Nach seinem Schulabschluss ging Löhrer aber in eine andere Richtung und studierte Maschinenbau an der RWTH Aachen und Business Administration (MBA) am Henley-College in Großbritannien. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch verschiedene Branchen: von Thyssen Krupp über die Wacker Chemie zur österreichischen Zumtobel AG und zurück nach Deutschland zum Brillenhersteller Rodenstock. Von 2004 bis 2008 war er Vorstandschef des Möbelherstellers Rolf Benz. Im Juni 2008 hat er den Vorstandsvorsitz der Loewe AG übernommen. Frieder Löhrer ist verheiratet und Vater von vier Kindern.
Zum Unternehmen
Im Oktober 1923 gründete Dr. Sigmund Loewe zusammen mit seinem Bruder David die Loewe-Audion GmbH zu Herstellung von Elektronenröhren. 1938 muss Loewe aufgrund seiner jüdischen Herkunft in die USA fliehen, 1942 wird das Unternehmen umbenannt in Opta-Radio AG. 1949 wird es aber wieder im vollen Umfang an die Familie Loewe rückübertragen. Das Unternehmen produziert hauptsächlich Fernseher, aber auch DVD-Rekorder, Blu-Ray Player, Lautsprecher und HiFi-Anlagen. Der Umsatz des börsennotierten Unternehmens lag 2007 bei 372,5 Millionen Euro. Über die Hälfte davon erzielt Loewe auf internationalen Märkten. Das Unternehmen wurde von 1990 bis Juni 2008 von Rainer Hecker geführt. Er rettete es 2004 durch eine schwere Krise, indem er die rund 1000 Mitarbeiter davon überzeugen konnte, auf ein halbes bis ein ganzes Monatsgehalt zu verzichten. 2007 zahlte das Unternehmen dies dann mit einer Prämie zurück. 2008 brachte Loewe den ersten Multimedia-Fernseher der Welt auf den Markt. Der Loewe Connect kann mit seiner voll integrierten Vernetzung kabellos auf Bild-, Musik- und Videodateien eines Computers oder einer externen Festplatte zugreifen. Dafür erhielt die Loewe AG den renommierten Design-Preis „Best of the best“ des red dot awards.
Frank Lehmann
Im „ARD-Mittagsmagazin“ und in der „Börse im Ersten“ präsentiert Frank Lehmann Neues vom Aktienmarkt. Der Wahlschwabe hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen und weiß, wie trockene Themen auch spannend vermittelt werden können. Er lud den karriereführer ein, das Fernsehgeschäft mal aus der Nähe zu betrachten. Von Heike Jüds
Händler, die sich über Zeichensprache aus der dritten Reihe bemerkbar machen müssen, drängen sich heute nicht mehr um die schulterhohen Pulte. Auch flitzt niemand mehr zwischen Fernschreibern, die in kleinen Kabuffen stehen und den Pulten hin und her. Heutzutage herrscht auf dem Parkett eine ruhige Arbeitsatmosphäre. Die Betriebsamkeit an der Frankfurter Börse hat sich eine Etage nach oben verlagert. Auf dem Balkon ringsum drängen sich Sender und Rundfunkanstalten. Dicht an dicht, immer mit Blick auf die Börsenkurse, sind Kameras, Computer und Beleuchtung aufgebaut. Vormittagsansichten Frank Lehmann ist der Börsenexperte der ARD. Mit seiner sonoren Bassstimme erklärt Frank Lehmann den Wandel, der sich im Laufe der letzten Jahre hier an der alten Börse in Frankfurt vollzogen hat. Das denkmalgeschützte Gebäude hat trotz aller Veränderungen seinen Reiz nicht verloren. Im Jahre 1989 reagierte die Rundfunkanstalt ARD auf das Interesse der breiten Bevölkerung am Aktiengeschäft. Börsensendungen wurden in das Programmfenster aufgenommen. Frank Lehmann war zu dieser Zeit Leiter der Wirtschaftsredaktion beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main. Im „Mittagsmagazin“ wurden für das ARD fünf bis sechs Minuten aus der Börse gesendet und bis heute wechseln sich ARD und ZDF wöchentlich damit ab. Im Juli 2000 wurde dieser Service auch in die „Tagesthemen“ aufgenommen. Das Interesse, das sich über die Einschaltquoten zeigte, wuchs, und so „haben wir im November 2000 das neue Stück ‚Börse im Ersten‘ erfunden.“ Frank Lehmann lehnt sich ein wenig stolz auf seinem Stuhl in der Cafeteria zurück. „Wichtig ist immer, dass man erklärt warum heute was an der Börse passiert. Die Fakten bringen und gleich sagen warum.“ Lehmann, der bekannt dafür ist, dass er die eher trockenen Themen mit viel Schmackes rüberbringt, wird scherzhaft auch der „Börsenbabbeler“ genannt. „Ist doch egal, Hauptsache, Ihr guckt“, entfährt es ihm begleitet von einem leichten Schulterzucken. „Wichtig ist, verstanden zu werden, den roten Faden zu finden. Nicht nur Vorstände sehen diese Sendung gerne, auch deren Frauen, wie mir schon erzählt wurde.“ Er lacht kurz und beugt sich nach vorne. Die historischen Parallelen zu den heutigen Ereignissen zu finden, hat er sich zum Ziel gesetzt. Bei seiner Tochter hat er festgestellt, dass so etwas gar nicht an den Schulen unterrichtet wird. Natürlich lässt sich nicht alles auf die heutige Zeit übertragen, aber gewisse Gesetzmäßigkeiten findet er heute wie damals, zum Beispiel im Anlegerverhalten. Diese Zusammenhänge erläutert er nicht nur in der „Zwei-Minuten-Terrine“, wie er die Sendung vor der „Tagesschau“ liebevoll nennt. Manchmal wird er zu einer Sparkasseneinweihung eingeladen. Dann hält er zu diesem Thema auch mal einen Vortrag. In André Kostolany hat er einen Mentor gefunden. Dessen „budapeschter ost-westliche Weisheiten“ hat Lehmann zum Teil verinnerlicht. „Zum Beispiel: ‚Gier ist die Wurzel allen Übels.‘ Das haben wir alles in den Zeiten des Booms erlebt“, zitiert er ihn direkt. Kostolany gilt heute als Meister der Börsenspekulation. Er hat mehr als 70 Jahre an allen Börsen der Welt spekuliert, bevor er im Herbst 1999 im Alter von 93 Jahren verstarb. Lehmann übernimmt aber ebenso gerne berühmte chinesische Weisheiten, die vor 1000 Jahren ihre Gültigkeit hatten wie heute. Auf die Zutaten kommt es an Bei der „Frankfurter Rundschau“ absolvierte Lehmann eine kaufmännische Lehre. Nach seinem anschließenden betriebswirtschaftlichem Studium wollte er ins so genannte Management einsteigen. Das Angebot für ein internationales Trainee bei einem Nahrungsmittelkonzern hatte er schon in der Tasche, als ein Anruf aus der Redaktion der Rundschau kam. Dort war bekannt, dass Lehmann in seiner Freizeit ruderte. Der „Papst der Ruderei“, der immer für die Zeitung geschrieben hatte, war über 80-jährig gestorben und nun suchten sie händeringend jemanden, der schnell einspringen konnte. „So bin ich zum Journalismus gekommen, zufällig und quasi hintenrum“, und als würde es ihn heute noch wundern, „der Anruf kam frei nach dem Motto: Du hast Rudern gelernt, hast bei uns eine Lehre gemacht, ein bisschen schreiben kannst du doch auch. Also jetzt komm, probier das mal.“ Er ließ das Management sausen und probierte dort auch noch andere Bereiche des Sports aus, verfolgte aber den Weg des Journalismus weiter. Lehmann vertiefte sein Wissen durch ein Volontariat in der Nachrichtenagentur vwd. Der Anbieter von Finanzinformationen im deutschen Sprachraum versorgt täglich Finanzdienstleister und -institute, Unternehmen sowie Medien mit Nachrichten. In den Abendstunden nahm Lehmann beim Hessischen Rundfunk bei einem Regisseur Sprechunterricht. Der hat ihm dann auch zu einem Praktikum beim Sender geraten. Die waren direkt begeistert, weil der neue Praktikant Ahnung von dem hatte, was er sagte. Später betreute er die Sendung: „Marktwirtschaft für jedermann“. Und wieder half ihm der Zufall. „Es wurde immer ein ganz wichtiger Hörfunkmann aus Bonn für die Sendung bestellt. Eines Tages passierte ihm ein Unglück. Er musste in der Kantine die Zeit bis zur Sendung überbrücken und zog sich einen Cognac nach dem anderen rein – bis er förmlich abstürzte. Der Chefredakteur brauchte schnell einen Ersatz. Innerhalb von einer Stunde bin ich da eingesprungen“, lacht Lehmann. Heute gibt es diesen Weg der Zufälle kaum noch. Es wird auf ein abgeschlossenes Studium und Volontariat großen Wert gelegt. Die Bewerber müssen zeigen, dass sie genügend Praxiserfahrung haben. „Vor allem neugierig muss man in diesem Beruf sein und bleiben“, betont er. „Raum, um sich groß auszuprobieren, den gibt es beim Fernsehen nicht.“ Mahlzeit Ein geregelter Alltag existiert an der Börse nicht. Ständig ändern sich die Kurse, neue Meldungen müssen berücksichtigt werden. Die Texte für seine Berichte schreibt Lehmann selbst. Während er das beschreibt, schaut er zu, wie sich sein Kollege Klaus-Rainer Jakisch auf den Live-Schnitt für das „Mittagsmagazin“ vorbereitet. Der Moderator hat sich ein paar Stichworte notiert und geht mit der Regisseurin den Ablauf durch. Nur das Zeitfenster ist festgelegt. Es geht um einen Bericht über die Heidelberger Druckmaschinen. Die Reihenfolge der Bilder muss auf den Text abgestimmt werden. Die entsprechenden Grafiken werden ebenfalls im Schneideraum eingepasst. Jakisch geht noch schnell in die „Maske“. Es ist 14:00 Uhr, das „Mittagsmagazin“ hat begonnen. Alle Bänder liegen bereit, die Kamera wird ausgerichtet, das Licht abgestimmt – Kamera ab! Das Alltagsgeschäft Lehmann in AktionZwischen zwei Sätzen spricht Lehmann eine Kollegin auf den grauen Markt an – ein gefährliches Unterfangen wie er findet. Er möchte wohl am Abend darüber berichten. „Unsere Zielgruppe sind die drei- bis 103-Jährigen. Die „Tagesschau“ hat sechs bis sieben Millionen Zuschauer und wir haben davon die Hälfte. Von diesen drei Millionen sind etwa ein Drittel absolute Freaks, die sich im Aktiengeschäft auskennen“, so Lehmann. Das Reizvolle an seiner Arbeit ist, dass er vorher nie weiß, wie der Aktienmarkt an dem Tag reagieren wird. „Börse ist jeden Tag spannend. Selbst das Wetter kann man besser vorhersagen. Der Punkt ist, dass der Mensch und sein irrationales Verhalten das Geschehen steuert.“ Sein Arbeitstag beginnt morgens im Mutterhaus des Hessischen Rundfunks mit organisatorischen Dingen, die seine Aufgabe als Abteilungsleiter mit sich bringen. Mittags geht Lehmann an die Börse und guckt, was los ist. Was er den Zuschauern abends anbieten kann. Sein Arbeitstag endet meistens gegen 20:00 Uhr, mit dem Beginn der „Tagesschau“. Die Sendezeit für „Börse im Ersten“ wird durch die Anzahl der Werbeblöcke bestimmt. Die genaue Zeit erfährt er am Nachmittag des Vortags. „Dadurch sind wir auch ein Spiegelbild der Wirtschaft. Wenn wir viel Sendezeit haben, heißt das, es wird wenig geworben. Das ist dann schlecht für die Konjunktur.“ Ein Computer stoppt die Zeit sekundengenau. So muss der Börsenexperte genau darauf achten, dass er nicht mitten im Satz abgeschnitten wird. Auch eine Kunst. Nachtisch Die Kunst hat ihm in vielen Dingen weiter geholfen. Er ist sich sicher, dass sein Hobby der Schauspielerei, das Stehen vor der Kamera erleichtert hat. Das Stehen auf der Bühne war wohl auch der Grund für sein damaliges Sprechtraining. Zuletzt stand Lehmann in einem ganz anderen Kontext vor der Kamera. Christine Westermann und Götz Alzmann hatten ihn nach Köln zu der Sendung „Zimmer frei“ eingeladen. „Das hat richtig Spaß gemacht. Singen musste ich da auch.“ Er lacht. „Ich bin ein Anhänger deutschen Liedguts und habe ‚Am Brunnen vor dem Tore‘ gesungen.“ In seinem Heimat- und Geschichtsverein hat er erfahren, dass das Libretto in seiner Heimatgemeinde entstanden ist. „Die Linde steht noch da, nur der Brunnen ist weg.“