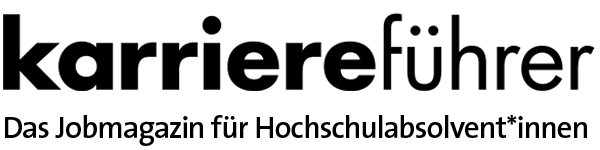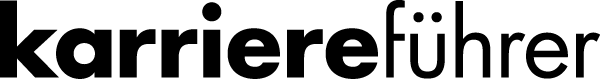Als Geisteswissenschaftlerin gehört Kirsten Lange auch heute noch zu den Exoten der Consultingbranche. Bei BCG ist sie jedoch seit 18 Jahren erfolgreich. Zunächst als Consultant, seit 2000 als Partner und Managing Director. Im karriereführer consulting sprach sie über Erfolg, Ziele und den Unterschied zwischen weiblichen und männlichen Consultants. Das Interview führte Meike Nachtwey.
Frau Lange, Sie haben Journalismus, Philosophie und Soziologie studiert, sind Mutter zweier Söhne, arbeiten als Geschäftsführerin einer großen Unternehmensberatung Teilzeit und sind dort weltweit für die Papierbranche zuständig. Treffen Sie bei Ihrer Arbeit auf viele Menschen mit einer ähnlichen Vita? Viele Consultants haben einen bunten Lebenslauf und sammeln meist in den ersten Jahren ihrer Karriere sehr unterschiedliche Erfahrungen. Nur Frauen treffe ich leider nicht so häufig, wie ich es mir wünsche. Sie sind seit 18 Jahren bei BCG – was fasziniert Sie an Ihrem Job? Am meisten fasziniert mich die Abwechslung: Immer neue Kunden, immer neue Aufgaben. In den vergangenen Monaten habe ich beispielsweise mit meinem Team eine Wachstumsstrategie für einen Verpackungspapierhersteller entwickelt. Anschließend haben wir geprüft, welche Auswirkungen die Krise auf die Wettbewerbsfähigkeit der südamerikanischen Zellstoffproduzenten haben wird und wie sie darauf reagieren sollten. Die Herausforderungen wechseln ständig, so dass mir in meinem Job nie langweilig wird. Wie kam es dazu, dass Sie sich für die Beratungsbranche interessiert haben und dann auch tatsächlich Consultant wurden? Ich wollte eigentlich Journalistin werden, bekam aber bei einem Ferienjob die Möglichkeit, ein Praktikum in einer Unternehmensberatung zu absolvieren. Dabei habe ich festgestellt, dass es einige Parallelen zwischen Journalismus und Beratung gibt: Man beschäftigt sich mit sehr unterschiedlichen Themen und muss sich immer wieder neu einarbeiten. Die Beratung geht aber noch einen Schritt weiter: Man berichtet nicht nur über viele Themen, sondern kann sie selbst mitgestalten. Das fand ich faszinierend – und beschloss daher, bei BCG als Beraterin einzusteigen. In Ihrem Job müssen Sie viel arbeiten – wie bekommen Sie Familie und Job unter einen Hut? Indem ich priorisiere, meine Tage gut durchorganisiere und viele Aufgaben auch einfach an andere abgebe. Gerade mit Blick auf die Priorisierung bin ich sehr konsequent: Ich prüfe, was ich unbedingt selbst machen muss, und delegiere alle übrigen Arbeiten. Und natürlich habe ich Menschen, die mich unterstützen. Ohne meine Familie, meine Kinderfrau und meine erstklassige Assistentin ginge es nicht. Wie wichtig ist es, immer verfügbar zu sein, um Erfolg zu haben? Ich bin in der Dienstleistungsbranche tätig und der Kunde erwartet für sein Geld einen erstklassigen Service. Das bedeutet auch, dass ich zu Beginn eines Projektes dem Kunden alle meine Telefonnummern gebe, auch die private. Die Kunden nehmen dieses Angebot jedoch selten in Anspruch, für sie ist vor allem das Gefühl der ständigen Verfügbarkeit wichtig. Bei den Kollegen kann man sich mit guter Organisation und klaren Absprachen die Freiräume schaffen, die man braucht. Und wie wichtig sind die Studienfächer und die Noten? Im Bewerbungsprozess sind hervorragende Noten wichtig, um überhaupt erstmal in die engere Auswahl zu kommen. Sie beweisen, dass man sich für etwas engagiert hat, dass man in der Lage ist, sich erfolgreich in Themen einzuarbeiten, und dass man auch die dafür nötigen Grundvoraussetzungen mitbringt. Dabei ist es unwichtig, ob die sehr guten Noten in Biochemie, in Maschinenbau oder in Journalistik erworben wurden. Wichtig sind andere Fähigkeiten. Welche? Ein Hochschulabsolvent, der Consultant werden möchte, sollte interessiert und neugierig auf immer neue Themen aus der Welt der Wirtschaft sein und muss sich sehr schnell in verschiedene Sachverhalte einarbeiten können. Darüber hinaus braucht er natürlich gute analytische, soziale und kommunikative Fähigkeiten: Unsere Projekte und Aufgabenstellungen sind oft vielschichtig und die damit einhergehenden Fragen nicht einfach zu beantworten. Gleichzeitig muss er sehr gut mit Menschen umgehen können. Denn der arrogante Berater ist passé – ein enger und guter Kontakt zu den Kundenmitarbeitern und Teammitgliedern ist uns äußerst wichtig. Was sollte man noch vorweisen können, wenn man von Ihnen eingestellt werden möchte? Erste Praktika in einem Unternehmen, Auslandserfahrung und noch etwas Interessantes, Ungewöhnliches. Egal, ob die Bewerber für eine Handballmannschaft Tore geworfen haben, mit einer Theatertruppe vor großem Publikum aufgetreten sind oder sich für ein Entwicklungshilfeprojekt eingesetzt haben. Wir wollen vor allem sehen, dass sie sich für mehr als nur das unmittelbare Umfeld interessieren und dass sie wirklich etwas bewegen wollen und können. Was können weibliche Consultants besser als ihre männlichen Kollegen? Es gibt tatsächlich Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Beratern. Je nachdem können diese sich sehr positiv, aber auch negativ auswirken. Sorgfältiges Beobachten, ausgeprägte soziale Fähigkeiten und ein gutes Gespür dafür, was die Kunden wirklich bewegt – das sind Fähigkeiten, die man besonders häufig bei Beraterinnen antrifft. Ebenso die Fähigkeit zu reflektieren und sich in Frage zu stellen. Das ist zunächst mal positiv. Diese Reflexionsfähigkeit führt aber leider auch dazu, dass Frauen viel kritischer mit sich umgehen und dadurch manchmal deutlich zurückhaltender sind als ihre männlichen Kollegen. Egal ob Mann oder Frau, wichtig ist, sich über seine eigenen Fähigkeiten im Klaren zu sein, sowohl die positiven als auch die negativen. Und entsprechend damit umzugehen, ohne sein Licht dabei unter den Scheffel zu stellen. Warum suchen Sie gezielt Frauen? Der Grund ist unser Wunsch nach Vielfalt: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gemischte Teams einfach am erfolgreichsten sind. Also Teams mit Absolventen verschiedener Fachrichtungen, mit Beratern unterschiedlicher Seniorität – und eben mit Männern und Frauen. Manche Unternehmen verlangen sogar explizit Beraterinnen in den BCG-Teams. Schließlich machen Frauen einen Großteil ihrer Kundschaft aus – daher wollen sie auf die weibliche Perspektive nicht verzichten. Ihr Karriere-Tipp für unsere Leserinnen und Leser? Karriere ist nicht alles. Man sollte nie sein ganzes Leben für die Karriere aufgeben, sondern immer bedenken, dass es noch andere wichtige Dinge im Leben gibt. Und wenn man dies im Hinterkopf behält, tut das auch der Karriere gut.Zur Person
Kirsten Lange, 42 Jahre, studierte Journalismus, Philosophie und Soziologie in München. Eigentlich wollte sie Journalistin werden, doch ein Praktikum während des Studiums weckte ihr Interesse für die Unternehmensberatung. Nach dem Studium begann sie 1990 als Beraterin bei The Boston Consulting Group und arbeitete zunächst für Kunden aus verschiedenen Branchen in Europa und den USA. Anschließend war sie zwei Jahre lang für das BCG-Büro in Shanghai tätig. Im Rahmen eines von BCG gesponserten MBA-Programms an der renommierten französischen Business School Insead vertiefte sie ihr betriebswirtschaftliches Wissen. Im Jahr 2000 wurde sie in die BCG-Partnergruppe aufgenommen und ist als Sector Leader für die weltweiten Aktivitäten der Unternehmensberatung in der Papierindustrie verantwortlich. Kirsten Lange ist verheiratet, hat zwei Söhne und arbeitet Teilzeit.
Zum Unternehmen
The Boston Consulting Group wurde 1963 von Bruce D. Henderson, dem Pionier der Strategieberatung, gegründet. 1975 übergab Henderson die Firma an seine Mitarbeiter – die Firma gehört heute den rund 500 Partnern. Zu bekannten BCG-Konzepten gehören etwa die Portfoliomatrix oder die Erfahrungskurve. Mit einem weltweiten Umsatz von 2,4 Milliarden US-Dollar, 4300 Beratern und 66 Büros in 38 Ländern gehört BCG zu den größten internationalen Unternehmensberatungen. Seit dem 1. Januar 2004 ist ein Deutscher an der Spitze des Unternehmens: Dr. Hans-Paul Bürkner aus Frankfurt leitet die Strategieberatung als weltweiter CEO.