Martina Violetta Jung war 32 Jahre alt und arbeitete höchst erfolgreich als Wirtschaftsanwältin. Dann machte ihr der Körper einen Strich durch die Rechnung: Burn-out-Syndrom. Sie begann eine zweite Karriere als Managerin und eine dritte als Unternehmensberaterin – bis sie einige Jahre später erneut einen Punkt erreichte, an dem sie merkte: Es muss sich etwas ändern. Heute schreibt Martina Violetta Jung fiktive Geschichten für die harte Businesswelt. Ihr Ziel: Hunderttausenden Herzensnahrung zu servieren, damit sie wieder aus ihrem ganzen Wesen heraus begeistert arbeiten können und ihre Fähigkeiten zum Wohle aller einsetzen. Das Interview führte André Boße.
Zur Person
Dr. Martina Violetta Jung absolvierte eine internationale Ausbildung zur Volljuristin in Deutschland, China, Hong Kong und Großbritannien und begann ihre Karriere als Wirtschaftsanwältin. Anschließend sammelte sie Managementerfahrung in Führungspositionen bei der Hapag-Lloyd Container Linie, als CEO von Ahlers, als Leadership- und Integrationscoach sowie als Aufsichtsrätin in international aktiven Unternehmen.
Angeregt durch Ausbildung und berufliche Tätigkeit in Asien vertiefte sie sich in das fernöstliche Wissen über den Menschen und sein Verständnis der Wirklichkeit. Als Expertin für ganzheitlich bewusstes Arbeiten widmet sie sich heute ihrer Vision einer Arbeitswelt im Wandel.
Frau Dr. Jung, als wie stringent würden Sie ihre Laufbahn bezeichnet?
(lacht) Also, Stringenz entdecke ich bei mir nur in der Seele. Ich bin von meinem Weg mehrere Male abgekommen. Ich habe Jura studiert, weil ich dachte, Recht und Gerechtigkeit hätten etwas miteinander zu tun – ganz grobe Fehleinschätzung. Ich bin Arbeiterkind und war die erste in der Familie, die Abitur gemacht hat.
Trotzdem haben mich meine Eltern geprägt, weil sie mir Gerechtigkeit vorgelebt haben und mir auf den Weg gegeben haben: Es ist nicht wichtig, wie viel du hast, sondern wie du mit den anderen umgehst. Deshalb wollte ich Jura studieren, denn ich dachte weiterhin, Recht und Gerechtigkeit hätten etwas miteinander zu tun. Ich habe mich also durch mein Jurastudium bewegt, wissend, dass ich Richterin werden wollte – aber ich war damit nicht glücklich.
Warum nicht?
Während meiner Referendarzeit habe ich gemerkt, dass sehr viele Richter und Staatsanwälte in erster Linie nur einen sicheren Job wollten. Und das war mir zu wenig.
Sie sind dann Wirtschaftsanwältin geworden.
Ich hatte einen Professor an der Uni, für den war es die Traumvorstellung schlechthin, als Wirtschaftsanwalt zu arbeiten. Und zwar international. Zu mir hat er gesagt: Wer bei mir promoviert, der geht ins Ausland. Nicht in der Bibliothek bleiben, sondern: Nase raus. Das habe ich dann auch gemacht und bin nach China gegangen. Und dort habe ich gelernt, worum es im Leben eigentlich geht.
Ich bekam einen chinesischen Professor, 82 Jahre alt. Ich erklärte ihm, über welches Thema ich bei meiner Promotion schreiben wollte, und er sagte mir: „Dieses Wissen kannst du hier nicht finden. Du kannst nur dann über China schreiben, wenn du die Chinesen verstehst. Also fährst du jetzt dahin, wo Wirtschaft wirklich stattfindet, und redest mit den Leuten. Aber, du beurteilst sie nicht. Denn dafür fehlt dir die Erfahrung – außerdem musst du ja hier nicht leben, deshalb steht dir kein Urteil zu.“
Besaßen Sie dafür genügend Chinesischkenntnisse?
Ab dem 6. Semester hatte ich Chinesisch gelernt. Mir war früh klar, dass ich als Juristin in eine Umgebung wollte, von der ich wusste, dass ich dort nichts verstehe. Und dass man dort wiederum mich nicht versteht. Dieses Erlebnis wollte ich haben.
Warum hatten Sie dieses Bedürfnis?
Ich bin eine mutige Frau. Mein Mut wird größer, je lauter die Stimmen werden, die sagen: „Das geht nicht, das darfst du nicht.“
Wie ging die Geschichte mit Ihrem chinesischen Professor weiter?
Ich war in China unterwegs, und als ich wiederkam, sagte ich ihm: „Ich denke, ich habe verstanden.“ Darauf sagte er: „Gut, dann fängt jetzt die eigentliche Arbeit an.“ Ich dachte daran, nun meine Promotion und weitere Publikationen zu schreiben, er aber sagte: „Nein, nein, du musst erst noch mehr verstehen.“ Ab dann bin ich einmal die Woche bei ihm gewesen, und er hat mich ins klassische chinesische Wissen eingeführt, hat mir erklärt, warum es so wichtig ist, eine Balance aus Körper, Seele und Geist zu finden.
Als ich dann nach Deutschland zurückkam, begann schon bald die Krise. Ich war 32 Jahre alt – und hatte das, was man heute Burn-out-Syndrom nennt. Nach außen sah das alles super aus. Ich war jung, bekam ein für die damalige Zeit astronomisches Gehalt. Die Kanzleien liefen hinter mir her, weil ich in Deutschland eine von lediglich drei voll ausgebildeten Juristen war, die einigermaßen Chinesisch sprachen. Und ich? Habe gelitten.
Können Sie Ihr Leiden von damals beschreiben?
Wir wissen, dass wir aus Körper, Geist und Seele bestehen. Wenn die drei Bestandteile des Seins auseinanderfallen – dann ist es Ihr Körper, der Sie nicht anlügt. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich eines Morgens nicht mehr aufstehen konnte. Ich litt unter Herz-Rhythmus-, Nieren- und Leberstörungen. Und ich war intellektuell noch nicht einmal mehr in der Lage, die Nachrichten zu verstehen. Mit 32 Jahren. Rumms!
Die “Business-Poetin”
Auf ihrer Seite www.heilendegeschichten.de stellt sie als „Business-Poetin“ Gedichte und Geschichten vor, die zudem als Bücher und e-Bücher erhältlich sind. Amazon-Werbelinks:
» VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungsprozess
» ICH: Inspirierende Geschichten und Gedichte für Karrieremenschen
» Die Hälfte des Himmels ist weiblich – 7 Geschichten von Frauen die handeln.
» Der Wettkampf. Eine Fabel.
Wie kann man sich diesen Kollaps erklären?
Ich war als Wirtschaftsanwältin in einem intellektuellen Hochleistungsumfeld tätig. Ich habe Unternehmen gekauft, verkauft, 14 Stunden am Tag. Was ich damals jedoch noch nicht über mich wusste: Ich bin ein intuitiver Gefühlsmensch. Erst entscheidet sich mein Herz, dann benutze ich das Denken. Ist jedoch das Herz stumm geschaltet, wird es schwierig. Nur, das merken Sie im Alltag nicht. Um Sie herum sind schon zu viele auf Autopilot. Sie merken nur, dass Sie immer müder und desinteressierter werden – und die Arbeitsergebnisse schlechter. Dass Sie abends zwei Gläser Rotwein brauchen, um einschlafen zu können. Sie tun alles, um ihren Körper auszutricksen. Aber der lässt das nicht mit sich machen – und irgendwann rebelliert er.
Wie haben Sie auf diese Rebellion reagiert?
Ich hatte damals das Glück, dass eine Freundin mich zu einer chinesischen Ärztin gebracht hat. Die hat gesagt: „Du hast deine Mitte verloren. Und du warst in China, du solltest wissen, was das heißt: Lass diesen Job los.“ Ich bekam sofort Pickel im Gesicht! (lacht) Denn das ging ja gar nicht: Nach zehn Jahren Ausbildung war ich endlich wer – und jetzt sagt jemand, ich soll den Job loslassen?
Ich hatte Existenzangst, klar, und mein erster Impuls war es, den Ratschlag zu verweigern. Ich konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes für mich zu tun gab. Der Jurist ging in seinem juristischen Beruf auf – ja worin denn auch sonst? Ich habe neun Monate gebraucht, um mit meiner Angst umzugehen. Dann entwickelte ich einen beruflichen Plan-B: Ich könnte meine Unternehmenskenntnisse ja auch in der Wirtschaft einsetzen.
Am nächsten Montag bin ich in die Kanzlei gegangen und habe gekündigt.
Sie sind dann zur Reederei Hapag Lloyd gewechselt.
Genau, dorthin hatte ich persönliche Kontakte. Ich wollte über dieses Unternehmen eigentlich nur ein paar Ideen bekommen, dann hieß es: Du kommst zu uns. Ich frage: „Wie? Ich habe keine Ahnung von der Schifffahrt.“ Mein zukünftiger Chef sagte daraufhin: „Stimmt, aber du hast Ahnung von Menschen.“ Und dann hat er mir aus dem Stand eine verantwortungsvolle Position angeboten. Das war freitags, und am nächsten Montag bin ich dann in die Kanzlei gegangen und habe gekündigt.
Wie reagierte man dort?
Der Seniorpartner guckte sehr ernst und sagte: „Sie haben richtig gehandelt. Sie wären hier nicht glücklich geworden.“ Dann guckte er runter und bekam plötzlich einen sehr väterlichen Blick. Er sagte: „Ich werde Sie vermissen. Wer ist jetzt hier unser gutes Gewissen? Und dass Sie es wissen: Die wollten Sie zweimal rausschmeißen, aber das habe ich verhindert.“
Warum standen Sie in der Kanzlei auf der Kippe?
Wenn ein Seniorpartner verbal aggressiv bei seiner Sekretärin Dampf abließ, dann bin ich erst in das Zimmer der Sekretärin und habe die getröstet. Dann bin ich zum Seniorpartner und habe ihn gesagt, dass er sich unmöglich verhalten habe – um es vornehm auszudrücken.
Das ist mutig.
Innere Überzeugung. Ich hab’ mich nie gefragt, ob das gut für meine Karriere ist. Egal, mein Herz hat gesagt, das ist richtig.
Woher wussten Sie denn, dass Sie bei Ihrem Job bei der Reederei nicht die gleichen Probleme bekommen wie in der Kanzlei?
Das wusste ich gar nicht. Seit meinen Erfahrungen in China und später in Hong Kong und Japan versuche ich nicht mehr, die Welt im Griff zu haben oder glaube, sie planen zu können. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das geschafft hätte. Auch unsere Unternehmen schaffen das ja nicht.
Was Ihnen als Jurist immer hilft: Sie haben eine besondere Art und Weise des Denkens gelernt.
Hat Ihnen Ihr juristisches Know-how beim neuen Job geholfen?
Was Ihnen als Jurist immer hilft: Sie haben eine besondere Art und Weise des Denkens gelernt. Hier ist ein Problem – und als Jurist können Sie von fünf verschiedenen Ecken auf dieses Problem schauen, in fünf verschiedenen Sichtweisen argumentieren – und die Dinge dann sehr scharf auf den Punkt bringen. Ich kann auch mit Druck sehr gut umgehen, wenn mein Herz sagt, das ist richtig. Aber wehe, das ist nicht der Fall …
Was dann?
Dann weiß ich mittlerweile, dass es dringend an der Zeit ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Nach meiner Zeit bei Hapag Lloyd habe ich zunächst als CEO für einen belgischen Logistikkonzern gearbeitet, anschließend neun Jahre selbständig als Leadership und Integrations Coach. Ich war erfolgreich, war viel in Europa unterwegs. Dann stellte ich fest, dass ich mich in diesem Job erneut aufzehrte. Meine Ehe ging kaputt, ich war nicht glücklich – und da habe ich erneut den Stecker gezogen und gesagt: Schluss jetzt. Ich habe alles verkauft und bin mit meinem Auto, zwei Koffern und meinem Laptop nach Hamburg zurückgekommen.
Da waren Sie ja ziemlich alleine, oder? Die Ehe war kaputt, die Kunden waren weg, keine Boardingpässe mehr, keine Anrufe …
Genau. Ich war ein Niemand.
Wie ging es Ihnen damit, plötzlich ein Niemand zu sein?
Es hilft total dabei, sich aufrichtig und vorbehaltlos mit sich selbst zu beschäftigen. Seine wahren Fähigkeiten zum Vorschein kommen zu lassen folgt dem Apfelbaum-Prinzip: Es hängen im August Äpfel am Baum, wenn der Baum im Winter geruht hat. Fällt die Winterruhe aus, können Sie die Sache mit den Äpfeln vergessen.
Meine Intuition ist in der Lage, Menschen und komplexe Sachverhalte zu durchschauen und in wenigen Worten auf deren Essenz zu reduzieren.
Was haben Sie in dieser Ruhephase über sich gelernt?
Noch einmal die Bestätigung: Ich bin ein intuitiver Gefühlsmensch. In dieser Reihenfolge: Ich hole mir meine Informationen über die Intuition, das Herz entscheidet, dann arbeitet der Kopf intellektuell ab. Wenn ich den Spieß umdrehe, so wie ich es als Wirtschaftsanwältin getan habe, arbeite ich meinem eigenen Wesen zuwider. Meine Intuition ist in der Lage, Menschen und komplexe Sachverhalte zu durchschauen und in wenigen Worten auf deren Essenz zu reduzieren.
Das schockiert Anfangs viele. Aber sie merken schnell, mein Herz meint es ehrlich und mein Kopf urteilt nicht. Was ich in der Ruhephase zudem feststellte: Was mich besonders gereizt hatte bei meiner Arbeit, war die Möglichkeit, Leuten tatsächlich helfen zu können, im Einklang mit all ihren Fähigkeiten zu arbeiten. So entstand die Idee, ein Buch zu schreiben – und zwar eines, das viel mehr Menschen berührt und bewegt, als ich über meinen Job jemals erreichen könnte.
Bei „Ich kann so nicht mehr arbeiten“ handelte es sich noch um einen Ratgeber, aber dann folgten mit „VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungsprozess“ und „ICH“ fiktive Geschichten, in denen Sie Ihr Wissen aus dem Wirtschaftsalltag einsetzen. Warum?
Gegenfrage: Wie viele Sachbücher, die Sie je gelesen haben, kennen Sie auswendig? Winnetou, Frodo Beutlin, Harry Potter und Katniss Everdeen – das sind die Figuren, mit denen man sich identifizieren kann – die brauchen wir auch in unseren Unternehmen. Ihr Gefühl und Ihr Gehirn sortieren Informationen nach dem emotionalen Wert. Je höher dieser Gefühlsfaktor ist, desto länger und nachhaltiger bleiben die Informationen in Ihrem Gehirn. Und das hilft mir natürlich, weil ich mit meinen Büchern durchaus ambitionierte Ziele verfolge.
Welche sind das?
Wenn ich in einen Spiegel schaue, dann suche ich Bestätigung. Sei es den Spiegel an der Wand oder den Spiegel der Erwartungshaltungen meines Umfeldes. Wenn ich aber hinter die äußere Hülle, die Fassade, schaue, tief in mich hinein, dann suche ich meine Mitte, meine Herzenswärme, meiner Seele Potential und kann es auch entfalten, zum Wohle aller. Auf Seelenebene sind alle Menschen eins. Wenn ich aus meiner Seele, aus meiner Mitte, aus meinem Herzen heraus lebe, kann ich das umsetzen. Solche Menschen brauchen wir in verantwortlichen Positionen in unseren Unternehmen.
Das ist enorm bedeutsam, denn für mich ist die Wirtschaft der Machtfaktor, der die Welt gestaltet – weniger die Politik. Und noch ein dritter Punkt, ich möchte zeigen, was Weiblichkeit tatsächlich zu leben zur Unternehmensgestaltung beitragen kann. Daher heißt mein neues Buch „Die Hälfte des Himmels ist weiblich“. Wichtig ist mir dabei, dass wir Frauen selbst erst einmal definieren, was weiblich ist. Das tun wir im Moment viel zu wenig. Nur Pippi Langstrumpf war darin genial.
Michelle Obama sagt ihre Meinung, lebt Werte, zeigt Haltung. Das finde ich stark.
Umso mehr machen das die Männer …
Ja. Das neue Buch erzählt daher in sieben Episoden, was passiert, wenn Frauen es wagen, ihre weibliche Sichtweise einzubringen und unerhörte Dinge tun. Ich möchte damit Frauen Mut machen, ihre Weiblichkeit zu leben, statt zu sagen: „Wenn ich mich so verhalte, wie Mann es von mir erwartet, bekomme ich keine Probleme und mache Karriere.“ Ein tolles Beispiel dafür, wie es anders gehen kann, ist Michelle Obama. Schon die äußere Erscheinung, ärmelloses Trägerkleid – aber man sieht die Muckis. Sie ist nicht wie Jackie Kennedy, kein zartes Püppchen, das gefallen will. Michelle Obama sagt ihre Meinung, lebt Werte, zeigt Haltung. Das finde ich stark.
Was raten Sie einem jungen Menschen, der früh in seiner Karriere feststellt, dass die innere Balance verloren geht?
Renn um dein Leben! In „Die Hälfte des Himmels ist weiblich“ geht es nicht um Frau und Mann sein. Mein Plädoyer lautet: Lebt eure Herzenswahrheiten! Wir können allen Luxus dieser Welt anhäufen, aber davon können wir nicht leben, als Menschheit nicht überleben. Es geschafft zu haben, ist nur eine Illusion, eine fixe Idee. Und wenn Idee und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dann tut es weh. Die Frage ist daher: Was ist meine Wirklichkeit, wer bin ich wirklich und was ist nur meine oberflächliche Idee von mir? Wenn zwischen der Antwort auf diese Frage und dem, was ich beruflich tue, ein Konflikt besteht, dann stellt sich nicht die Frage, ob es knallt. Die Frage lautet dann nur noch, wann es knallt – und wie weh es dann tut.
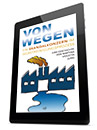 Neu: Roman, Dr. Martina Violetta Jung, VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungs-prozess, E-Book, Amazon 8,95 Euro.
Neu: Roman, Dr. Martina Violetta Jung, VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungs-prozess, E-Book, Amazon 8,95 Euro.





 Das Buch „Steuerung von Corporate Social Responsibility durch Recht“ greift die These auf, dass zuletzt auch staatliche und überstaatliche Stellen die Dynamik der Thematik CSR aufgegriffen haben und somit vermehrt von einer „Verrechtli-chung“ der CSR gesprochen wird. Der Autor identifiziert und strukturiert das vielfältige Normenmaterial der CSR-Politik und schafft damit einen Zugang zu einer rechtlichen Betrachtung der Thematik.
Das Buch „Steuerung von Corporate Social Responsibility durch Recht“ greift die These auf, dass zuletzt auch staatliche und überstaatliche Stellen die Dynamik der Thematik CSR aufgegriffen haben und somit vermehrt von einer „Verrechtli-chung“ der CSR gesprochen wird. Der Autor identifiziert und strukturiert das vielfältige Normenmaterial der CSR-Politik und schafft damit einen Zugang zu einer rechtlichen Betrachtung der Thematik. 




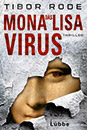 Eigentlich ist Tibor Rode Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Informationstechnologierecht. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg. Doch nebenbei ist inzwischen mit „Das Mona-Lisa-Virus“ sein dritter Roman erschienen. Darin passieren Ereignisse, die nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Doch die Geschichte nimmt ihren Lauf.
Eigentlich ist Tibor Rode Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie für Informationstechnologierecht. Zudem ist er Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg. Doch nebenbei ist inzwischen mit „Das Mona-Lisa-Virus“ sein dritter Roman erschienen. Darin passieren Ereignisse, die nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Doch die Geschichte nimmt ihren Lauf.  Der promovierte Jurist Dr. Henning Scherf war lange Jahre Sozial-, Bildungs- und Justizsenator und von 1995 bis 2005 Bürgermeister und damit Ministerpräsident des Bundeslandes Bremen. Zusammen mit der Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Prof. Dr. Annelie Keil, ehemalige Dekanin der Universität Bremen und deren Mitbegründerin, geht er in einem geradeerschienenen Buch der Frage nach: Wie wollen wir sterben? Die beiden beschreiben dabei sehr persönliche Erfahrungen, gleichzeitig fordern und fördern sie aber auch eine gesellschaftliche Kursänderung.
Der promovierte Jurist Dr. Henning Scherf war lange Jahre Sozial-, Bildungs- und Justizsenator und von 1995 bis 2005 Bürgermeister und damit Ministerpräsident des Bundeslandes Bremen. Zusammen mit der Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Prof. Dr. Annelie Keil, ehemalige Dekanin der Universität Bremen und deren Mitbegründerin, geht er in einem geradeerschienenen Buch der Frage nach: Wie wollen wir sterben? Die beiden beschreiben dabei sehr persönliche Erfahrungen, gleichzeitig fordern und fördern sie aber auch eine gesellschaftliche Kursänderung. 
 Er war namhafter Kölner Politiker, Anwalt und Zeitzeuge umwälzender Phasen der deutschen Geschichte: Josef Haubrich (1889–1961) – der nie den Glauben an die Kunst und deren unabdingbaren Wert für die Menschheit verlor. Zeitlebens von Kultur und Politik fasziniert, ließ er sich seine Neugier nicht nehmen und setzte sich voller Begeisterung für die zeitgenössische Kunstszene ein. Seine beachtenswerte Sammlung expressionistischer Werke konnte er in die Nachkriegszeit hinüberretten und schenkte sie 1946 der Stadt Köln. Das 70-jährige Jubiläum der Schenkung war Anlass, sich erneut mit dieser prägenden Person des Kölner Kulturlebens auseinanderzusetzen:
Er war namhafter Kölner Politiker, Anwalt und Zeitzeuge umwälzender Phasen der deutschen Geschichte: Josef Haubrich (1889–1961) – der nie den Glauben an die Kunst und deren unabdingbaren Wert für die Menschheit verlor. Zeitlebens von Kultur und Politik fasziniert, ließ er sich seine Neugier nicht nehmen und setzte sich voller Begeisterung für die zeitgenössische Kunstszene ein. Seine beachtenswerte Sammlung expressionistischer Werke konnte er in die Nachkriegszeit hinüberretten und schenkte sie 1946 der Stadt Köln. Das 70-jährige Jubiläum der Schenkung war Anlass, sich erneut mit dieser prägenden Person des Kölner Kulturlebens auseinanderzusetzen: 
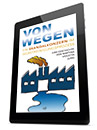 Neu: Roman, Dr. Martina Violetta Jung, VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungs-prozess, E-Book, Amazon 8,95 Euro.
Neu: Roman, Dr. Martina Violetta Jung, VON WEGEN – Ein Skandalkonzern im Selbstreinigungs-prozess, E-Book, Amazon 8,95 Euro.




