Politik und Industrie sind sich einig: Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel für eine klimaneutrale Energieversorgung. Damit das Element die Hoffnungen erfüllen kann, liegt noch Arbeit an: Effiziente Elektrolyse-Verfahren, zuverlässige Transporte und genügend Strom aus erneuerbaren Energien sind die Voraussetzungen dafür, dass Wasserstoff zum entscheidenden Faktor für den „Green Deal“ wird. von André Boße
Wer große Schiffe in Bewegung, Passagierflugzeuge in die Luft oder industrielle Anlagen in Betrieb bringen möchte, benötigt dafür viel Energie. Noch immer hält sich hartnäckig die Vorstellung, ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe könne das technisch und wirtschaftlich nicht funktionieren. Jedoch hat in den vergangenen Monaten eine Technologie für Aufmerksamkeit gesorgt, die der Energiewende neue Impulse geben kann – eben weil sie das Potenzial besitzt, den großen Energiehunger der Industrie zu stillen: Grün produzierter Wasserstoff wird zum Hoffnungsträger einer Energieversorgung, die selbst Anlagen der Stahl- oder Chemie-Industrie antreibt – und dabei doch klimaneutral bleibt.
Wasserstoff als Treiber für den Green Deal
Im Juni 2020, mitten in der Corona-Pandemie, überraschte die Bundesregierung mit der Vorstellung einer „Nationalen Wasserstoffstrategie“, inklusive Einberufung eines „Nationalen Wasserstoffrats“. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die Politik hofft, der Ökonomie mit Hilfe der neuen Energietechnik einen „doppelten Schub“ zu geben, wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze sagt: erstens in Richtung Klimaschutz, zweitens in Richtung Aufschwung nach der Corona- Krise. „Grüner Wasserstoff bietet uns die Chance, Klimaschutz in den Bereichen voranzubringen, wo wir bisher noch keine Lösungen hatten, zum Beispiel in der Stahlindustrie oder im Flugverkehr“, sagte Svenja Schulze. Das funktioniere, weil die Strategie vor allem auf die Förderung von „grünem Wasserstoff“ ausgerichtet ist, der zu „100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewonnen wird“.
Neue Energiepartnerschaften
In einer „Wasserstoff-Roadmap für Deutschland“ zeichnen verschiedene Fraunhofer-Institute das Bild einer „globalen Energiewende“: Künftige Energie-Exporteure werden Länder und Regionen sein, in denen viel erneuerbare Energie gewonnen werden kann und selbst vergleichsweise wenig Energie benötigt wird. „Viele Regionen in der Welt bereiten sich auf diese Form des Handels nachhaltig erzeugter Energieträger und Basis-Chemikalien vor, was für Deutschland neue Energiepartnerschaften jenseits der bisherigen fossilen Energiepartnerschaften ermöglicht“, heißt es in der Fraunhofer-Roadmap. Zur Realisierung solcher Handelsrouten werde den internationalen Häfen und deren angrenzenden Industrieregionen eine große Bedeutung zukommen, da hier häufig nicht nur Raffinerien angesiedelt seien, sondern auch über die Logistikrouten eine Verteil-Infrastruktur der Wasserstoffprodukte gegeben sei. Direkt transportiert werden kann Wasserstoff in flüssiger Form sowie in chemisch gebundener Form wie Ammoniak, Methanol oder auch LOHC (Liquid Organic Hydrogen Carriers).
Auf die Initiative der deutschen Bundesregierung folgte einen Monat später eine Wasserstoffstrategie der EU: Für die Kommission ist die Wasserstofftechnologie ein entscheidendes Standbein, um den europäischen „Green Deal“ zu verwirklichen, der auf dem Kontinent fortan die Bereiche Technik, Ökonomie und Ökologie prägen soll. „Wasserstoff wird in der EU bisher nur begrenzt eingesetzt und weitgehend aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Ziel der Strategie ist es, die Wasserstofferzeugung zu dekarbonisieren“, heißt es in einem „Fragen und Antworten“-Dokument der EU-Kommission.
Was kann Wasserstoff als Energieträger leisten – und was nicht? Sein großer Vorteil: Er ist das chemische Element, das auf der Erde und auch im ganzen Universum am häufigsten vorkommt. Das Problem: Wir begegnen dem Element fast immer in gebundener Form, also als Wasser, H2O. Mit dem Verfahren der Wasserelektrolyse kann das Wasser mit Hilfe von Elektroden gespalten, also der Sauerstoff vom Wasserstoff getrennt werden. Doch dieser Schritt benötigt viel Energie, und ein „grüner“ Energieträger ist Wasserstoff nur dann, wenn der Strom, der für das Verfahren benötigt wird, zu einhundert Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Ist das realistisch?
Elektrolyse effizienter machen
Am Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) arbeitet eine Arbeitsgruppe daran, den Vorgang der Aufspaltung von Wasser effizienter zu machen. Ansatzpunkt ist dabei das Material, das für die Elektroden benutzt wird: Gesucht werden Stoffe, die wie Katalysatoren wirken und den Vorgang besser unterstützen als es die Edelmetalle tun, die bislang häufig eingesetzt werden. Die Forschenden vermischen dafür verschiedene Materialien und analysieren ihre Wirkung auf die Elektrolyse. Auf diese Art entsteht eine „Wanderkarte der Katalyse“, die Dr. Marcel Risch aus der Nachwuchsgruppe Oxygen Evolution Mechanism Engineering entwickelt hat. „Die Idee dazu kam mir bei einer Wanderung durch den Harz“, berichtet er. „So wie es die unterschiedlichsten Wanderrouten gibt, existieren auch verschiedenste Wege der Elektrolyse mit verschiedenen Katalysatoren, die sich oft an Zwischenstufen kreuzen. Wie auch beim Wandern kosten manche davon mehr Energie, manche weniger. Sie alle in einer Karte zu verzeichnen, könnte letztlich die Suche nach dem effizientesten Weg beschleunigen.“
Die Kosten für Elektrolyseure haben sich in den letzten zehn Jahren bereits um 60 Prozent verringert und werden sich bis 2030 im Vergleich zu heute voraussichtlich halbieren.
Wird die Herstellung von Wasserstoff effizienter, steigt die Chance, die für die Energiewende benötigten Mengen des Energieträgers mit Hilfe von klimaneutralem Strom herzustellen. Aber rechnet sich das auch wirtschaftlich? Noch nicht. Im Hinblick auf die Kosten sei erneuerbarer Wasserstoff gegenüber fossilem Wasserstoff aktuell nicht wettbewerbsfähig, heißt es im Papier der EU-Kommission: „Die Kosten für fossilen Wasserstoff, die in hohem Maße von den Erdgaspreisen abhängen, werden unter Außerachtlassung der CO2-Kosten für die EU derzeit auf etwa 1,50 Euro pro Kilogramm geschätzt, die geschätzten Kosten für erneuerbaren Wasserstoff auf 2,50 bis 5,50 Euro pro Kilogramm.“ Ernüchternd? Nicht, wenn man in die Zukunft blickt.
Energie aus Afrika
Die Strategieberatung Arthur D. Little veröffentlicht die neue Analyse „The efficiency of hydrogen rethought“ zur Energieeffizienz von grünem Wasserstoff im Vergleich zur direkten Stromnutzung durch zum Beispiel Batteriefahrzeuge: vom Solarpanel bis zum Antrieb im Fahrzeug. Das Ergebnis: Wasserstoff, häufig mit dem Makel mangelhafter Energieeffizienz versehen, hat das Potenzial, Nachteile bei der Umwandlung in großen Teilen zu egalisieren, sofern grüner Wasserstoff aus Regionen mit hohem Solareintrag – etwa in Afrika – importiert wird.
Positiv stimmt die EU ein Blick auf die Preisentwicklung: Die Kosten für „grünen Wasserstoff“ sinken bereits rasch. „Die Kosten für Elektrolyseure haben sich in den letzten zehn Jahren bereits um 60 Prozent verringert und werden sich bis 2030 im Vergleich zu heute voraussichtlich halbieren.“ Die Prognose der EU: „In Gebieten, in denen Strom aus erneuerbaren Energiequellen billig ist, werden Elektrolyseure im Jahr 2030 voraussichtlich mit fossilem Wasserstoff konkurrieren können.“ Das Handelsblatt zitiert aus einer Studie der Energieexperten der New Yorker Investmentbank Morgan Stanley, nach der der Preis für erneuerbaren Strom an „besonders günstigen Orten“ bereits ab 2023 so niedrig sein wird, dass grüner Wasserstoff aus Windstrom zu Wasserstoff aus Erdgas konkurrenzfähig sein werde, wenn zeitgleich die Elektrolyse-Technik effizienter werde und die „grüne Wasserstoffwirtschaft politische Unterstützung erhält“, zitiert das Handelsblatt aus der Energiemarkt-Analyse.
Real-Labor an der Nordseeküste
Während das US-Investmentunternehmen Morgan Stanley bei diesen „besonders günstig gelegenen Orten“ das weitläufige Texas im Blick hat, findet sich in Deutschland eine solche Gegend in der Nordsee. „Westküste 100“ nennt sich eine branchenübergreifende Partnerschaft aus Unternehmen, die vor der Küste von Schleswig-Holstein aus Offshore- Windenergie mit Hilfe einer innovativen Elektrolyse- Anlage Öko-Wasserstoff produzieren will. Dabei versteht sich das Projekt als „Real-Labor“, in dem die Erzeugung, aber auch die Verteilung der Wasserstoffenergie entwickelt und ausprobiert werden sollen. Für die Wasserstoffproduktion wird dabei nur überschüssiger Strom genutzt, heißt es in der Projektvorstellung. Der gewonnene Wasserstoff soll in einem unterirdischen Speichersystem gelagert und über Pipelines den ans Netz angeschlossenen Industrieunternehmen zur Verfügung gestellt werden.
Wasserstoff wird günstiger
Die Kosten von Wasserstoff-Anwendungen werden in den nächsten zehn Jahren um bis zur Hälfte sinken. Dadurch würde Wasserstoff mit anderen kohlenstoffarmen Alternativen konkurrenzfähig werden. Dies ist das Ergebnis der Studie „Path to hydrogen competitiveness“ des Hydrogen Council und der Unternehmensberatung McKinsey. Hydrogen Council ist eine globale Vereinigung aus 60 führenden Energie-, Transport- und Industriekonzernen, darunter Airbus, Audi, BMW, Daimler, Bosch, Thyssenkrupp und zahlreichen Wasserstoffkonzernen. Besonders im Schwerlastbereich, in der Rohstoffwirtschaft und in industriellen Wärmeprozessen, die zusammen 15 Prozent des globalen Industrieverbrauchs ausmachen, sehen Experten großes Potenzial für die Brennstoffzelle.
Noch weitergedacht: Weil bei der Aufspaltung des Wassers zusätzlich auch Sauerstoff entsteht, kann dieser in ein Zementwerk eingespeist werden, um dort die Stickstoff-Emissionen zu senken. Zementwerke stehen generell in der Kritik, weil der CO2-Ausstoß ihrer Produktion beträchtlich ist, und auch hier soll das Projekt Positives bewirken: Bringt man nämlich das CO2 als Rohstoff mit dem grünen Wasserstoff zusammen, kann daraus in einer Raffinerie Methanol oder synthetischer Kraftstoff für den Flugsektor hergestellt werden, der eine bessere Treibhausgas-Bilanz besitzt als herkömmliches Kerosin. Am „Real-Labor“-Projekt beteiligt ist auch der Industriekonzern Thyssenkrupp, bei dem grüner Wasserstoff auch in anderen Unternehmensbereichen ein Thema ist.
„Insbesondere den energie- und ressourcenintensiven Industriezweigen wie der Kraftstoff-, Chemie- oder Stahlproduktion eröffnet erst grüner Wasserstoff den Weg zur Klimaneutralität“, sagt Christoph Noeres, Leiter des Bereichs Energy Storage & Hydrogen. Mit Blick auf die Stahlproduktion entstehen dabei neue Kooperationen: Im Juni kündigte Thyssenkrupp eine „Wasserstoffpartnerschaft“ mit dem Energieversorger RWE an: Eine Elektrolyse- Anlage in Lingen soll mit Hilfe von Ökostrom pro Stunde 1,7 Tonnen gasförmigen Wasserstoff erzeugen, der rechnerisch dafür genutzt werden kann, im Duisburger Hochofen rund 50.000 Tonnen „klimaneutralen Stahl“ herzustellen, wie die Verantwortlichen von Thyssenkrupp in einer Pressemitteilung hochrechnen. 2022 soll es soweit sein. Über Wohl und Wehe der Kooperation entscheidet auch die Frage, wie der Wasserstoff zuverlässig und kostengünstig vom Emsland ins Ruhrgebiet kommt. Geplant ist dabei, dass der Wasserstoff über Pipelines transportiert wird, für die ähnliche Regeln gelten wie für den Transport von Erdgas. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass an dieser Schnittstelle zwischen Technik, Infrastruktur und Regelwerk neue Jobs entstehen werden. Die klare Aufgabe: dabei helfen, den „Green Deal“ möglich zu machen.
Globale Energieverträge
Wenn grüner Wasserstoff also tatsächlich zum Alleskönner der Energiewende wird und wenn er darüber hinaus auch noch in Brennstoffzellen die nachhaltige Mobilität vorantreibt oder in Gebäuden als Öko-Alternative für Heizsysteme genutzt wird: Wo sollen die dafür benötigen Mengen herkommen? Klar ist: Deutschlands Offshore-Windparks sind begrenzt – und damit auch diejenigen Orte, die regelmäßig Energieüberschüsse bereithalten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung sieht die Sache realistisch: Deutschland wird auf Exporte aus dem Ausland angewiesen sein, denn der Energiebedarf der Bundesrepublik ist höher als die Energiemenge, die Deutschland selbst produzieren kann. Die Bundesregierung setzt daher auf „strategische Partnerschaften mit West- und Südafrika, wo genügend Flächen und Potenzial für Solar- und Windenergie zur Verfügung stehen, um nicht nur den Energiebedarf vor Ort decken, sondern Energie in Form von Grünem Wasserstoff auch exportieren zu können.“
Für die Politik und die deutschen Unternehmen geht es nun darum zu prüfen, wie dieser Export organisiert werden kann – und zwar nicht nur zuverlässig, sondern auch zu Bedingungen, die nicht neue Formen von Ausbeutung zur Folge haben, sondern die auf fairen Partnerschaften basieren. Schließlich darf es auf keinen Fall dazu kommen, dass die Länder der Nordhalbkugel von grünem Wasserstoff aus afrikanischen Ländern profitieren, dessen Produktion aber den Menschen in den Herkunftsländern selbst Schaden zufügt. Hier kommt es auch für Ingenieure darauf an, globale Energieverträge mitzuentwickeln, die den Wasserstoff der Zukunft nicht nur grün denken – sondern auch fair.
 Foto: AdobeStock/Picture P.
Foto: AdobeStock/Picture P.
Kleine Farbenlehre
Das Energie-Infoportal Solarify definiert die Unterscheidung der verschiedenfarbigen Wasserstoffarten wie folgt:
Grüner Wasserstoff
Bei der Elektrolyse kommt ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz, die Produktion des Wasserstoffs erfolgt damit CO2-frei.
Grauer Wasserstoff
Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. In der Regel wird bei der Herstellung Erdgas unter Hitze in Wasserstoff und CO2 umgewandelt. Bei der Produktion einer Tonne Wasserstoff entstehen rund zehn Tonnen CO2.
Blauer Wasserstoff
Blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, dessen CO2 bei der Entstehung jedoch abgeschieden und gespeichert wird, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt.
Türkiser Wasserstoff
Wasserstoff, der über die thermische Spaltung von Methan (Methanpyrolyse) hergestellt wurde. Anstelle von CO2 entsteht dabei fester Kohlenstoff. Voraussetzung für die CO2-Neutralität ist daher die dauerhafte Bindung des Kohlenstoffs.
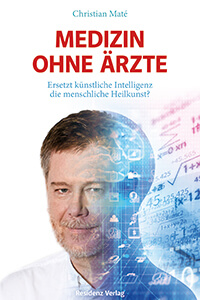 Der Frage, ob künstliche Medizin die menschliche Heilkunst ersetzen kann, geht Christian Maté in seinem neuen Buch nach. Er beleuchtet dabei große Themen: die Zukunft der Medizin, den Einsatz von Artificial Intelligence und Big Data in Diagnostik und Therapie. Was über Jahrhunderte als ärztliche Kunst bezeichnet wurde, können Maschinen zum Teil schon jetzt besser: Krankheiten diagnostizieren, individuelle Behandlungen auswählen oder operative Eingriffe durchführen. Sind Ärzte aus Fleisch und Blut schon bald überflüssig? Was hat der Patient der Zukunft zu erwarten? Christian Maté, selbst Mediziner, entwickelt spannende Thesen für die digitale Zukunft. Christian Maté: Medizin ohne Ärzte. Residenz Verlag 2020. ISBN 978-3-701-73502-0. 22 Euro
Der Frage, ob künstliche Medizin die menschliche Heilkunst ersetzen kann, geht Christian Maté in seinem neuen Buch nach. Er beleuchtet dabei große Themen: die Zukunft der Medizin, den Einsatz von Artificial Intelligence und Big Data in Diagnostik und Therapie. Was über Jahrhunderte als ärztliche Kunst bezeichnet wurde, können Maschinen zum Teil schon jetzt besser: Krankheiten diagnostizieren, individuelle Behandlungen auswählen oder operative Eingriffe durchführen. Sind Ärzte aus Fleisch und Blut schon bald überflüssig? Was hat der Patient der Zukunft zu erwarten? Christian Maté, selbst Mediziner, entwickelt spannende Thesen für die digitale Zukunft. Christian Maté: Medizin ohne Ärzte. Residenz Verlag 2020. ISBN 978-3-701-73502-0. 22 Euro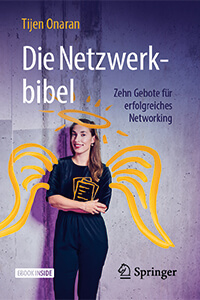 Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: Es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: Ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro
Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch komplexer geworden: Es gibt ein Überangebot an digitalen Plattformen, immer mehr Events und immer mehr Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: Ein tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für Berufseinsteiger. Tijen Onaran zeigt, wie Networking heute wirklich funktioniert. In ihrem ersten Buch gibt die Autorin eigene Erfahrungen weiter, reflektiert ihre Erlebnisse, erzählt Anekdoten aus ihrer Zeit in der Politik und Wirtschaft und leitet daraus konkrete Handlungsempfehlungen ab. Tijen Onaran: Die Netzwerkbibel. Springer 2019. ISBN 978-3-658-23735-6. 19,99 Euro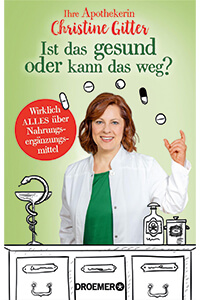 Die erfahrene Apothekerin Christine Gitter nimmt die bunte Welt der Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Superfood – die Hersteller versprechen mehr Gesundheit, Energie und Konzentration. Über Risiken und Nebenwirkungen wird gerne geschwiegen. Informativ und erfrischend unterhaltsam schafft Christine Gitter Abhilfe und beantwortet Fragen wie diese: Was genau bewirken Vitamine und Mineralstoffe im Körper? Sind die versprochenen Wirkungen eigentlich bewiesen? Und können wir getrost auf das eine oder andere Präparat verzichten? Christine Gitter: Ist das gesund oder kann das weg? Droemer HC 2020. 978-3-426-27808-6. 18 Euro
Die erfahrene Apothekerin Christine Gitter nimmt die bunte Welt der Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Superfood – die Hersteller versprechen mehr Gesundheit, Energie und Konzentration. Über Risiken und Nebenwirkungen wird gerne geschwiegen. Informativ und erfrischend unterhaltsam schafft Christine Gitter Abhilfe und beantwortet Fragen wie diese: Was genau bewirken Vitamine und Mineralstoffe im Körper? Sind die versprochenen Wirkungen eigentlich bewiesen? Und können wir getrost auf das eine oder andere Präparat verzichten? Christine Gitter: Ist das gesund oder kann das weg? Droemer HC 2020. 978-3-426-27808-6. 18 Euro Das bewährte Grundlagenwerk für das Wahlpflichtfach „Ethik in der Medizin“ inzwischen in fünfter Auflage wurde gründlich überarbeitet und aktualisiert. Vollständig neu hinzugekommen sind die Kapitel „Ethik und Alter(n) in der Medizin“ sowie „Digitalisierung“. Ethik in der Medizin. 5. Aufl. Reclam 2020. ISBN 978-3-15-019337-2. 16,80 Euro
Das bewährte Grundlagenwerk für das Wahlpflichtfach „Ethik in der Medizin“ inzwischen in fünfter Auflage wurde gründlich überarbeitet und aktualisiert. Vollständig neu hinzugekommen sind die Kapitel „Ethik und Alter(n) in der Medizin“ sowie „Digitalisierung“. Ethik in der Medizin. 5. Aufl. Reclam 2020. ISBN 978-3-15-019337-2. 16,80 Euro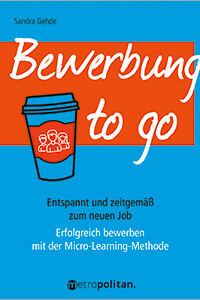 Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro
Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit einem Bewerbungsanschreiben zu beschäftigen, und die keine Lust haben, zu googeln, wie viele Leerzeilen zwischen Anschrift und Anrede stehen sollen. Denn für das perfekte Anschreiben reichen schon 15 Minuten, zeigt Sandra Gehde in ihrem neuen Buch. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro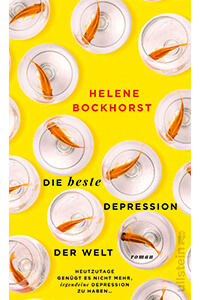 Der Roman „Die beste Depression der Welt“ bricht Tabus und handelt von einer Frau, die nach einem missglückten Suizidversuch mit ihrem Blog berühmt wird und nun einen Ratgeber zum Umgang mit Depressionen schreiben soll. Die Protagonistin Vera probiert alles aus, was gegen Depressionen helfen soll – und scheitert, scheitert, scheitert. Um sich wirklich besser zu fühlen, muss sie sich ihren eigenen Problemen stellen. Ein lehrreiches und gleichzeitig unterhaltsames Buch! Helene Bockhorst: Die beste Depression der Welt. Ullstein 2020. ISBN: 978-3-55020-076-2. 20 Euro
Der Roman „Die beste Depression der Welt“ bricht Tabus und handelt von einer Frau, die nach einem missglückten Suizidversuch mit ihrem Blog berühmt wird und nun einen Ratgeber zum Umgang mit Depressionen schreiben soll. Die Protagonistin Vera probiert alles aus, was gegen Depressionen helfen soll – und scheitert, scheitert, scheitert. Um sich wirklich besser zu fühlen, muss sie sich ihren eigenen Problemen stellen. Ein lehrreiches und gleichzeitig unterhaltsames Buch! Helene Bockhorst: Die beste Depression der Welt. Ullstein 2020. ISBN: 978-3-55020-076-2. 20 Euro


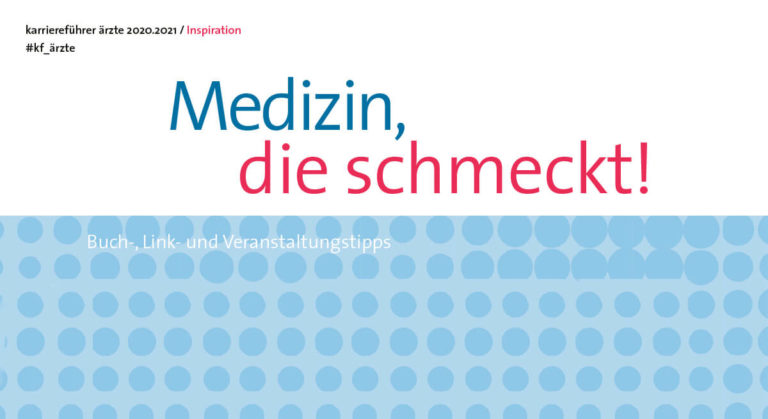







 Foto: AdobeStock/Picture P.
Foto: AdobeStock/Picture P.





