Digital Farming, auch Smart Farming genannt, hält Einzug bei den Landwirten. Andreas Schweikert, Referent Landwirtschaft beim Digitalverband Bitkom e.V., berichtet über Gegenwart und Zukunft der Landwirtschaft 4.0. Aufgezeichnet von Sabine Olschner
Unter Digital Farming versteht man den Einsatz von Technologien im Ackerbau, bei der Viehzucht und entlang der gesamten Wertschöpfungskette bei der Herstellung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das Ziel ist es, mit Hilfe der digitalen Technologien Ressourcen einzusparen, den Boden und die Umwelt zu schonen und auf spezielle Bedürfnisse von Äckern oder Nutztieren einzugehen. Bei den Erzeugern verbessert die Generierung und die Weitergabe von Daten den Verbraucherschutz. Insgesamt hat die Technik schon vor vielen Jahren Einzug in die Landwirtschaft gehalten – Landwirte gehören schon lange zu einer IT-affinen Gruppe. Hydraulische Anlagen, die Sammlung von Daten oder GPS-gesteuerte Traktoren sind nichts Besonderes mehr in der Landwirtschaft.
Das Neue an Landwirtschaft 4.0 ist: Alle Systeme und Daten werden nun über das sogenannte „Internet der Dinge“ miteinander vernetzt. So könnten zum Beispiel Traktoren mit künstlicher Intelligenz (KI) autonom vorher festgelegte Spuren auf dem Feld abfahren und jeden Quadratmeter eines Feldes individuell mit Pflanzenschutz behandeln, statt die Pestizide universal auf dem gesamten Feld aufzubringen. Ein Sensor könnte hierbei mit der Düse eines Gerätes zur Verteilung von Pflanzenschutz kommunizieren. Oder Tiere können mit Hilfe von KI früher und individueller gegen Krankheiten behandelt werden – ohne der gesamten Herde Antibiotika geben zu müssen. Precision Farming wird dieses individuelle Verfahren auch genannt.
Langsames Internet hemmt Digitalisierung
Auf dem Land mangelt es an leistungsfähigem Internet, was die Digitalisierung in der Landwirtschaft schwierig macht. 77 Prozent der Landwirte in Deutschland sind nach Ergebnissen des Konjunkturbarometers Agrar des Deutschen Bauernverbandes vom März 2018 mit ihrem Zugang zum Internet nicht zufrieden. Damit ist der Unmut über eine unzureichende Internetversorgung im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen. Die Versorgung mit schnellem Internet ist zwar mittlerweile etwas besser geworden, aber die digitalen Anwendungen erfordern immer höhere Internetleistungen, so dass sich die Zufriedenheitsquote insgesamt verschlechtert hat, berichtet der Deutsche Bauernverband.
Was das für Landwirte bedeutet? Sie müssen sich künftig noch mehr mit modernen Technologien auseinandersetzen. Schon heute sind Traktoren vollgepackt mit Technik, die über ein Terminal im Führerhaus gesteuert wird. Künftig werden alle Daten, die für den landwirtschaftlichen Betrieb wichtig sind, automatisch erfasst, sodass die Anwendungen noch nutzerfreundlicher werden. Die digitale Erfassung der Daten macht zum Beispiel die Programmierung der Gerätschaften oder auch die Antragstellung bei der EU einfacher.
Damit all dies gelingt, sind Ingenieure gefragt, die sich mit diesen neuen intelligenten Technologien befassen. Sie werden nach wie vor Traktoren, Häcksler und andere Hardware für Landwirte entwickeln – aber immer verbunden mit der Anwendung von Daten. Informatikthemen wie Datenerhebung und -auswertung werden in Zukunft auch Ingenieure betreffen: Die Ingenieurleistungen verschmelzen immer mehr mit Informationstechnologien. Und Ingenieure werden künftig mehr mit Sensorik zu tun haben, die die Vorgänge in einer Maschine erfasst. Dadurch bekommen sie zum Beispiel direktes Feedback, was in dieser Maschine funktioniert und was nicht.
Unser Branchenverband erwartet nicht, dass die landwirtschaftlichen Maschinen in Deutschland größer oder leistungsfähiger werden – hierzulande ist das Limit erreicht. In den USA oder in Osteuropa, wo die Felder weitaus größer sind als in Deutschland, ist hingegen noch Luft nach oben. Stattdessen werden Ingenieure die Maschinen für deutsche Landwirte smarter und intelligenter machen. Mögliche Arbeitgeber sind Hersteller von Landtechnik, aber auch IT-Unternehmen, die bisher wenig mit landwirtschaftlichen Themen zu tun hatten, darunter etwa Bosch, SAP, IBM oder T-Systems. Ingenieure werden immer mehr Kooperationen mit Informatikern eingehen, um Hardware und Informationssysteme zu verbinden. Sie werden also nicht darum herumkommen, sich künftig intensiver mit Daten und deren Möglichkeiten zu beschäftigen.
Neue Professur für „Digital Farming“
Um den Bedarf an Fachkräften für die Entwicklung der Landwirtschaft 4.0 Rechnung zu tragen, ruft die Technische Universität Kaiserslautern (TUK) eine Professur zum Digital Farming ins Leben. Ziel ist es, neue Techniken zu erforschen und diese anwendungsnah zu entwickeln. Dabei geht es beispielsweise darum, Daten zu verwalten und zu managen sowie landwirtschaftliche Abläufe mit Automationstechniken zu unterstützen. Neben der Leitung der Professur im Fachbereich Informatik beinhaltet die Aufgabe eine leitende Funktion am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE. Der Förderverein Digital Farming e.V. unterstützt die TUK finanziell bei der Einrichtung der neuen Professur. „Die hohen gesellschaftlichen und regulatorischen Anforderungen an eine moderne, europäische Landwirtschaft erfordern kontinuierlich neue Talente, Technologien und Geschäftsmodelle“, sagt Dr. Matthias Nachtmann, Vorsitzender des Fördervereins Digital Farming e.V. „Die Professur unterstützt Landwirte und Agrarindustrie dabei, die digitale Transformation erfolgreich mitzugestalten.“






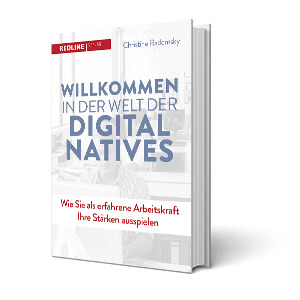



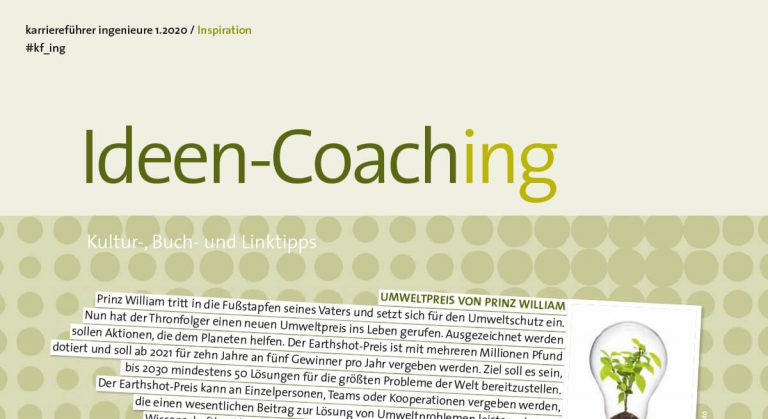

 Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel: Der klassische Schreibtischplatz im Büro nimmt an Bedeutung ab, das Arbeiten in Coworking Spaces steigt im Trend.: Ende 2019 haben knapp 2,2 Millionen Menschen in über 22.000 Coworking Spaces weltweit gearbeitet, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis des Global Coworking Survey 2019. In jedem neunten Coworking Space gab es mehr als 300 Mitglieder, vornehmlich in den Millionenstädten. Allerdings mindert der ebenfalls steigende Anteil von Coworking Spaces in mittelgroßen und kleinen Städten den Durchschnitt, weil hier deutlich weniger Mitglieder an einem Standort zusammenkommen. Robert Bukvic, Gründer verschiedener Startups und Internetunternehmen, beschreibt in seinem Buch „Die Coworking-Evolution“ die Zukunft der Arbeit.
Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel: Der klassische Schreibtischplatz im Büro nimmt an Bedeutung ab, das Arbeiten in Coworking Spaces steigt im Trend.: Ende 2019 haben knapp 2,2 Millionen Menschen in über 22.000 Coworking Spaces weltweit gearbeitet, 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis des Global Coworking Survey 2019. In jedem neunten Coworking Space gab es mehr als 300 Mitglieder, vornehmlich in den Millionenstädten. Allerdings mindert der ebenfalls steigende Anteil von Coworking Spaces in mittelgroßen und kleinen Städten den Durchschnitt, weil hier deutlich weniger Mitglieder an einem Standort zusammenkommen. Robert Bukvic, Gründer verschiedener Startups und Internetunternehmen, beschreibt in seinem Buch „Die Coworking-Evolution“ die Zukunft der Arbeit. 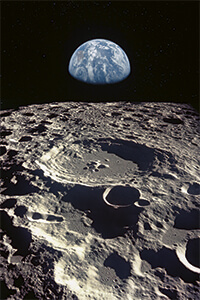
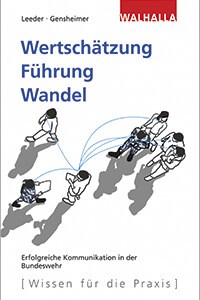 Die Bundeswehr strebt einen Wandel der Führungskultur an. Durch die Wertschätzung der Mitarbeiter soll die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber erhöht werden. Was verbirgt sich hinter wertschätzender Führung? Wie kann die Umsetzung im beruflichen Alltag stattfinden? Wie sieht das neue Führungsverständnis in der Bundeswehr aus? Wie verbindet es die unterschiedlichen Führungskulturen in den militärischen und den zivilen Geschäftsbereichen? Das erklären die Autorinnen des Kommunikations-Ratgebers. Sie verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie mit spezifischen Techniken und Methoden und kombinieren sie mit Beispielen aus dem beruflichen Alltag.
Die Bundeswehr strebt einen Wandel der Führungskultur an. Durch die Wertschätzung der Mitarbeiter soll die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeber erhöht werden. Was verbirgt sich hinter wertschätzender Führung? Wie kann die Umsetzung im beruflichen Alltag stattfinden? Wie sieht das neue Führungsverständnis in der Bundeswehr aus? Wie verbindet es die unterschiedlichen Führungskulturen in den militärischen und den zivilen Geschäftsbereichen? Das erklären die Autorinnen des Kommunikations-Ratgebers. Sie verbinden wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie mit spezifischen Techniken und Methoden und kombinieren sie mit Beispielen aus dem beruflichen Alltag. 






