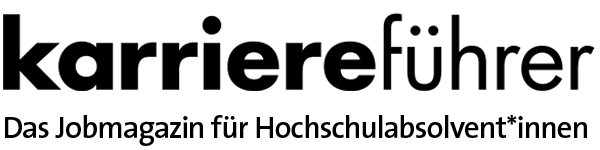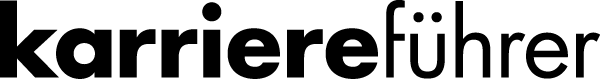Zusammen mit seinen Doktorvätern von der Universität Erlangen hat Dr. Daniel Teichmann die LOHC-Technologie mitentwickelt, mit der sich Wasserstoff als Energieträger so einfach handhaben lässt wie flüssiger Kraftstoff. Als Gründer und Geschäftsführer des Start-ups Hydrogenious LOHC Technologies führte der promovierte Wirtschaftsingenieur die Innovation in den Markt ein. Im Interview erzählt er, worauf es ankommt, wenn aus einer technischen Idee eine erfolgreiche Firma werden soll – und warum unternehmerische denkende Ingenieur*innen heute mehr denn je gefragt sind. Die Fragen stellte André Boße.
Zur Person
Daniel Teichmann studierte von 2004 bis 2009 Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Erlangen-Nürnberg. Während seiner Promotion entwickelte er zusammen mit seinen Doktorvätern eine Technologie zum Transport und der Lagerung von Wasserstoff. 2013 gründeten sie als Team die Hydrogenious Technologies GmbH, Daniel Teichmann leitet das Unternehmen seitdem als Geschäftsführer. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Wasserstoff- und Automobilindustrie und sammelte unternehmerische Erfahrung bei BMW, McKinsey und Leoni. Zudem ist er Erstautor zahlreicher grundlegender Publikationen über die LOHC-Technologie sowie Urheber umfangreicher technologiespezifischer Patente.
Herr Dr. Teichmann, wie funktioniert das Speichern von Wasserstoff mit dem LOHC-Prinzip?
Im Fokus des Konzepts steht der flüssige Wasserstoffträger, auf Englisch Liquid Organic Hydrogen Carrier, LOHC. Das ist ein Öl, in unserem Fall ein Thermalöl. Mit unserer Technologie gelingt es, den gasförmigen Wasserstoff durch einen chemischen Prozess an dieses Öl zu binden – also einzuspeichern. Ebenso ermöglicht unsere Technologie auch die Freisetzung des Wasserstoffs aus dem Öl, je nachdem, wo der Wasserstoff benötigt wird. Die Technologie sorgt dafür, Wasserstoff kosteneffizient zu transportieren – und zwar in der bestehenden Infrastruktur für flüssige Kraftstoffe.
Sie sind einer der Pioniere dieser Innovation. Wie verlief der Weg dorthin?
Alles begann mit meiner Doktorandenstelle im Bereich Wasserstoffspeicherung bei BMW. Ich konnte Prof. Wolfgang Arlt, den Direktor des damals neu gegründeten „Energiecampus Nürnberg“, sowie Prof. Peter Wasserscheid, Chemiker und Leibniz-Preisträger, als Doktorväter gewinnen. So entstand eine fruchtbare Kooperation zwischen BMW und der Universität Erlangen. Zum Ende meiner Promotion war mir sehr klar, dass die Energiewende sowie die Transformation hin zu einer erneuerbaren Energiewirtschaft kommen werden – und ich somit an einer vielversprechenden Zukunftstechnologie forsche. Aufgrund unternehmerischer Vorerfahrungen habe ich zudem mehr und mehr den Wunsch verspürt, mich selbst als Unternehmer zu betätigen. Dadurch kam es zum Entschluss, Hydrogenious zu gründen.
Ab wann waren Sie sich sicher: Was wir hier entwickeln, ist nicht nur eine gute Idee – sondern besitzt ein riesiges Potenzial?
Als Gründer glaubt man in der Regel vom Start weg an „seine“ Technologie und Geschäftsidee, sonst würde man das Risiko und die viele Arbeit vermutlich nicht auf sich nehmen. Ohne Zweifel war die erste erfolgreiche Einwerbung einer Finanzierung ein Meilenstein, rund eineinhalb Jahre nach der Gründung. Danach konnten wir die ersten fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und uns räumlich besser ausstatten. Letztlich ist es aber so, dass wir uns immer wieder neu beweisen müssen – aktuell sogar mehr als je zuvor.
Warum?
Die Transformation der Energiewirtschaft führt dazu, dass sich sehr viele etablierte Großkonzerne aus dem fossilen Zeitalter neu aufstellen – mit viel mehr Ressourcen als wir. Wir befinden uns heute also in einem ständigen Wettbewerb darum, wer welche Potenziale heben kann. Umso wichtiger sind die Meilensteine, die uns über die Zeit immer wieder darin bestärkt haben, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Dazu gehören zum Beispiel die Fördermittel der Bundes- und Landesregierungen, aber auch die Auszeichnung mit dem Innovationspreis der deutschen Wirtschaft oder die ersten Verkäufe von Anlagen in die USA und nach Finnland.
Was waren die größten Hürden, um aus der Idee auf dem Papier ein Unternehmen zu machen, das mit dieser Innovation in führender Position am Markt besteht?
Die Ausgangslage für ein junges Startup im Energieumfeld ist zunächst einmal aussichtsreich, da viel Interesse an neuen Lösungen besteht. Andererseits ist der Weg von der Idee zur echten Firma schon herausfordernd. Eine innovative Technologie zur Marktreife zu bringen und in konkrete Anlagenlösungen zu skalieren, in einem Markt, der sich selbst in einer vollständigen Transformations- und Neuentstehungsphase befindet – das ist schon eine Herausforderung. Wie so häufig ist der Anfang sicher am schwierigsten: Aus welchen Quellen kann man das Vorhaben finanzieren, wie findet man überhaupt Investoren? Auch in der Folge bleibt die Finanzierung der Firma eine stete Herausforderung für die Gründer. Alles in allem kann ich eine Unternehmensgründung aber jedem ans Herz legen, der unternehmerisch denkt und handelt. Es ist eine einmalige Erfahrung, seine eigene Firma Stück für Stück wachsen und sich entwickeln zu sehen. Und Erfahrungen, die man in dem Prozess sammelt, sind gigantisch und auch außerhalb des Start-ups wertvoll und begehrt.
Welche weiteren Skills waren in der Gründungsphase wichtig?
Die Gründungsphase ist nicht mit einer Handelsregistereintragung beendet, darüber muss man sich im Klaren sein. Letztlich dauert sie mehre Jahre an, in denen man als One-Man-Show oder als kleines Team auftritt. Daher gehört unbedingt kaufmännisches Know-how dazu, in einer Bandbreite von Finanzen bis Marketing. Schließlich musste ein Geschäftskonzept her, unsere Idee mussten wir immer wieder vor Investoren und anderen präsentieren. Hier hilft ein technischer Hintergrund natürlich. Insofern muss man als Gründer eigentlich eine Menge von fast allem machen – und genau darin liegt für mich ein Teil des Reizes dieses Karriereweges. Wobei sicherlich hilft, dass ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert und mich schon immer sowohl für technisch-naturwissenschaftliche Aspekte als auch für wirtschaftliche Fragestellungen interessiert habe
Die Folgekosten des Klimawandels sind bisher nicht adäquat eingepreist. Sobald dies der Fall ist, sind erneuerbare Energien und Wasserstoff absolut wettbewerbsfähig.
Ihr Ziel ist es, zu einem der zentralen Player einer globalen Wasserstoff- Infrastruktur zu werden. Wird Ihnen bei dieser großen Ambition manchmal ein wenig mulmig?
Meine Ambition und Motivation sind es, mit Hilfe von Wasserstoff die Energiewende möglich zu machen und den Ausstoß von CO2 im Bereich Mobilität und Industrieverbrauch langfristig auf Null zu reduzieren. Unserer LOHC-Technologie kann ein wichtiges Puzzleteil im zukünftigen erneuerbaren Energiesystem werden. Somit befinden wir uns auf einer Mission, die es wert ist, täglich für sie zu kämpfen und sich durch nichts einschüchtern zu lassen. Zu Beginn unserer Firmengründung war es nicht immer einfach, weil Wasserstoff noch nicht wirklich Teil der Diskussion war und wir daher häufig in fragende Gesichter geblickt haben. Mittlerweile aber gibt es ein sehr positives Umfeld in diesem Bereich.
Sie sagen, regenerativ hergestellter Wasserstoff sei das „Erdöl der Zukunft“. Was muss alles noch passieren, damit diese Prognose tatsächlich eintrifft?
Die deutsche Nationale Wasserstoffstrategie gibt die richtige Richtung vor. Aber die Vorhaben müssen in Gesetze gegossen werden, Regularien sind anzupassen. Zudem ist eine europaübergreifende Vorgehensweise wichtig. Das größte Problem sehen wir in den derzeit noch höheren Kosten grüner Technologien gegenüber den fossilen. Deswegen braucht es einen adäquat hohen CO2-Preis, um dadurch die Kostennachteile von Wasserstoff gegenüber fossilen Energien abzubauen. Zumal diese ja teilweise auf willkürlichen Subventionen oder der fehlenden Berücksichtigung gesellschaftlicher Kosten beruhen. Alles in allem sind die Folgekosten des Klimawandels bisher nicht adäquat eingepreist. Sobald dies der Fall ist, sind erneuerbare Energien und Wasserstoff absolut wettbewerbsfähig.
Der Zweck Ihres Unternehmens ist klar: Es geht darum, eine Infrastruktur für saubere Energie aufzubauen. Wenn Sie mit jungen Ingenieur*innen sprechen: Wie wichtig ist der jungen Generation diese Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit?
Diese Sinnstiftung ist von elementarer Bedeutung. Was großartig ist, weil die Energiewende nur zu schaffen ist, wenn möglichst viele junge Ingenieur* innen hier beruflich wirken wollen. Wir brauchen das Know-how und die Leidenschaft solcher top-qualifizierten Macher und Macherinnen.
Zum Unternehmen
Basierend auf der Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC)-Technologie mit Benzyltoluol als Trägermedium ermöglicht Hydrogenious eine flexible Wasserstoffversorgung von Verbrauchern in Industrie und Mobilität, die anderen nicht-leitungsgebundenen Wasserstofftransporttechnologien überlegen ist – vor allem, weil sie konventionelle Infrastruktur für Flüssigbrennstoffe nutzt. Das in Erlangen ansässige Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten wurde mit dem „Innovationspreis der deutschen Wirtschaft“ ausgezeichnet, ist seit 2018 unter den „Global Cleantech 100“ platziert und zählte beim „Deutschen Gründerpreis“ 2021 zu den drei Finalisten.