Mittendrin in der digitalen Ära: Die Masse an Daten überfordert die Unternehmen, die Menschen verlangen hinsichtlich der künstlichen Intelligenz Ethik und Moral. Und es werden Fragen aufgeworfen: Was stellen wir mit künstlicher Intelligenz an? Und wie arbeiten wir mit ihr zusammen? Ein Blick auf die digitale Welt von heute, die sich jetzt dem stellen muss, was morgen kommt. Von André Boße
Dark Data – das klingt nach Informationen aus einer gefährlichen Schattenwelt, nach Unheil und Verbrechen. Doch haben diese dunklen Daten nichts mit dem Darknet zu tun: Als Dark Data bezeichnet man Daten, die Unternehmen helfen könnten, ihr Geschäft zu optimieren. Doch entweder wissen die Unternehmen nichts von deren Existenz, oder sie sind schlicht nicht in der Lage, diese Daten zu bergen, zu sichten, zu verarbeiten. Daher bleiben diese relevanten Informationen im Düsteren verborgen: Dark Data – eine verpasste Chance.
Dark Data: ungenutztes Potenzial
Der Daten-Dienstleister Splunk, ansässig im Silicon Valley bei San Francisco, hat Ende April die Ergebnisse einer Studie zum Thema Dark Data veröffentlicht. Die Autoren der Studie befragten dafür weltweit 1300 Verantwortliche in Unternehmen und kommen zu dem Schluss, dass den Führungskräften sehr wohl bewusst ist, dass die Nutzung aller vorhandenen Daten wertschöpfend ist. „Allerdings handelt es sich bei mehr als der Hälfte (55 Prozent) der gesamten Daten eines Unternehmens um Dark Data, von deren Existenz die Unternehmen entweder gar nichts wissen oder bei denen sie sich im Unklaren darüber sind, wie sie sie finden, aufbereiten, analysieren oder nutzen können.“
Die Unternehmen wissen, wie wichtig Daten sind. Sie wissen aber auch, dass sie längst nicht alle für ihre Organisation wichtigen Daten nutzen können.
76 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass sich im Wettbewerb „das Unternehmen mit der höchsten Datennutzung durchsetzen wird“. Sprich: Daten entscheiden über den geschäftlichen Erfolg. Andererseits gaben 60 Prozent der Befragten an, dass mehr als die Hälfte der Unternehmensdaten Dark Data sind, laut einem Drittel der Befragten sind sogar mehr als 75 Prozent der Unternehmensdaten Dark Data. Das Ergebnis ist bemerkenswert, weil es zeigt: Die Unternehmen wissen, wie wichtig Daten sind. Sie wissen aber auch, dass sie längst nicht alle für ihre Organisation wichtigen Daten nutzen können. Warum diese Schere? Auch hier gibt die Studie Auskunft: Nach den Gründen gefragt, weshalb so viele Daten im Dunkeln bleiben, nannten die meisten Befragten die schiere Masse der Daten, gefolgt von den Aspekten, dass in den Unternehmen das Know-how und die Ressourcen fehlen, um die Daten zu verarbeiten.
Daten-Experten helfen Unternehmen
Tim Tully ist Chief Digital Officer (CTO) bei Splunk und bringt Verständnis für diese Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis auf: „Es ist schwer, mit Daten zu arbeiten, weil das Volumen mit alarmierender Geschwindigkeit anwächst und das Strukturieren und Organisieren sich daher schwierig gestaltet. Daher fühlen sich Unternehmen in dieser chaotischen Landschaft leicht hilflos.“ Aus dem Ergebnis der Studie ergebe sich seiner Meinung nach eine große Chance für Data-Talente: „Motivierte Führungskräfte und Fachleute können die Ergebnisse ihres Arbeitgebers durch die Aneignung neuer Kompetenzen auf ein neues Niveau heben“, sagt Tully.
Keine Führungskraft älteren Semesters darf erwarten, dass junge Menschen das nötige Data-Know-how von sich aus mitbringen, nur weil sie einer anderen Generation angehören.
Interessant ist dabei eine weitere Zahl aus der Studie: Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie sie sich für zu alt halte, um selbst neue Datenkompetenz zu erwerben. Gefragt ist folglich also die junge Generation: Von ihr erhoffen sich die Unternehmen, dass sie genügend Kompetenz mitbringt, um die Daten vom Dunkeln ins Helle zu bringen – um sie also nutzbar zu machen, damit die Unternehmen im Wettbewerb bestehen. Da dieses Know-how im Bereich Daten hochspeziell ist, sollten junge Talente darauf pochen, sich das Wissen mit Hilfe von Fort- und Weiterbildungen, aber auch durch die Teilnahme an Workshops oder Konferenzen anzueignen: Keine Führungskraft älteren Semesters darf erwarten, dass junge Menschen das nötige Data-Know-how von sich aus mitbringen, nur weil sie einer anderen Generation angehören.
Yogeshwar für „reflektierten Fortschritt“
Doch das Geschäft mit Daten besitzt nicht nur eine ökonomische Dimension: Wer an Big Data und die Nutzung der Informationen denkt, darf die Verantwortung nicht außen vorlassen. Je mehr offensichtlich wird, wie viele Geschäftsmodelle sich aus Mengen an Daten ableiten lassen, desto lauter werden Stimmen, die fordern, auch aus ethischer Sicht über diese Neugestaltung der Geschäftswelt nachzudenken. Eine dieser kriti-schen Stimmen ist Deutschlands bekanntester Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, von Hause aus ohne Zweifel ein Verfechter des Fortschritts und glühender Bewunderer von neuen Techniken, die helfen können, das Leben auf der Erde zu verbessern und die Welt mit Blick auf den Klimawandel vor weiteren Schäden zu schützen.
Trendstudie: Vier Thesen, wie KI die Welt verändert
Die Trendstudie des Zukunftsinstituts zur künstlichen Intelligenz nennt vier Thesen für einen von der KI angetriebenen Wandel. Erstens habe Europa die Chance, sich durch eine vernünftige KI-Ethik global von der Konkurrenz in den USA und China nachhaltig abzusetzen. Zweitens stehe KI für eine neue Business-Intelligenz, die verborgene Muster sichtbar macht und eine hyperpersonalisierte Kundenansprache ermöglicht. Drittens werde das Teamplay aus Mensch und Maschine die Unternehmenskulturen prägen und neu definieren. Viertens biete KI das Potenzial, eine bessere Gesellschaft zu gestalten, wobei die Unternehmen und ihre Mitarbeiter die Chance haben, selbst als nachhaltige Player aufzutreten.
www.zukunftsinstitut.de
Bei einer Gastvorlesung im Rahmen der SWR Mediendozentur an der Uni Tübingen Mitte Mai 2019 warnte er aber auch davor, eine ungebremste Weiterentwicklung der Themen Big Data und Künstliche Intelligenz sei in der Lage, die solidarische „Wir-Gesellschaft“ in Frage zu stellen: Schon heute, dozierte Yogeshwar, sei es erkennbar, dass Smartphones regelmäßig Daten über ihre Nutzer sammeln. Keiner wisse, wofür sie das genau tun. Aber natürlich habe man eine Ahnung. Was aber, wenn Internetkonzerne wie Google oder Amazon als „Großdatenbesitzer“ nun auf die Idee kommen, in das Geschäft mit dem Verkauf von Krankenversicherungspolicen einzusteigen? Daten über den Lebenswandel ihrer Kunden und Nutzer besitzen sie schließlich genug – mit der Folge, dass sie für die Fitten günstige Tarife anbieten könnten. Aber was wird dann aus den Hilfebedürftigen und chronisch Kranken, die vom solidarischen Prinzip gestützt werden?
Für Yogeshwar gefährden solche Szenarien die Demokratie, und immer dann, wenn eine solche Gefährdung erkennbar sei, müsse der Staat einschreiten und Regeln setzen. Einen „reflektierten Fortschritt“ nennt der Wissenschaftsjournalist sein Konzept: Neue Technik ja – aber nie blauäugig und ohne Blick auf mögliche Gefahren für die Gesellschaft.
Kommt der „Homo digitalis“?
Was die Gefahr betrifft, steht besonders ein digitales Thema im Fokus: die Künstliche Intelligenz. Die Zahl der Romane, die sich mit von einer KI verursachten Horrorszenarien beschäftigen, steigt und steigt, der Sachbuchmarkt zieht nach, häufig sind die Cover schwarz und die Botschaften beunruhigend. Toby Walsh, KI-Forscher an der Uni Sydney, hat sogar das Jahr errechnet, in dem es soweit sein werde, dass die künstliche Intelligenz uns Menschen ebenbürtig sein wird: 2062 werde es soweit sein, prognostiziert er. Dann beginne das Zeitalter, in dem wir als „verstehende Menschen“ (Homo sapiens) Schritt für Schritt den Raum freigeben, wie es vor uns schon die Neandertaler getan haben. „Unseren Platz wird der Homo digitalis einnehmen – die Weiterentwicklung der Familie Homo zu einer digitalen Form“, schreibt Walsh in seinem Buch. „Was wir tun und wie wir es tun, wird zunehmend und in einigen Fällen ausschließlich digital werden. Das menschliche Denken wird durch digitales Denken ersetzt werden. Und die menschliche Aktivität in der realen Welt wird durch digitale Aktivität in künstlichen und virtuellen Welten ersetzt werden. Das ist unsere künstlich intelligente Zukunft.“
Angebracht ist es, weder in einer Utopie noch einer Dystopie zu denken, sondern hier und jetzt den Wandel zu gestalten. Denn das ist und bleibt ein Fakt: Wir Menschen sind es, die diese Prozesse steuern.
Wie aber sieht die Gegenwart aus? Antworten gibt eine neue Trendstudie des Zukunftsinstituts, die sich unter dem Titel „Künstliche Intelligenz“ damit beschäftigt, wie sich diese Zukunftstechnologie schon heute produktiv nutzen lässt. Basis der Überlegungen der Autoren ist dabei die Annahme, die Künstliche Intelligenz sei derzeit der stärkste Treiber des Wandels: „Kognitive Maschinen schaffen eine neue Realität, in der wir zunehmend von Technologie beobachtet werden und mit ihr interagieren.“ Wobei die Ausmaße dieser Veränderung sowohl übersteigerte Erwartungen als auch Ängste nährten – was dazu führe, dass der Blick nicht klar auf die Themen gerichtet sei, die heute eigentlich auf der Agenda stehen müssten. Damit warnen die Autoren vom Zukunftsinstitut davor, sich heute zu sehr mit dem zu beschäftigen, was am Endpunkt der Transformation stehen könnte. Angebracht ist es, weder in einer Utopie noch einer Dystopie zu denken, sondern hier und jetzt den Wandel zu gestalten. Denn das ist und bleibt ein Fakt: Wir Menschen sind es, die diese Prozesse steuern.
Keine Buzzwords mehr, sondern schauen: Was geht?
Wie Unternehmen genau dies gelingt, erklärt die Trendstudie anhand einer kritisch-konstruktiven Perspektive, die dem von Ranga Yogeshwar geforderten „reflektierten Fortschritt“ ähnelt: Der Schlüssel liege in einem neuen, aufgeklärten Bewusstsein sowie einer zukunftsmutigen Haltung für die praktische Anwendung. „Entscheidend ist eine doppelte Optik: auf der einen Seite ein weiter, ganzheitlich-systemischer Blick auf das Big Picture des digitalen Wandels, dem KI einen völlig neuen Schub verleiht. Auf der anderen Seite eine mikroskopische Nahsicht auf die konkreten Potenziale, praktischen Anwendungsmöglichkeiten und unternehmenskulturellen Konsequenzen, die der Einsatz von KI mit sich bringt.“ Erst so entstehe in Unternehmen ein realistisches Verständnis dafür, was KI tatsächlich ist und kann – und welche KI-basierten Geschäftsmodelle tatsächlich sinnvoll sind. Kurz gesagt: KI muss endlich konkret werden. Denn: „Auf Unternehmensebene bedeutet ein konstruktiver Einsatz von KI vor allem: Abschied vom ‚Buzzword Talk’ und Hinwendung zu der Frage, was KI in organisationalen Kontexten konkret leisten kann – von automatisierten Prozessen und erhöhter Effizienz bis zu verbesserten Prognosen und hyperpersonalisierten Produkten und Services.“ Unternehmen müssten sich nur zwei Fragen stellen: Welche Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz gibt es? Und was macht bei uns wo Sinn? Denn zwar sei KI kein Werkzeug im herkömmlichen Sinn, aber doch weiterhin ein „Tool“, also ein Mittel zum Zweck – und damit die mögliche Lösung für ein konkretes Problem.
Mensch-Maschine-Umwelt entsteht
Verliert ein Unternehmen zu viel Zeit bei bestimmten Prozessen, die automatisierbar sind? Hier kann die KI die Lösung sein. Liegt ein neues Geschäftsfeld auf der Hand, weil die Nachfrage zu erkennen ist – fehlt es aber noch an einer Idee, das nötige Wissen dafür zu generieren? Auch hier kann die KI helfen. Hat sich ein Unternehmen für das „Tool“ KI entscheiden, muss es sich direkt einer Folgefrage stellen: Wie sollen die Mitarbeiter mit der intelligenten Maschine zusammenarbeiten? „In den Fokus rückt dabei das Thema Human Computation“, heißt es in der Trendstudie des Zukunftsinstituts. Es stelle sich die Frage, wie ein kooperatives Miteinander von Mensch und Maschine aussieht. „KI wird die menschliche Intelligenz nicht ersetzen. Aber sie kann sie komplementär und kreativ erweitern, etwa im Rahmen nichtautonomer Systeme, in denen Maschinen unterstützen, aber der Mensch final entscheidet.“ Diese Neugestaltung von Arbeit hin zu diesen „Mensch-plus-Maschine- Umwelten“ ermögliche und erfordere auch ein „Upgrade der menschlichen Intelligenz und Empathie“, wie die Studienautoren schreiben.
Die Zukunft der Arbeit? Das bin ich!
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bietet auf ihrer Homepage eine Micro-Site, die sich mit der Zukunft der Arbeit im Zeitalter der digitalen Transformation beschäftigt. Grafiken geben einen Einblick in Branchen und Berufsfelder, die besonders von der Automatisierung betroffen sind. Unter dem Motto „I am the Future of Work“ erzählen junge Talente aus Europa, was sie sich vom Wandel erhoffen und was sie befürchten. Zudem stehen auf der Micro-Site Studien zur Verfügung, in denen die Zukunft der Arbeit in der digitalen Ära beleuchtet wird. www.oecd.org/berlin/themen/zukunft-der-arbeit
Wenn man so will, gibt es neben der emotionalen Intelligenz – die schon heute ein bedeutsamer Soft Skill ist – die Notwendigkeit einer Mensch-Maschine-Intelligenz: Die Mitarbeiter müssen in der Lage sei, Verständnis für die Intelligenz der neuen KI-Kollegen zu erlangen sowie zu jeder Zeit erkennen können: Was kann diese Intelligenz leisten – und was nicht? Und wie kann die Maschine mir zuarbeiten, damit ich auf Basis ihrer intelligenten Arbeit noch kreativer sein kann, weil bislang blockierende Arbeitsschritte wegfallen?
Mehr denn je: Aufs Verstehen kommt es an
Toby Walsh sieht die Ära des „Homo digitalis“ kommen, aber vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll, das Digitale so direkt an den Menschen anzudocken. Vielleicht ist es klüger, gerade jetzt Homo sapiens zu bleiben, also ein „verstehender Mensch“, der sich reflektiert und mit ethischem Background die Chancen nutzt, die eine künstliche Intelligenz uns bietet. Dazu gehört es für Unternehmen auch, Grenzen anzuerkennen für das, was erlaubt ist und was nicht. KI und Big Data sind für die Wirtschaft kein Freifahrtschein, um sich in Zukunft alles zu erlauben, nur weil es möglich ist. Gesucht werden daher auch in den Unternehmen Talente, die Chancen und Risiken erkennen. Die verstehen, dass die digitale Transformation ab jetzt nicht mehr ohne Ethik auskommt. Und die erkennen, dass alle digitalen Tools auch weiterhin einen Aus-Schalter besitzen.
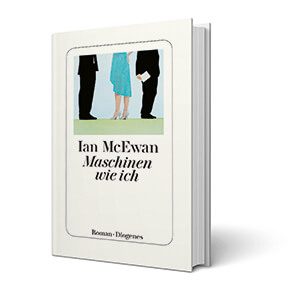 Buchtipp
Buchtipp
Ian McEwan, „Maschinen wie ich“ Wer genug von den Sachbüchern zum Thema Künstliche Intelligenz hat und auch der Thriller-Apokalypse von Frank Schätzings KI-Buch „Die Tyrannei des Schmetterlings“ wenig abgewinnen kann, sollte Ian McEwan eine Chance geben: Der britische Erfolgsautor hat mit „Maschinen wie ich“ einen Roman geschrieben, der zeigt, wie sich unsere Welt der Beziehungen verändern wird, wenn eine dritte Instanz in unser Leben kommt. Die heißt in diesem Buch Adam, ist ein Android – und bringt das frischverliebte Pärchen Miranda und Charlie in ethisch-moralische Konfliktsituationen, die auf uns zukommen werden. Ian McEwan: „Maschinen wie ich“. Diogenes 2019, 25 Euro (Amazon-Werbelink)
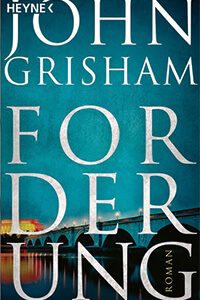 Sie wollten die Welt verändern, als sie ihr Jurastudium aufnahmen. Doch jetzt stehen Zola, Todd und Mark kurz vor dem Examen und müssen sich eingestehen, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Die private Hochschule, an der sie studieren, bietet eine derart mittelmäßige Ausbildung, dass die drei das Examen nicht schaffen werden. Doch ohne Abschluss wird es schwierig sein, einen gut bezahlten Job zu finden. Und ohne Job werden sie die Schulden, die sich für die Zahlung der horrenden Studiengebühren angehäuft haben, nicht begleichen können. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nicht nur dem Schuldenberg zu entkommen, sondern auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein geniales Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf – von keinem geringeren als John Grisham entworfen. John Grisham: Forderung. Heyne 2019, 10,99 Euro.
Sie wollten die Welt verändern, als sie ihr Jurastudium aufnahmen. Doch jetzt stehen Zola, Todd und Mark kurz vor dem Examen und müssen sich eingestehen, dass sie einem Betrug aufgesessen sind. Die private Hochschule, an der sie studieren, bietet eine derart mittelmäßige Ausbildung, dass die drei das Examen nicht schaffen werden. Doch ohne Abschluss wird es schwierig sein, einen gut bezahlten Job zu finden. Und ohne Job werden sie die Schulden, die sich für die Zahlung der horrenden Studiengebühren angehäuft haben, nicht begleichen können. Aber vielleicht gibt es einen Ausweg. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, nicht nur dem Schuldenberg zu entkommen, sondern auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Ein geniales Katz- und Mausspiel nimmt seinen Lauf – von keinem geringeren als John Grisham entworfen. John Grisham: Forderung. Heyne 2019, 10,99 Euro.
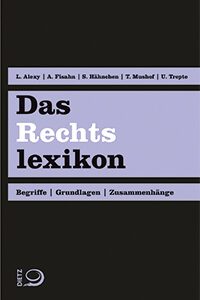 „Kompetenz im handlichen Format.“ Nichts Geringeres verspricht das Rechtslexikon zu sein. Erklärt werden darin wichtige Begriffe, Normen und Grundsätze, vor allem des deutschen und europäischen Rechts, knapp, zuverlässig, verständlich und auf dem aktuellen Stand. Grundlegende Fragen und Zusammenhänge werden in besonderen Überblicksartikeln erläutert. Querverweise machen auf verwandte Themen im Lexikon aufmerksam. Lennart Alexy, Andreas Fisahn, Susanne Hähnchen, Tobias Mushoff, Uwe Trepte: Das Rechtslexikon. Dietz 2019, 22 Euro.
„Kompetenz im handlichen Format.“ Nichts Geringeres verspricht das Rechtslexikon zu sein. Erklärt werden darin wichtige Begriffe, Normen und Grundsätze, vor allem des deutschen und europäischen Rechts, knapp, zuverlässig, verständlich und auf dem aktuellen Stand. Grundlegende Fragen und Zusammenhänge werden in besonderen Überblicksartikeln erläutert. Querverweise machen auf verwandte Themen im Lexikon aufmerksam. Lennart Alexy, Andreas Fisahn, Susanne Hähnchen, Tobias Mushoff, Uwe Trepte: Das Rechtslexikon. Dietz 2019, 22 Euro.
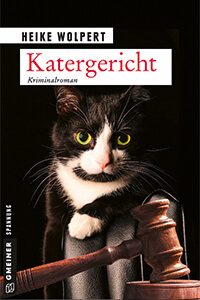 Zwei Todesfälle in zwei Tagen. Suizid oder Mord? Die Toten, ein verurteilter Mörder und sein Anwalt, hatten schon von Berufs wegen nicht nur Freunde. Bei den Ermittlungen kommt Kommissar Flott immer wieder sein Kater in die Quere. Die neugierige Spürnase hat ihre ganz eigenen Methoden und Motive, Nachforschungen anzustellen. Heike Wolpert: Katergericht. Gmeiner 2019, 12 Euro.
Zwei Todesfälle in zwei Tagen. Suizid oder Mord? Die Toten, ein verurteilter Mörder und sein Anwalt, hatten schon von Berufs wegen nicht nur Freunde. Bei den Ermittlungen kommt Kommissar Flott immer wieder sein Kater in die Quere. Die neugierige Spürnase hat ihre ganz eigenen Methoden und Motive, Nachforschungen anzustellen. Heike Wolpert: Katergericht. Gmeiner 2019, 12 Euro.
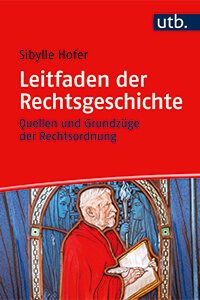 Der von Sibylle Hofer, Ordinaria für Rechtsgeschichte und Privatrecht am Institut für Rechtsgeschichte der Universität Bern, erstellte Leitfaden stellt zentrale Rechtstexte aus der Zeit vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts vor, wobei in geographischer Hinsicht ein Schwerpunkt auf dem Gebiet der heutigen Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt. Diese Quellen bilden gleichzeitig die Basis für eine Gliederung der Rechtsgeschichte in Epochen. Für die einzelnen Epochen werden sodann Grundzüge der Rechtsordnung aufgezeigt. Dies geschieht an Hand von drei Aspekten: Die Möglichkeit von Privatpersonen, Verträge oder Eigentumsverfügungen vornehmen zu können; das Gerichtswesen sowie die Verfolgung von Straftaten. Bei der Ausgestaltung dieser Themenbereiche kommt die Ausbildung staatlicher Strukturen bzw. das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern zum Ausdruck. Sibylle Hofer: Leitfaden der Rechtsgeschichte. Utb 2019, 29,99 Euro.
Der von Sibylle Hofer, Ordinaria für Rechtsgeschichte und Privatrecht am Institut für Rechtsgeschichte der Universität Bern, erstellte Leitfaden stellt zentrale Rechtstexte aus der Zeit vom 5. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts vor, wobei in geographischer Hinsicht ein Schwerpunkt auf dem Gebiet der heutigen Länder Deutschland, Österreich und der Schweiz liegt. Diese Quellen bilden gleichzeitig die Basis für eine Gliederung der Rechtsgeschichte in Epochen. Für die einzelnen Epochen werden sodann Grundzüge der Rechtsordnung aufgezeigt. Dies geschieht an Hand von drei Aspekten: Die Möglichkeit von Privatpersonen, Verträge oder Eigentumsverfügungen vornehmen zu können; das Gerichtswesen sowie die Verfolgung von Straftaten. Bei der Ausgestaltung dieser Themenbereiche kommt die Ausbildung staatlicher Strukturen bzw. das Verhältnis zwischen Staat und Bürgern zum Ausdruck. Sibylle Hofer: Leitfaden der Rechtsgeschichte. Utb 2019, 29,99 Euro.
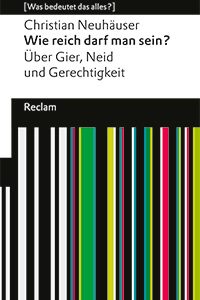 Christian Neuhäuser ist Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund; er beschäftigt sich vor allem mit Theorien der Würde und Verantwortlichkeit sowie der Philosophie der Ökonomie und der internationalen Beziehungen. Sein aktuelles Buch trägt den Titel: Wie reich darf man sein? Untertitel: Über Gier, Neid und Gerechtigkeit [Was bedeutet das alles?]. Der Band erhellt das Phänomen „Reichtum“ und gibt präzise Antworten auf die Fragen: Was ist Reichtum und wer gilt überhaupt als reich (oder superreich)? Ist Reichtum immer ungerecht? Spielen bei Kritik am Reichtum stets Gier und Neid eine Rolle? Und wie könnte ein gerechterer Umgang mit Reichtum aussehen? Christian Neuhäuser: Wie reich darf man sein? Reclam 2019, 6 Euro.
Christian Neuhäuser ist Professor für Praktische Philosophie an der TU Dortmund; er beschäftigt sich vor allem mit Theorien der Würde und Verantwortlichkeit sowie der Philosophie der Ökonomie und der internationalen Beziehungen. Sein aktuelles Buch trägt den Titel: Wie reich darf man sein? Untertitel: Über Gier, Neid und Gerechtigkeit [Was bedeutet das alles?]. Der Band erhellt das Phänomen „Reichtum“ und gibt präzise Antworten auf die Fragen: Was ist Reichtum und wer gilt überhaupt als reich (oder superreich)? Ist Reichtum immer ungerecht? Spielen bei Kritik am Reichtum stets Gier und Neid eine Rolle? Und wie könnte ein gerechterer Umgang mit Reichtum aussehen? Christian Neuhäuser: Wie reich darf man sein? Reclam 2019, 6 Euro. 



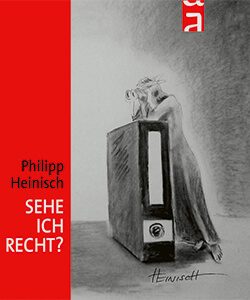


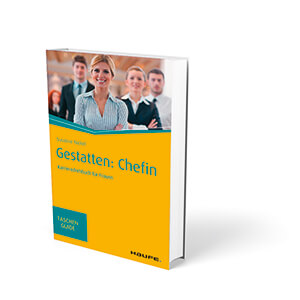 sanne Nickel:
Gestatten: Chefin.
Haufe 2019, 9,95 Euro.
sanne Nickel:
Gestatten: Chefin.
Haufe 2019, 9,95 Euro.







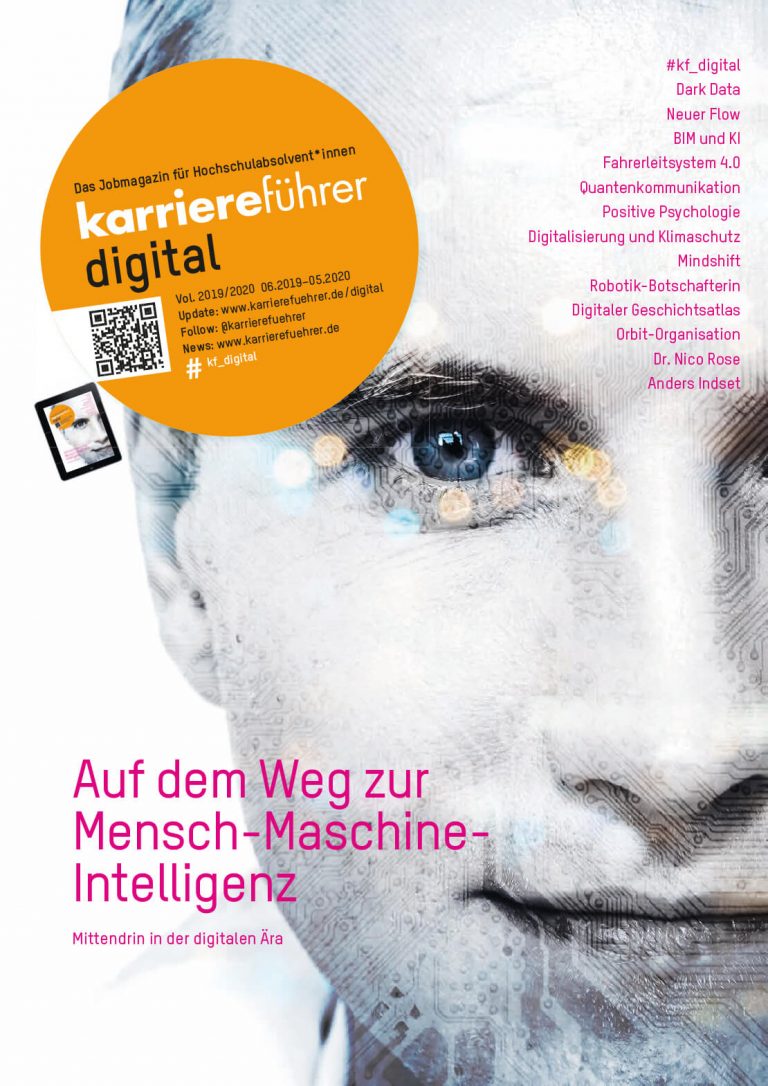
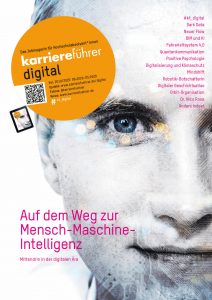

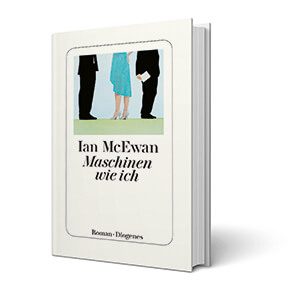 Buchtipp
Buchtipp
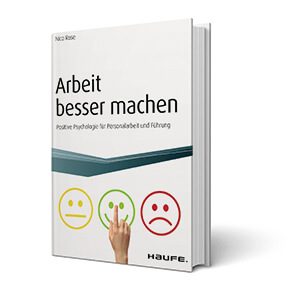 „Arbeit besser machen“
„Arbeit besser machen“