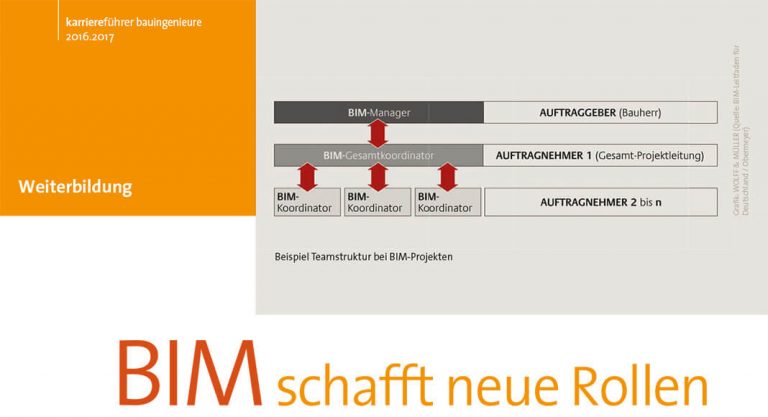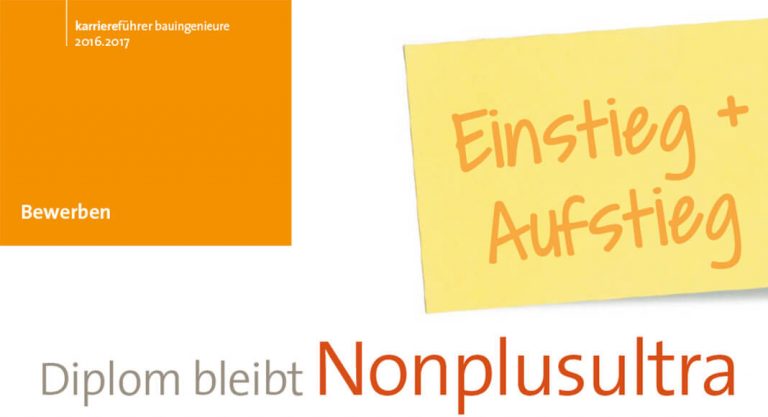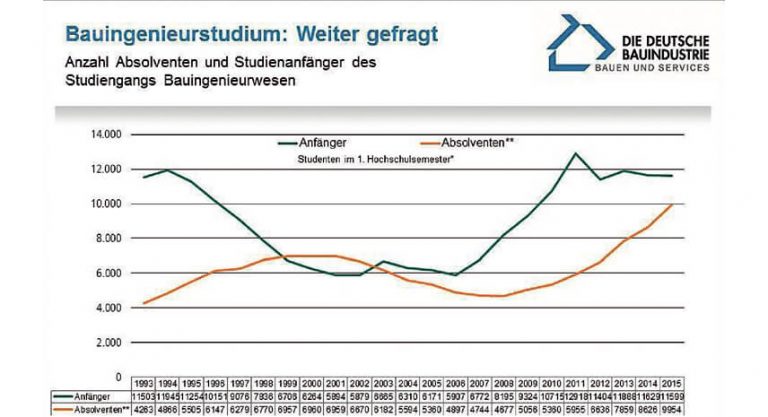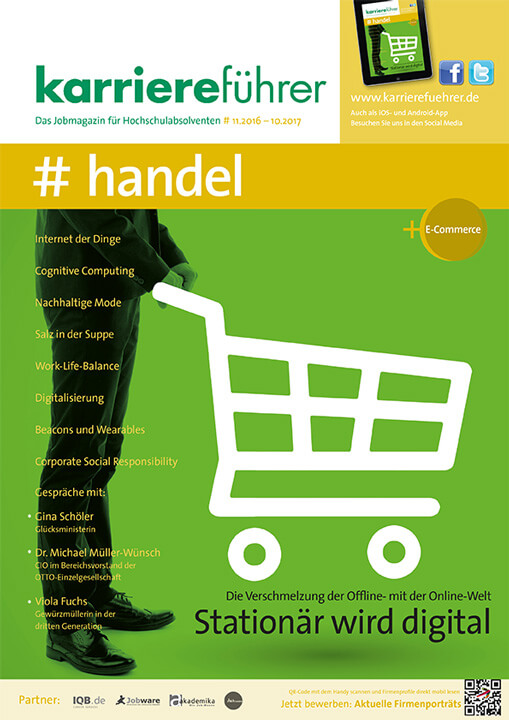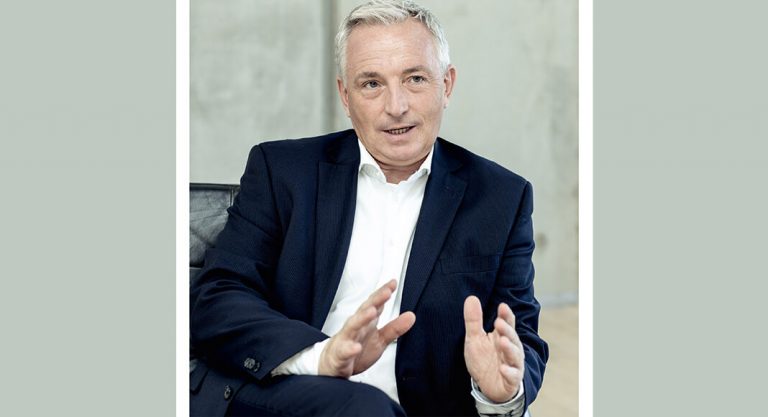Über 50 Jahre präsentierte die Stuttgarter Messe auf dem Killesberg Waren aus aller Welt – bis 2007. Dann bezog sie ein neues Gelände. Damit begann ein in seiner Größenordnung einzigartiges Projekt in Deutschland: der Rückbau der alten Messehallen. Und die Entstehung eines neuen Stadtquartiers. Dieses ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie mit Neunutzungen dem Wohnungsmangel in Deutschland begegnet werden kann. Von Steffen Ruoff, Dipl.-Bauingenieur und Leiter Bauwerksanierung und Rückbau bei Arcadis
Heute befindet sich auf dem Killesberg ein Stadtteilzentrum mit Wohnungen, Nahversorgern, Handels- und Büroflächen, gastronomischen Einrichtungen, Kindertagesstätten, einem Ärztehaus sowie einer direkten U-Bahn- und Bus-Anbindung. Ebenso gibt es einen hohen Anteil an öffentlichem Freiraum. Täglich wird das Stadtquartier von rund 6.000 Menschen frequentiert. Doch um an diesen Punkt zu kommen, musste zunächst das 7,5 Hektar große Messegelände vorbereitet werden: Nach dem Wegzug der Messe standen auf dem Gelände 13 Hallen unterschiedlicher Größe sowie das Messe- und Congress-Centrum.
Arcadis erhielt den Zuschlag für die Planung, Vorbereitung, Ausschreibung und Überwachung des Rückbauprojektes. Damit standen die Bauingenieure vor der Aufgabe, insgesamt 800.000 Kubikmeter umbauter Fläche abzutragen, von Schadstoffen zu befreien sowie das Baumaterial zu verwerten beziehungsweise zu entsorgen. Zwei Jahre waren für diese Aufgaben vorgesehen – inklusive öffentlicher Ausschreibungen und der Auftragsvergabe an die Unternehmen.
Daten und Fakten
Standort: Stuttgart-Killesberg
Projekt: Rückbau und BaureifmachungDimensionen Rückbau
Fläche: 7,5 Hektar
Abriss von 800.000 Kubikmetern umbauter FlächeDimensionen Schadstoffsanierung/ Entsorgung
- 50 Tonnen Asbest
- 500 Tonnen künstlicher Mineralfasern
- 20.000 Tonnen Bauschutt
- 10.000 Tonnen Schrott/Metall
- 220.000 Tonnen Baumaterialien wurden für den Wiederaufbau verwendet
Das Projekt in Phasen
- Bausubstanz- und Gebäudeschadstofferkundung
- Planung und Ausschreibung
- Bauüberwachung
- Sicherheits- und Gesundheitskoordination
- Umwelttechnische Fachbauüberwachung
- Bewertung des Stadtquartiers nach DGNB-Kriterien der Pilotphase „Nachhaltige Stadtquartiere“
Bereits bei der ersten Begehung des Geländes wurde festgestellt, dass in den Gebäuden reichlich Asbest verbaut worden war. Dieser musste aufwändig entsorgt werden. Bei von den Bauingenieuren des Unternehmensdurchgeführten Kernbohrungen wurden im Labor darüber hinaus noch weitere schadstoffverdächtige Materialiengefunden. Eine solch detaillierte Bestandsaufnahme ist jedoch notwendig, um für die Ausschreibung der Stadt einen genauen Kriterienkatalog zu erstellen, den die Abbruch- und Entsorgungsunternehmen zu erfüllen haben.
Schadstofferkennung und Recycling
Nach den umfassenden Vorbereitungen konnte dann die eigentliche Projektphase beginnen: Die Messehallen, das Messe- und Congress-Centrum sowie die Straßen auf dem Messegelände wurden abgerissen beziehungsweise zurückgebaut. Als besondere Herausforderung erwiesen sich dabei die Höhenunterschiede von bis zu 22 Metern, die mit Maschinen und Geräten auf dem Gelände überwunden werden mussten. Die Geländekanten wiesen einen Höhenunterschied von bis zu zehn Metern auf.
Auch die Mengen an Bauschutt waren gigantisch. Alleine 50 Tonnen asbesthaltige Materialienkamen zusammen, zudem 500 Tonnen künstliche Mineralfasern, die fachgerecht ausgebaut und entsorgt werden mussten. An teerhaltigen Gebäudematerialienfielen rund 3.000 Tonnen an. Verbundmaterialien wurden darüber hinaus in arbeitsintensiven Prozessen getrennt, um Entsorgungskosten zu sparen. So wurden in erheblichem Umfang teer- und bitumenhaltige Schichten von Betondecken abgefräst.
Nicht schadstoffhaltiges Baumaterial wurde von dem belasteten getrennt und konsequent wiederverwertet. Rund 220.000 Tonnen wurden vor Ort für den Wiederaufbau aufbereitet und für die Profilierung und die Nachnutzung des Geländes eingesetzt. Das schonte nicht nur das Budget, sondern auch die Ressourcen. Trotzdem wurden noch rund 200.000 Kubikmeter Beton und anderes Verfüllungsmaterial aus anderen Baustellen zum Aufschütten des Geländes benötigt. Sie kamen von den Umbauarbeiten an der Mercedes-Benz-Arena und dem Bau der Stuttgarter Stadtbahnlinie U15.
Ressourcenschonendes Baumanagement und Nachhaltigkeit
Während der gesamten Rückbauphase war Arcadis für die Bauüberwachung, die umwelttechnische Fachbauüberwachung sowie für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination zuständig. Die Beeinträchtigung der Anwohner in der Nachbarschaft durch Lärm und Staub sollte so weit wie möglich vermieden werden. Auch eine U-Bahn-Station mit angrenzender Außenwand an das Baugelände erforderte besondere Umsicht, Planung und Koordination der Abrissmaßnahmen.
Auf einem Teil des Areals entwickelte ein Investor das inzwischen in vielerlei Hinsicht als innovativ und zukunftsweisend geltende Einkaufs- und Wohnquartier Killesberghöhe. Von Beginn an waren hier die Anrainer in den Architekturwettbewerb und die Bauphase eingebunden. Außerdem wurde die Killesberghöhe als erstes neu errichtetes Stadtquartier in Deutschland von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) mit einem Zertifikat in Gold ausgezeichnet.
Auch an diesem Projekt war Arcadis beteiligt: Das Unternehmen plante die Baugrube, moderierte, führte Workshops durch und bewertete schließlich das Stadtquartier anhand der DGNB-Kriterien. Um die Voraussetzungen für den Erhalt dieses DGNB-Siegels zu erfüllen, waren immerhin 45 Kriterien einzuhalten. Ein wesentlicher Bestandteil war die Aufbereitung des Baugeländes im Rahmen eines ressourcenschonenden Baumanagements, wie es in dem Rückbauprojektumgesetzt worden war.