Die Corona-Pandemie zwang Kanzleien zum Umdenken, heute zeigt sich: Homeoffice und Remote Working funktionierten besser als gedacht. Viele der Impulse will man weiternutzen, gesucht wird eine Balance aus Büro- und Heim-Tätigkeit. Klar ist aber auch: Die neue Dynamik der Digitalisierung soll genutzt werden, um weitere Bereiche effizienter zu gestalten.
Remote Working und Homeoffice – für Wirtschaftskanzleien waren das noch vor wenigen Monaten Begriffe, die im Arbeitsalltag keine große Rolle spielten. Der Job fand in den bestens ausgestatteten Büros der Kanzleien statt, es wurde viel gereist: Vielfliegerei statt Arbeit von zu Hause aus. Dann kam Corona – und änderte alles. Wie sehr, zeigt der Facebook-Auftritt der Wirtschaftskanzlei Linklaters. Ein Posting von Ende März verlinkt auf einen Clip auf der Online-Präsenz der Kanzlei. Gezeigt werden darin Senior Partner Andreas Steck und Associate Dr. Julian Emmerich, beide in heimischer Umgebung, ohne Krawatte. Steck sitzt am Klavier, Emmerich steht vor dem Mikro, gemeinsam geben sie „Your Song“ von Elton John.
Das Homeoffice führt einem sehr schnell vor Augen, welche Dinge tatsächlich im Alltag gut tun und wichtig sind – für diese sucht man sich nun Wege, um im neuen Alltag nicht darauf verzichten zu müssen.
„Jams from Home“ ist der Name dieser Clip-Reihe, es folgt Dylans „Knockin On Heavens Door“, gespielt von Partner Klaus Hoenig an der Gitarre und Bilingual Secretary Maite Völtz am Gesang; Associate Viktor Graeme und Marketing Communication Assistant Lisa Danne geben „Hey There Delilah“, eine Ballade der US-Gruppe Plain White T’s. „Remote Working hat ihre Herausforderungen, aber auch seine ungeahnt positiven Seiten“, heißt es in einer Mitteilung der Kanzlei zu den „Jams from Home“. „Wir lernen uns alle noch besser kennen, und der Kreativität sind erstaunlicherweise selbst in dieser Form der Zusammenarbeit kaum Grenzen gesetzt.“
Adriana von Hardenberg, Managing Associate im Bereich Gesellschaftsrecht, erläutert: „Das Homeoffice führt einem sehr schnell vor Augen, welche Dinge tatsächlich im Alltag gut tun und wichtig sind – für diese sucht man sich nun Wege, um im neuen Alltag nicht darauf verzichten zu müssen: Statt Mittagessen und Kaffeepausen mit Kollegen, Telefonate und Chats mit Cappuccino in der Sonne; statt Abendessen mit Freunden, Videokonferenzen und Videoanrufe der Familie.“ Carla Müller, bei Linklaters wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Dispute Resolution, fasste ihre Zeit im Homeoffice mit drei Worten zusammen: „Flexibilität. Effizienz. Ausschlafen.“ Vier Monate lang unterstützte sie ihr Team im Remote-Working-Modus und war positiv überrascht, welche Vorteile diese Arbeitsphase mit sich gebracht hat: „Der größte Vorteil ist aus meiner Sicht die gewonnene Zeit und Flexibilität.“
Homeoffice mit Jams und Flexibilität: Was wird bleiben?
Keine Frage, die Belegschaft von Linklaters hat den (teilweise bis heute anhaltenden) ungewohnten Arbeitsbedingungen etwas Positives abgewinnen können. Vielen Kanzleien geht es ähnlich. Nun stellt sich die Frage: Was bleibt von diesen positiven Erfahrungen übrig, nachdem sich der Job-Alltag in kleinen Schritten wieder normalisiert und diese Normalität eines Tages mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder hergestellt sein wird? Wird Corona ein Wandlungs-Motor sein, der die juristische Arbeit dauerhaft geändert hat? Oder wird die Pandemie nur eine Episode sein, die gezeigt hat, wie es anders gehen könnte – bevor die meisten Kanzleien dann doch wieder auf die üblichen Pfade eingebogen sind?
Virtuelle Gerichtsverhandlungen
Die internationale Kanzlei DLA Piper hat in einer Studie gefragt, wie hoch bei Anwälten die Akzeptanz für virtuelle Gerichtsverhandlungen ist. Alle Umfrageteilnehmer sahen die Autorität des jeweiligen Gerichts auch virtuell gewährleistet. 86 Prozent der Befragten befanden die Software-Lösungen wie Zoom, Bluejeans oder die Netzwerk-Plattform Microsoft Teams für zufriedenstellend. 71 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, dass die Verfahrensgerechtigkeit gewahrt würde. Kritisch betrachtet wird die Beschränkung der Teilnehmerzahl aufgrund von niedrigen Internet-Bandbreiten in manchen Jurisdiktionen. „Wir haben jüngst – abgesehen von einigen technischen Problemen – gute Erfahrungen mit einer der ersten Online-Verhandlungen beim Landgericht München gemacht”, sagt Prof. Dr. Stefan Engels Partner im Hamburger Büro von DLA Piper. „Wir gehen davon aus, dass virtuelle Verhandlungen auch nach der Covid-19-Pandemie häufiger anberaumt werden. Allerdings: Es bedarf einer speziellen Vorbereitung auf die besondere Situation.“
Joachim Gores ist Partner in der Wirtschaftskanzlei Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare in Essen, betreut dort im Schwerpunkt Unternehmenstransaktionen und berät im Gesellschaftsrecht. Auf die Frage, was nach Corona von den Prozessen bleiben wird, die während der Pandemie erprobt worden sind, sagt er: „Telefon- und Videokonferenzen werden auch für Verhandlungen viel häufiger eingesetzt werden. Gerade bei vorbereitenden Terminen, internen Abstimmungen und in Arbeitsgruppen wird man auf moderne Kommunikationsformen stärker zurückgreifen.“ Auch die Möglichkeit, Vertragsdokumente zu teilen und online zu bearbeiten, werde langfristig an Bedeutung gewinnen – mit dem Ziel, eine Balance aus digitalen Innovationen und erprobten Arbeitsweisen herzustellen. „Nach meiner Einschätzung wird am Ende ein sinnvoller Mix aus moderner Technologie und konventioneller Verhandlung das Ergebnis sein“, glaubt Joachim Gores. „Denn eines steht für mich trotz aller positiven Erfahrungen mit einem vollständig online durchgeführten Großprojekt fest: Die direkte Kommunikation von Menschen Auge in Auge sowie die Empathie, die dabei eine große Rolle spielt, sind nicht zu ersetzen.“
München, Düsseldorf, Madrid – aber nur virtuell
Bei dem Großprojekt, das Joachim Gores anspricht, handelte es sich um eine Transaktion mit Unternehmen aus München, Düsseldorf und Madrid. „Ohne Covid-19 wären wesentliche Vorbesprechungen, interne Abstimmungsrunden, aber insbesondere auch die Verhandlungen zu einem großen Teil ‚konventionell‘ durchgeführt worden“, sagt der Partner bei Kümmerlein. „Es hätte größere Arbeitsgruppen gegeben, die einzelne Teile des Projekts zusammen am jeweiligen Standort voranbringen.“ Wegen Covid-19 sei das grundlegend anders gewesen. „Alle Termine, bis auf die Beurkundung des fertigen Vertragswerkes, haben online stattgefunden. Die meisten Projektbeteiligten befanden sich im Homeoffice. Nur vereinzelt wurde die Arbeit auch vom Arbeitsplatz im Büro erledigt.“
Der ganz große Nachteil, insbesondere in Verhandlungen, ist, dass die persönliche Nähe fehlt.
Trotz der tiefgreifenden Veränderungen, die diese Pandemie mit sich gebracht hat, habe man das Projekt in sehr kurzer Zeit zum Erfolg führen können: „Obwohl die Welt und die Wirtschaft von außen betrachtet im Stillstand verharrten, haben wir im Projekt mit Volldampf gearbeitet. Und da die meisten Beteiligten vom Homeoffice aus tätig waren, war eine extreme zeitliche Flexibilität festzustellen.“ Der positive Effekt: Viele Arbeitsstränge konnten parallelisiert werden, limitierende Faktoren wie Arbeitswege oder Büroöffnungszeiten fielen weg. „Im Prinzip lief die Transaktion rund um die Uhr“, sagt Gores.
Unternehmen wollen auch nach der Krise an Homeoffice festhalten
Die Corona-bedingten Anpassungen der Arbeitsorganisation haben vielen Unternehmen gezeigt, dass sich mehr Tätigkeiten für die Arbeit im Homeoffice eignen als bislang angenommen. „Aufgrund der neuen Erfahrungen und Erkenntnisse planen viele Unternehmen, Homeoffice auch nach der Krise intensiver zu nutzen als vor dem Beginn der Corona-Pandemie“, sagt Dr. Daniel Erdsiek, Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich Digitale Ökonomie.
Lief bei dieser Remote-Transaktion vielleicht sogar alles besser als sonst? Joachim Gores relativiert: „Der ganz große Nachteil, insbesondere in Verhandlungen, ist, dass die persönliche Nähe fehlt.“ Die Möglichkeit, in Telefon- oder Videokonferenzen im Verlaufe langer Verhandlungen eine persönliche Vertrauensbeziehung aufzubauen, fehle fast völlig. „Das Gegenüber, das man überzeugen will und von dem man Entgegenkommen braucht, um zum Erfolg zu kommen, bleibt trotz moderner Kommunikationstechnologie anonym und unnahbar. Auch die Abstimmung auf kurzem Wege mit dem Mandanten oder mit Kollegen bleibt auf der Strecke.“
Remote-Work verlangt mehr Kommunikationsskills
Was Juristen in solchen Situationen bräuchten: „Noch mehr Kommunikationsgeschick als ohnehin schon“. In Verhandlungen und Konferenzen per Video benötige man die kommunikative Disziplin, um in langen Verhandlungen stringent durch die Themen zu führen. Auch die Organisation sei wichtig, sagt Joachim Gores: „Telefon- und Videokonferenzen verleiten dazu, den Teilnehmerkreis sehr großzügig zuzuschneiden. Input ‚von der Seite‘ ist jederzeit möglich. Gerade in dieser Konstellation muss man sehr darauf achten, dass die Kommunikation nicht zerfasert und Entscheidungswege nicht verlassen werden.“
Die Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte hat zu Beginn der Pandemie nur wenige Tage benötigt, um die auf fünf Standorte verteilte Belegschaft im Homeoffice zu installieren. „Die Herausforderung war dann, Haushalt und Ablenkung durch die Familie mit der notwendigen Verfügbarkeit und dem hohen Arbeitsanfall für die Kanzlei in Einklang zu bringen“, sagt Matthias Nordmann, als Partner Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Was zudem gefehlt habe, waren die sozialen Dimensionen der Arbeit im Office: „Viele Kolleginnen und Kollegen, gerade, wenn sie alleine wohnen, genießen unter normalen Umständen den Gang ins Büro und die soziale Interaktion dort.“
Vorbehalte gegen Homeoffice verschwunden
Wo also wird der Schwerpunkt der anwaltlichen Tätigkeit in Zukunft liegen, vornehmlich zu Hause oder wieder in der Kanzlei? „Eine Kombination aus beidem wird die ideale Lösung sein“, meint Matthias Nordmann. „Während es vor Corona teils noch deutliche Vorbehalte gegenüber dem Homeoffice gegeben hat, wollen wir die Homeoffice-Tätigkeit nun auf jeden Fall beibehalten. Die entsprechenden Spielregeln arbeiten wir gerade aus.“ Wobei es bei der Gestaltung wichtig sei, nicht die Bedürfnisse der Nachwuchskräfte zu vergessen, die neu im Kanzleiteam sind. „Für die Integration junger Kollegen ist es wichtig, dass neben der begrüßenswerten Flexibilisierung der Arbeit weiterhin Aspekte der Kanzleikultur und des gegenseitigen Umgangs nicht zu kurz kommen“ – „kurze, aber intensive“ Meetings im privaten Umfeld sollen dafür sorgen, dass die persönlichen Kontakte bei den Einsteigern nicht zu kurz kommen.
Wie geht Homeoffice?
Der Deutsche Anwaltverein (DAV) bietet auf seiner Homepage ein FAQ, um bislang im Homeoffice ungeübten Kanzleiteams bei der Umstellung auf Remote Work zu helfen. Darunter finden sich auch konkrete Organisationstipps für den Arbeitstag zu Hause und das Zusammenspiel mit den Kollegen: Dazu zählen ein gemeinsamer Morgen-Check-in per Videochat, Bestimmung eines Gatekeepers, der Mail-Eingänge nach Relevanz sortiert und verteilt, sowie eine exakte und transparente Pflege des Fristenkalenders. Generell sei Vertrauen wichtig, bei zeitkritischen oder haftungsträchtigen Informationen kann es aber sinnvoll sein, „auch kanzleiintern mit Empfangsbestätigungen zu arbeiten, damit man sichergeht, dass das Teammitglied im Homeoffice eine wichtige Information zur Kenntnis genommen hat“, heißt es bei den FAQs des DAV.
Mit Blick auf das Geschäft hat die Homeoffice-Situation bei SKW Schwarz dazu geführt, „dass auch die letzten Prozesse in der Kanzlei vollständig digitalisiert wurden“, wie Matthias Nordmann feststellt. „Nun ist die gesamte Anwalts- und Verwaltungstätigkeit digital möglich.“ So erlaube die elektronische Anwaltssignatur beA die digitale Unterzeichnung und Zustellung von Schriftsätzen und anderen Dokumenten – „dies bedeutet in Zukunft eine deutliche Erleichterung“. Für das Kanzleiteam selbst habe diese Digitalisierung keine große Umstellung bedeutet: „Unsere Anwälte waren es bereits gewohnt, von unterwegs zu arbeiten und technisch entsprechend ausgestattet.“ Bei vielen Mandanten der Kanzlei sei dies jedoch noch nicht der Fall gewesen. „Hier dauerte die Umstellung auf die rein virtuelle Zusammenarbeit häufig wesentlich länger.“
Virtuelle Verhandlungen und Beurkundungen
Matthias Nordmann stellt allerdings auch fest, dass der Weg der Digitalisierung noch keineswegs abgeschlossen ist. „Mit unserer Legal Tech-Tochtergesellschaft arbeiten wir derzeit an der AI-basierten Erstellung von Musterdokumenten.“ Der Ansatz: Die Künstliche Intelligenz liefert bei standardisierten Prozessen fertige Vertragsentwürfe. „Dies wird die anwaltliche Tätigkeit weitern erleichtern und dem Mandanten Kostenersparnisse bringen“, sagt Matthias Nordmann. Und weitere digitale Entwicklungen seien wünschenswert. So glaubt der Partner von SKW Schwarz, dass „mehr virtuelle Gerichtsverhandlungen – bei Zustimmung aller Beteiligten – erhebliche Erleichterungen und Kostenersparnisse mit sich bringen würden“.
Auch an der Digitalisierung der notariellen Beurkundung müsse weiter gearbeitet werden: „Warum“, fragt Matthias Nordmann, „kann eine Beurkundung nicht auch durch Einloggen in einen virtuellen Datenraum, sichere Identifizierung der Teilnehmer und schließlich der Verlesung in einer Videokonferenz stattfinden?“ Es wird also klar: Corona hat der Digitalisierung der juristischen Arbeit einigen Rückenwind gegeben – am Ziel angekommen ist der Veränderungsprozess aber noch lange nicht.
Buchtipp: Veränderungsprozesse rechtssicher begleiten
Verwaltungen und Unternehmen wenden zunehmend neue Strategien an, um die Digitalisierung umzusetzen. Dabei ist vermehrt agile Führung die Lösung. „Agile Arbeit – Chancen und Risiken für Arbeitnehmer“ erläutert verschiedene Methoden agiler Arbeitsweisen (von Scrum bis Design Thinking), gibt Praxisbeispiele und zeigt die Vor- und Nachteile dieser auf. Ebenso werden die Voraussetzungen für derartige Transformationsprozesse, wie die Unternehmenskultur und das erforderliche Mindset, beleuchtet. Marcus Schwarzbach: Agile Arbeit – Chancen und Risiken für Arbeitnehmer. Walhalla 2020, 19,95 Euro










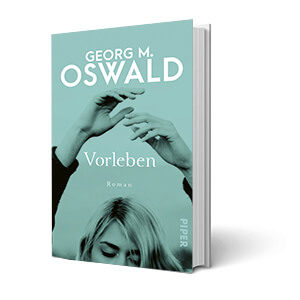 Oswalds aktueller Roman „Vorleben“, erschienen 2020, erzählt von der noch recht frischen Beziehung einer Journalistin mit einem Musiker, die auf die Probe gestellt wird, als die Protagonistin bei ihrer Recherche auf beunruhigende Informationen aus der Vergangenheit ihres Partners stößt. Wie sehr kann das „Vorleben“ die Gegenwart belasten? Zum Thema Recht hat Oswald neben „55 Gründe, Rechtsanwalt zu werden“ 2018 das Buch „Unsere Grundrechte. Welche wir haben, was sie bedeuten und wie wir sie schützen“ veröffentlicht.
Oswalds aktueller Roman „Vorleben“, erschienen 2020, erzählt von der noch recht frischen Beziehung einer Journalistin mit einem Musiker, die auf die Probe gestellt wird, als die Protagonistin bei ihrer Recherche auf beunruhigende Informationen aus der Vergangenheit ihres Partners stößt. Wie sehr kann das „Vorleben“ die Gegenwart belasten? Zum Thema Recht hat Oswald neben „55 Gründe, Rechtsanwalt zu werden“ 2018 das Buch „Unsere Grundrechte. Welche wir haben, was sie bedeuten und wie wir sie schützen“ veröffentlicht.
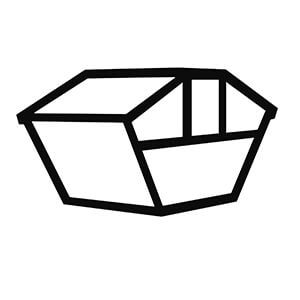


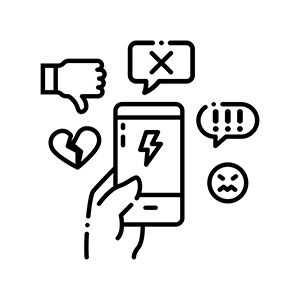





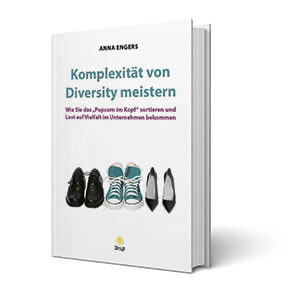 Der Begriff Diversity macht schnell „Popcorn im Kopf“, weil es ein so weitverzweigtes, unüberschaubares und facettenreiches Thema ist. Anna Engers, selbst Volljuristin, aber ist überzeugt: Diversity ist der Booster für jedes Unternehmen. Dennoch tun sich die Organisationen in Deutschland immer noch schwer, echte Vielfalt zu integrieren und zu leben. Warum das so ist und was sich hinter dem Begriff „Diversity“ eigentlich verbirgt, dem hat sich die Autorin in diesem Buch gewidmet. Anna Engers: Komplexität von Diversity meistern. Sorriso Verlag 2020, 18 Euro.
Der Begriff Diversity macht schnell „Popcorn im Kopf“, weil es ein so weitverzweigtes, unüberschaubares und facettenreiches Thema ist. Anna Engers, selbst Volljuristin, aber ist überzeugt: Diversity ist der Booster für jedes Unternehmen. Dennoch tun sich die Organisationen in Deutschland immer noch schwer, echte Vielfalt zu integrieren und zu leben. Warum das so ist und was sich hinter dem Begriff „Diversity“ eigentlich verbirgt, dem hat sich die Autorin in diesem Buch gewidmet. Anna Engers: Komplexität von Diversity meistern. Sorriso Verlag 2020, 18 Euro.