„Wirtschaftsprüfer 2.0“ – das sind analytisch starke und digital fitte Denker, die tief in die Netzwerke ihrer Mandanten eintauchen. Sie nutzen Big Data und Blockchain, erstellen mit ihren Prüfungen Mehrwert für den Kunden und schaffen Vertrauen durch persönliche Beratungen. Durch diese Entwicklung steigt der Anspruch an den Beruf. Technik hilft – man muss aber auch mit ihr umgehen können. Von André Boße.
Bei unaufhaltsamen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen kommt irgendwann der Punkt, an dem eine Sache kippt. Das gilt insbesondere für die Digitalisierung. 2002 zum Beispiel erreichte diese eine Schwelle, als zum ersten Mal mehr Informationen digital als analog gespeichert werden konnten – das Digitale Zeitalter begann. 2018 war es erstmals soweit, dass die Deutschen mehr Telefonate über ihr Handy führten als über das Festnetz. Auch diese Entwicklung wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr umkehren.
Ab 2026: Mehr Maschinen als Menschen
Für den Bereich der Wirtschaftsprüfung hat nun das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Lünendonk & Hossenfelder einen solchen Kipp-Punkt prognostiziert. Grundlage dafür sind Befragungen der 25 umsatzführenden Wirtschaftsprüfer in Deutschland. Lünendonk befragt diese Gesellschaften jährlich, um aus den Ergebnissen die Lünendonk-Liste zu erstellen (siehe Kasten). Was sich bei der Umfrage für 2019 zeigt: Die Bedeutung der IT-gestützten Abschlussprüfung nimmt zu, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften investieren in diesem Bereich viel Geld, um Personal zu finden oder weiterzubilden, um Know-how aufzubauen und die technischen Voraussetzungen zu garantieren. Im Jahr 2026 – also in sieben Jahren – soll es dann soweit sein, dass „mehr Prüfungshandlungen autonom mittels Rechner ausgeführt werden als durch Menschen“, wie Lünendonk das Ergebnis der Befragung zusammenfasst.
Lünendonk-Liste
Laut Ranking ist PwC weiterhin die größte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deutschlands. Mit einem Wachstum von 4,1 Prozent steigerte das Unternehmen laut Lünendonk-Liste den Inlandsumsatz auf 2.156,2 Millionen Euro. Im Vorjahr konnte PwC noch um 9,1 Prozent zulegen. Weiterhin auf Position zwei liegt Ernst & Young (EY) mit 1.970,0 Millionen Euro (+7,8 Prozent). KPMG bleibt EY mit 1.830,0 Millionen Euro auf den Fersen: Nach einem durchwachsenen Geschäftsjahr 2017 legte die Berliner WP-Gesellschaft 2018 mit einem Plus von 10,2 Prozent zweistellig zu und überzeugte vor allem in der Managementberatung, meldet Lünendonk.
Da sich durch diesen Wandel die Arbeit von Wirtschaftsprüfern weiter verändern wird, fordern die Gesellschaften ein Umdenken in der Ausbildung. 95 Prozent der befragten Unternehmen stimmen der Aussage zu, dass sich die Ausbildung an Universitäten, die interne Weiterbildung sowie die Vorbereitung auf das Examen ändern müssten – 37 Prozent sagten, das treffe „voll und ganz“, 58 Prozent es treffe „eher zu“. Interessant ist, dass auf dem Arbeitsmarkt schon heute die Bedeutung des klassischen Abschlusses als Wirtschaftsprüfer leicht rückgängig ist:
Die Branche als solches wachse, stellt Lünendonk fest, im Mittel um 7,8 Prozent seien die 25 umsatzstärksten Gesellschaften gewachsen. Entsprechend hoch ist dort der Bedarf an Einsteigern. Demgegenüber stehe jedoch ein Rückgang der Wirtschaftsprüfer-Examina.
Diesen Mangel gleichen die Gesellschaften aus, in dem sie offen für Einsteiger aus anderen Fakultäten sind, wie Jörg Hossenfelder sagt, geschäftsführender Gesellschafter von Lünendonk & Hossenfelder: „Weil das große Wachstum beim Gros der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nicht aus dem Audit-Segment kommt, ist die Absolventenentwicklung nicht so dramatisch, wie sie auf den ersten Blick aussieht.“
Weniger lästige Routinen, mehr Freiräume
Wie aber wird sich der Beruf des Wirtschaftsprüfers durch die digitale Transformation verändern? Reguliert sie einen der schon jetzt reguliertesten Berufe noch weiter ein? Oder schafft sie Freiraum für eine qualitativ hochwertigere Arbeit, weil die Digitalisierung den Wirtschaftsprüfer bei zeitraubenden Routinearbeiten entlastet? Jörg Hossenfelder geht davon aus, dass Zweiteres zutrifft. So seien angepasste Datenanalysen und künstliche Intelligenz in der Lage, den Prüfer von lästigen Tätigkeiten zu befreien. Data Analytics ermöglichten die Analyse von Volldaten – und nicht mehr nur von Stichproben. Künstliche Intelligenz unterstütze die Planung und Durchführung der Prüfung.
Wie aber wird sich der Beruf des Wirtschaftsprüfers durch die digitale Transformation verändern? Reguliert sie einen der schon jetzt reguliertesten Berufe noch weiter ein? Oder schafft sie Freiraum für eine qualitativ hochwertigere Arbeit?
Wobei Systeme wie „Natural Language Processing“ zu Hilfsmitteln werden, um die Interaktion zwischen Menschen und Computern auf Basis von Sprache schneller und effektiver zu machen. „In Zukunft werden die Jahresabschlüsse anders geprüft, nämlich smarter“, prognostiziert Hossenfelder. Gleichzeitig nehme der Wirtschaftsprüfer immer stärker die Rolle eines betriebswirtschaftlichen Beraters ein. Die Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Prüfern werde neu definiert, „Wirtschaftsprüfer 2.0“ nennt Hossenfelder diesen neuen Typus.
Die Wirtschaftsprüfer müssen sich nach diesem Update höheren Anforderungen stellen, glaubt Jörg Hossenfelder: „Das Arbeitsspektrum wird komplexer, der Mandant fordernder. Die digitale Transformation sorgt für eine engere Verzahnung mit den Mandanten, wirft aber Fragen im Hinblick auf Datensicherheit und Compliance auf.“
Ein Thema sei auch die Cloud: Viele der neuen Anwendungen im Bereich der Prüfungen und Jahresabschlüsse werden dort zu finden sein. Und sie müssen für die Prüfer zugänglich sein. Daher stehe die digitale Vernetzung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften mit ihren Mandanten ganz oben auf der Agenda. Die Einrichtung von „Data Rooms“, Remote-Zugriffe auf Anwendungen und Daten, Shared Services – die Zahl der Schnittstellen zwischen Mandanten und Prüfern nimmt zu. Um das sicher zu organisieren, wird auch die Blockchain verstärkt eine Rolle spielen. Sie ist als Technik in der Lage, Netzwerke so zu organisieren, dass sie erstens sicher und zweitens absolut transparent sind.
Die neue WP-Welt: Blockchain und Robo-Kollegen
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hat zum Thema Digitalisierung selbst eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, wie diese Entwicklung das Finanz- und Rechnungswesen und damit auch die Abschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer beeinflusst. Gefragt wurden Unternehmen, inwieweit neue digitale Methoden zum Einsatz kommen sollen und was man sich von ihnen erhoffe. „Der Trend, neue Technologien einzusetzen, um unstrukturierte Daten wie Texte, Bilder und Sprache zu erkennen, wird sich fortsetzen“, bewertet PwC das Ergebnis der Studie. „Denn hier liegt das größte Potenzial neuer Technologien. Hinzu kommen Softwareroboter, die Anomalien erkennen oder Buchungen und Transaktionen auslösen.“
Voraussetzung, durch diese Methoden einen Mehrwert für die Mandanten zu generieren, ist natürlich, dass diese bereit sind, den Prüfern Daten aus dem Rechnungswesen zur Verfügung zu stellen. Die Studie zeigt: sieben von zehn Unternehmen sind dazu bereit, 33 Prozent von diesen ohne Einschränkung, 20 Prozent nur in Teilen, 17 Prozent nur für bestimmte Analysen.
Der Blick des Prüfers muss viel weiter gehen, bis tief hinein in die digitalen Strukturen und Vernetzungen.
Was aber bedeutet diese Aufgabe konkret für den Arbeitsalltag des Wirtschaftsprüfers? Für Rüdiger Loitz, Partner im Bereich Capital Markets & Accounting Advisory Services bei PwC, steht fest, dass die Prüferroutine „prüfen und ablegen“ zunehmend Vergangenheit ist. „Heute verwischt der Prüfungsgegenstand im weiten Datenraum von Big Data“, sagt Loitz. Sprich: Der Blick des Prüfers muss viel weiter gehen, bis tief hinein in die digitalen Strukturen und Vernetzungen. Heißt das, dass in Zukunft die Prüfungsarbeit ganz von Maschinen übernommen werden wird? „Diese Prognose erscheint aus heutiger Sicht gewagt, aber fest steht: Ein Großteil der Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers wird in Zukunft durch die digitale Datenanalyse automatisiert“, so Loitz.
Für die Wirtschaftsprüfer bedeutet dies, dass sie ihr Fachwissen mit einem tiefgehenden Verständnis digitaler Technologien verbinden müssten. „Nur so können sie die zunehmend komplexen Geschäftsmodelle und Systeme der Mandanten und die immer anspruchsvollere Prüfungstechnologie beherrschen“, sagt Rüdiger Loitz. Klar, der hohe Anspruch sei gegeben. Dennoch überwiegen seiner Meinung nach die Vorteile der Transformation: „Durch digitale Technologien lässt sich das Prüfungsvorgehen objektiver gestalten und die Transparenz der Prüfungsergebnisse erhöhen.“ Jedoch fordert auch er, dass es für die Tätigkeiten, die beim menschlichen Prüfer verbleiben, neue Ausbildungs- und Karrieremodelle geben müsse.
Neue Technik braucht Prüfer mit Know-how
Mark Meuldijk und Toni Wattenhofer, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG am Standort Zürich, stellen in einem Fachaufsatz zum Thema „Auswirkung der Digitalisierung auf den Beruf des Wirtschaftsprüfers“ einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Erfolg der Arbeit und dem digitalen Know-how der Wirtschaftsprüfer her. Ob die digitale Transformation glücke, hänge nicht nur von der Technik ab. „Es hat auch damit zu tun, ob und wie die Mitarbeitenden die neuen technischen Möglichkeiten (richtig) verstehen und anwenden. Daher hängt der Erfolg eines digitalisierten Prüfungsansatzes auch in hohem Maße von den Fähigkeiten der Mitarbeitenden ab. Die Prüfer müssen neue Denkweisen entwickeln und viele ihrer gewohnten Routinen aufgeben. Die Fachleute müssen künftig in digitalen Möglichkeiten denken.“
Branchen-Überblick
Die Lünendonk-Liste bietet auch einen Blick auf die gesamte Branche der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Hinsichtlich des Marktvolumens erzielte die WP-Branche 2018 laut Lünendonk ein Wachstum von plus 5,8 Prozent. Der Löwenanteil basiert auf der Leistungssteigerung der Big Four – also der vier größten Gesellschaften. Im aktuellen Geschäftsjahr 2019 erwarten die von Lünendonk befragten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ein Branchenwachstum von 3,9 Prozent.
Das wiederum funktioniere nur mit neuen Kompetenzen im Bereich analytischer Fähigkeiten. „Bei der Analyse der konkreten Geschäftsumgebung ihrer Mandanten müssen die Wirtschaftsprüfer unterschiedliche, relevante Disziplinen – Rechnungswesen, Datenanalytik, Prozessverständnis und Digitalisierung – mit einbinden“, fordern die beiden Autoren. Zudem gefragt: Qualitäten im Projektmanagement, flexible Anpassung an unterschiedliche Firmenumgebungen, Führungskompetenz sowie die Fähigkeit, Mitarbeiter mit unterschiedlichem technischem und kulturellem Background anzuleiten. Die beiden KPMG-Partner gehen sogar soweit, in Aussicht zu stellen, dass künftig nur noch ein Netzwerk von Spezialisten aus verschiedenen Fachbereichen die Anforderungen und Erwarten erfüllen kann, die in Zukunft an die Wirtschaftsprüfung gestellt werden. „Die Wirtschaftsprüfer werden daher ihre Prüfungsansätze überdenken müssen – wenn nicht gar ihr gesamtes Berufsbild.“
Buchtipp
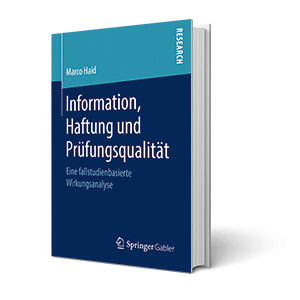 Perspektiven für die Jahresabschlussprüfung In seinem Buch „Information, Haftung und Prüfungsqualität“ (erschienen bei Springer Professional) behandelt Autor Marco Haid in einem Kapitel die „Relevanten Perspektiven“ für die Abschlussprüfung. Dabei geht er auf das Thema Kosten der Prüfung ein, verweist auf die wichtigsten Normen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfung. Es werden sowohl nationale als auch internationale normative Rahmenbedingungen im Bereich der Verpflichtung und der Ausgestaltung der Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung aufgearbeitet und gegenübergestellt. Das Kapitel ist auf der Verlagshomepage auch einzeln gegen Bezahlung abrufbar. Marco Haid: Information, Haftung und Prüfungsqualität: Eine fallstudienbasierte Wirkungsanalyse. Springer Professional 2018. 59,99 Euro
Perspektiven für die Jahresabschlussprüfung In seinem Buch „Information, Haftung und Prüfungsqualität“ (erschienen bei Springer Professional) behandelt Autor Marco Haid in einem Kapitel die „Relevanten Perspektiven“ für die Abschlussprüfung. Dabei geht er auf das Thema Kosten der Prüfung ein, verweist auf die wichtigsten Normen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfung. Es werden sowohl nationale als auch internationale normative Rahmenbedingungen im Bereich der Verpflichtung und der Ausgestaltung der Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung aufgearbeitet und gegenübergestellt. Das Kapitel ist auf der Verlagshomepage auch einzeln gegen Bezahlung abrufbar. Marco Haid: Information, Haftung und Prüfungsqualität: Eine fallstudienbasierte Wirkungsanalyse. Springer Professional 2018. 59,99 Euro





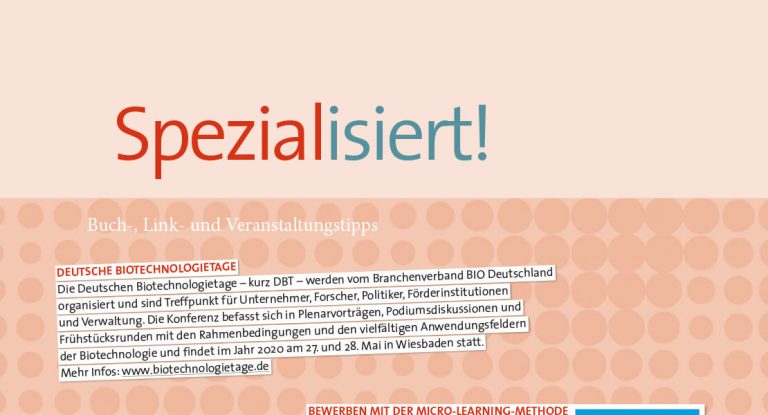
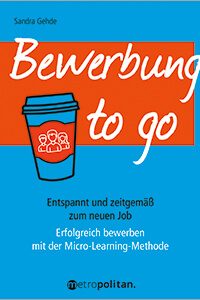 Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit ihren Berwerbungsunterlagen zu beschäftigen. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro.
Der Ratgeber „Bewerbung to go“ ist für alle, die keine Zeit haben, sich stundenlang mit ihren Berwerbungsunterlagen zu beschäftigen. Sandra Gehde: Bewerbung to go. Entspannt und zeitgemäß zum neuen Job. Erfolgreich bewerben mit der Micro- Learning-Methode. metropolitan 2019. ISBN 978-3-96186-030-2. 14,95 Euro.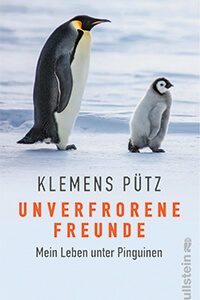 Seit fast 30 Jahren erforscht Klemens Pütz das Leben von Pinguinen. Dafür reist er jedes Jahr für mehrere Monate in die Antarktis und in andere Regionen, in denen die Tiere leben. Nun gewährt er erstmals umfassend Einblick in den Alltag dieser faszinierenden Vögel und erklärt, was wir tun müssen, um sie zu schützen. Klemens Pütz, Dunja Batarilo: Unverforene Freunde. Mein Leben unter Pinguinen. Ullstein 2019. ISBN 978-3-55005-034-3. 20,00 Euro.
Seit fast 30 Jahren erforscht Klemens Pütz das Leben von Pinguinen. Dafür reist er jedes Jahr für mehrere Monate in die Antarktis und in andere Regionen, in denen die Tiere leben. Nun gewährt er erstmals umfassend Einblick in den Alltag dieser faszinierenden Vögel und erklärt, was wir tun müssen, um sie zu schützen. Klemens Pütz, Dunja Batarilo: Unverforene Freunde. Mein Leben unter Pinguinen. Ullstein 2019. ISBN 978-3-55005-034-3. 20,00 Euro.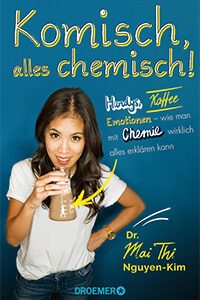 Chemie ist alles – was wir tun, was uns umgibt, was wir fühlen, alles hat mit Chemie zu tun. Die junge Wissenschaftlerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim tritt in diesem spannenden Pop-Science-Buch den munteren Beweis dafür an und zerlegt Alltagsphänomene in ihre chemischen Elemente. Witzig und originell erklärt sie, welche chemischen Reaktionen in und um uns herum insgeheim ablaufen, und macht vor allem eins: Lust auf Chemie. Mai Thi Nguyen-Kim: Komisch, alles chemisch! Droemer 2019. ISBN 978-3-426-27767-6. 16,99 Euro.
Chemie ist alles – was wir tun, was uns umgibt, was wir fühlen, alles hat mit Chemie zu tun. Die junge Wissenschaftlerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim tritt in diesem spannenden Pop-Science-Buch den munteren Beweis dafür an und zerlegt Alltagsphänomene in ihre chemischen Elemente. Witzig und originell erklärt sie, welche chemischen Reaktionen in und um uns herum insgeheim ablaufen, und macht vor allem eins: Lust auf Chemie. Mai Thi Nguyen-Kim: Komisch, alles chemisch! Droemer 2019. ISBN 978-3-426-27767-6. 16,99 Euro.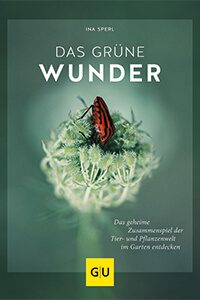 Im kleinen Kosmos „Garten“ ereignen sich ziemlich viele erstaunliche Dinge: Im Boden sorgen Kleinstlebewesen dafür, dass Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden können. Manche Pflanzen geben Stoffe in den Boden ab, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten. Andere Pflanzen wiederum fördern sich gegenseitig im Wachstum. Im Buch „Das grüne Wunder“ erklärt die Gartenexpertin Ina Sperl auf lockere Weise das faszinierende Zusammenspiel von Bodenleben, Pflanzen- und Tierwelt im eigenen Garten. Ina Sperl: Das grüne Wunder. Das geheime Zusammenspiel der Tier- und Pflanzenwelt im Garten entdecken. Gräfe & Unzer 2019. ISBN: 978-3-8338-6953-2. 17,99 Euro.
Im kleinen Kosmos „Garten“ ereignen sich ziemlich viele erstaunliche Dinge: Im Boden sorgen Kleinstlebewesen dafür, dass Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen werden können. Manche Pflanzen geben Stoffe in den Boden ab, um sich Konkurrenz vom Leib zu halten. Andere Pflanzen wiederum fördern sich gegenseitig im Wachstum. Im Buch „Das grüne Wunder“ erklärt die Gartenexpertin Ina Sperl auf lockere Weise das faszinierende Zusammenspiel von Bodenleben, Pflanzen- und Tierwelt im eigenen Garten. Ina Sperl: Das grüne Wunder. Das geheime Zusammenspiel der Tier- und Pflanzenwelt im Garten entdecken. Gräfe & Unzer 2019. ISBN: 978-3-8338-6953-2. 17,99 Euro.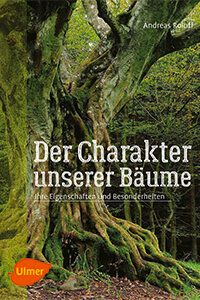 Baumexperte Andreas Roloff porträtiert in diesem Buch liebevoll und ausführlich 40 Stadt-, Park- und Waldbäume, viele davon einst Baum des Jahres. Schnelllebige Baumpioniere wie die Birke, bekannte Waldarten wie die Rot-Buche, ehrwürdige Baumveteranen wie Eiche und Ginkgo – die Vielfalt ist enorm. Ausführliche Porträts vermitteln Spannendes über Geschichte, Aussehen und Wirkung, Biologie, Nutzung und vieles mehr, kurz: das wirklich ganz Besondere jeder einzelnen Baumart, fundiert und unterhaltsam zugleich. Andreas Roloff: Der Charakter unserer Bäume. Ihre Eigenschaften und Besonderheiten. Ulmer 2017. ISBN 978-3-8001-0929-6. 19,90 Euro.
Baumexperte Andreas Roloff porträtiert in diesem Buch liebevoll und ausführlich 40 Stadt-, Park- und Waldbäume, viele davon einst Baum des Jahres. Schnelllebige Baumpioniere wie die Birke, bekannte Waldarten wie die Rot-Buche, ehrwürdige Baumveteranen wie Eiche und Ginkgo – die Vielfalt ist enorm. Ausführliche Porträts vermitteln Spannendes über Geschichte, Aussehen und Wirkung, Biologie, Nutzung und vieles mehr, kurz: das wirklich ganz Besondere jeder einzelnen Baumart, fundiert und unterhaltsam zugleich. Andreas Roloff: Der Charakter unserer Bäume. Ihre Eigenschaften und Besonderheiten. Ulmer 2017. ISBN 978-3-8001-0929-6. 19,90 Euro.

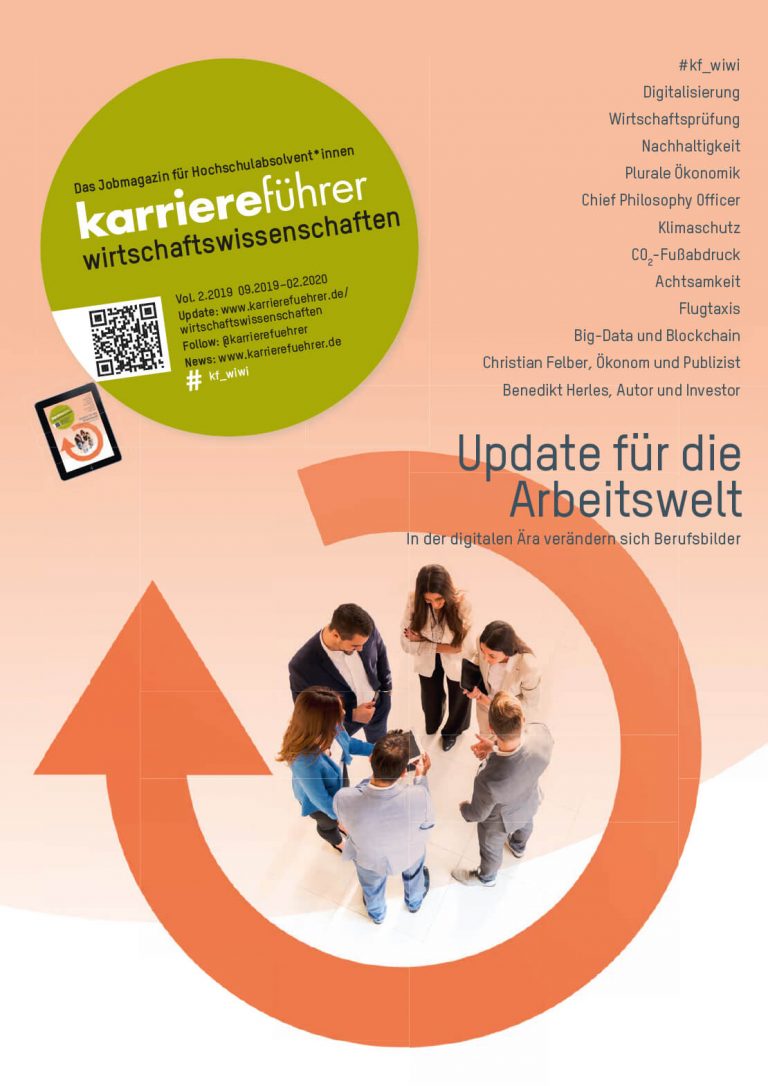


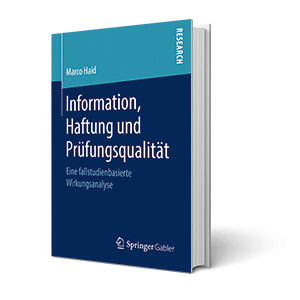 Perspektiven für die Jahresabschlussprüfung In seinem Buch „Information, Haftung und Prüfungsqualität“ (erschienen bei Springer Professional) behandelt Autor Marco Haid in einem Kapitel die „Relevanten Perspektiven“ für die Abschlussprüfung. Dabei geht er auf das Thema Kosten der Prüfung ein, verweist auf die wichtigsten Normen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfung. Es werden sowohl nationale als auch internationale normative Rahmenbedingungen im Bereich der Verpflichtung und der Ausgestaltung der Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung aufgearbeitet und gegenübergestellt. Das Kapitel ist auf der Verlagshomepage auch einzeln gegen Bezahlung abrufbar. Marco Haid: Information, Haftung und Prüfungsqualität: Eine fallstudienbasierte Wirkungsanalyse. Springer Professional 2018. 59,99 Euro
Perspektiven für die Jahresabschlussprüfung In seinem Buch „Information, Haftung und Prüfungsqualität“ (erschienen bei Springer Professional) behandelt Autor Marco Haid in einem Kapitel die „Relevanten Perspektiven“ für die Abschlussprüfung. Dabei geht er auf das Thema Kosten der Prüfung ein, verweist auf die wichtigsten Normen im Zusammenhang mit der Jahresabschlusserstellung und der Jahresabschlussprüfung. Es werden sowohl nationale als auch internationale normative Rahmenbedingungen im Bereich der Verpflichtung und der Ausgestaltung der Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung aufgearbeitet und gegenübergestellt. Das Kapitel ist auf der Verlagshomepage auch einzeln gegen Bezahlung abrufbar. Marco Haid: Information, Haftung und Prüfungsqualität: Eine fallstudienbasierte Wirkungsanalyse. Springer Professional 2018. 59,99 Euro
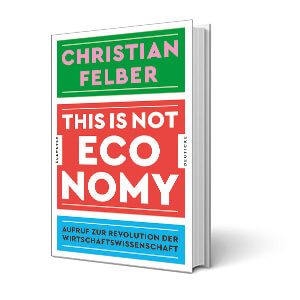 Christian Felbers neues Buch erscheint Ende September 2019. „This Is Not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft“ legt offen, wie sehr sich die Ökonomie wie eine Naturwissenschaft betrachtet und mit dieser Haltung Diskussionen ausschließt sowie Pluralität verhindert. Der Autor zeigt, dass zentrale Punkte des neoklassischen Kapitalismus dem zeitgenössischen Demokratieverständnis widersprechen und nicht dazu geeignet sind, die Herausforderungen der Gegenwart zu lösen. Christian Felber: This Is Not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Deuticke 2019. 22 Euro.
Christian Felbers neues Buch erscheint Ende September 2019. „This Is Not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft“ legt offen, wie sehr sich die Ökonomie wie eine Naturwissenschaft betrachtet und mit dieser Haltung Diskussionen ausschließt sowie Pluralität verhindert. Der Autor zeigt, dass zentrale Punkte des neoklassischen Kapitalismus dem zeitgenössischen Demokratieverständnis widersprechen und nicht dazu geeignet sind, die Herausforderungen der Gegenwart zu lösen. Christian Felber: This Is Not Economy – Aufruf zur Revolution der Wirtschaftswissenschaft. Deuticke 2019. 22 Euro.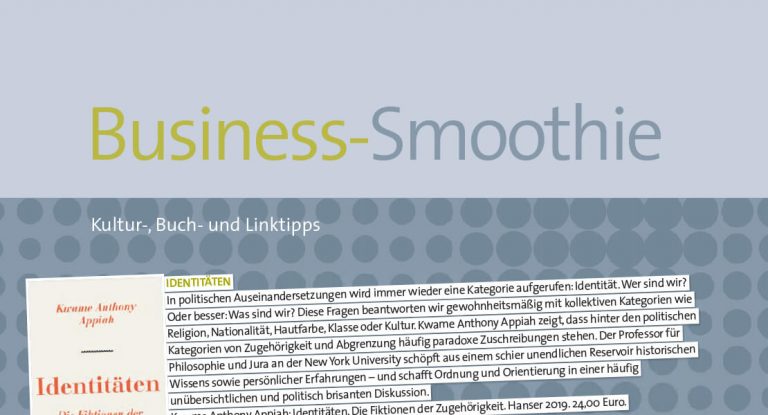
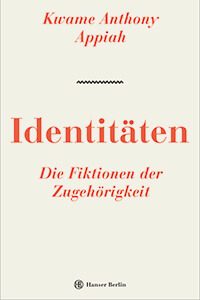 In politischen Auseinandersetzungen wird immer wieder eine Kategorie aufgerufen: Identität. Wer sind wir? Oder besser: Was sind wir? Diese Fragen beantworten wir gewohnheitsmäßig mit kollektiven Kategorien wie Religion, Nationalität, Hautfarbe, Klasse oder Kultur. Kwame Anthony Appiah zeigt, dass hinter den politischen Kategorien von Zugehörigkeit und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen stehen. Der Professor für Philosophie und Jura an der New York University schöpft aus einem schier unendlichen Reservoir historischen Wissens sowie persönlicher Erfahrungen – und schafft Ordnung und Orientierung in einer häufig unübersichtlichen und politisch brisanten Diskussion. Kwame Anthony Appiah: Identitäten. Die Fiktionen der Zugehörigkeit. Hanser 2019. 24,00 Euro.
In politischen Auseinandersetzungen wird immer wieder eine Kategorie aufgerufen: Identität. Wer sind wir? Oder besser: Was sind wir? Diese Fragen beantworten wir gewohnheitsmäßig mit kollektiven Kategorien wie Religion, Nationalität, Hautfarbe, Klasse oder Kultur. Kwame Anthony Appiah zeigt, dass hinter den politischen Kategorien von Zugehörigkeit und Abgrenzung häufig paradoxe Zuschreibungen stehen. Der Professor für Philosophie und Jura an der New York University schöpft aus einem schier unendlichen Reservoir historischen Wissens sowie persönlicher Erfahrungen – und schafft Ordnung und Orientierung in einer häufig unübersichtlichen und politisch brisanten Diskussion. Kwame Anthony Appiah: Identitäten. Die Fiktionen der Zugehörigkeit. Hanser 2019. 24,00 Euro.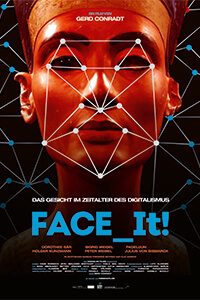 In FACE_IT! geht der Videopionier Gerd Conradt der Bedeutung des Gesichts im digitalen Zeitalter nach. Sein Dokumentarfilm beschäftigt sich mit der Codierung des Gesichts, die als moderner Fingerabdruck wie ein geheimnisvolles Siegel Zugang zur Persönlichkeit eines Menschen verschafft. Mit Hilfe des Facial Action Coding System (FACS) soll es möglich werden, die Geheimnisse des Gesichts – des Spiegels der Seele – zu entschlüsseln. Der Film fragt: Wem gehört das zum Zahlencode gewordene Gesicht? Gerd Conradt unterhält sich dazu mit Menschen, die sich mit der Überwachung durch digitale Gesichtserkennung kritisch auseinandersetzen: Er trifft Datenschützer, Künstler, einen Medienrebellen, eine Kunsthistorikerin und die Staatsministerin für Digitalisierung. Face_It! – Das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus. missingFILMs, 80 Minuten. Im Kino seit 25. Juli, die DVD kommt voraussichtlich Anfang 2020.
In FACE_IT! geht der Videopionier Gerd Conradt der Bedeutung des Gesichts im digitalen Zeitalter nach. Sein Dokumentarfilm beschäftigt sich mit der Codierung des Gesichts, die als moderner Fingerabdruck wie ein geheimnisvolles Siegel Zugang zur Persönlichkeit eines Menschen verschafft. Mit Hilfe des Facial Action Coding System (FACS) soll es möglich werden, die Geheimnisse des Gesichts – des Spiegels der Seele – zu entschlüsseln. Der Film fragt: Wem gehört das zum Zahlencode gewordene Gesicht? Gerd Conradt unterhält sich dazu mit Menschen, die sich mit der Überwachung durch digitale Gesichtserkennung kritisch auseinandersetzen: Er trifft Datenschützer, Künstler, einen Medienrebellen, eine Kunsthistorikerin und die Staatsministerin für Digitalisierung. Face_It! – Das Gesicht im Zeitalter des Digitalismus. missingFILMs, 80 Minuten. Im Kino seit 25. Juli, die DVD kommt voraussichtlich Anfang 2020.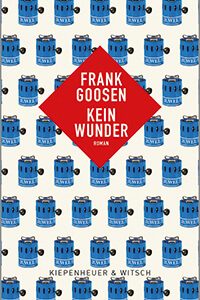 Der neue Roman von Frank Goosen spielt 1989 – im letzten Sommer vor der Wende in Berlin. Fränge, Anfang zwanzig, hat gleich zwei Freundinnen: Marta im Westen und Rosa im Osten – und natürlich wissen die beiden nichts voneinander. Als Fränges Freunde Förster und Brocki aus Bochum zu Besuch kommen, gerät einiges in Bewegung … Eine wunderbare Komödie über die Zeit der Wende, die Subkultur Westberlins und die Dissidentenszene im Osten. Frank Goosen: Kein Wunder. Kiepenheuer & Witsch 2019. 20,00 Euro.
Der neue Roman von Frank Goosen spielt 1989 – im letzten Sommer vor der Wende in Berlin. Fränge, Anfang zwanzig, hat gleich zwei Freundinnen: Marta im Westen und Rosa im Osten – und natürlich wissen die beiden nichts voneinander. Als Fränges Freunde Förster und Brocki aus Bochum zu Besuch kommen, gerät einiges in Bewegung … Eine wunderbare Komödie über die Zeit der Wende, die Subkultur Westberlins und die Dissidentenszene im Osten. Frank Goosen: Kein Wunder. Kiepenheuer & Witsch 2019. 20,00 Euro.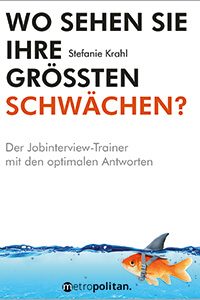 Die Frage nach den Stärken und Schwächen ist ein Klassiker im Vorstellungsgespräch. Die Karriereberaterin Stefanie Krahl gibt Tipps und zeigt viele Möglichkeiten, wie man souverän und geschickt Informationsfragen, Situationsfragen oder Stressfragen beantwortet. Besonders praktisch: Die herausnehmbaren Lernkarten. Stefanie Krahl: Wo sehen Sie Ihre größten Schwächen? Der Jobinterview-Trainer mit den optimalen Antworten. metropolitan Bücher 2019. 19,95 Euro.
Die Frage nach den Stärken und Schwächen ist ein Klassiker im Vorstellungsgespräch. Die Karriereberaterin Stefanie Krahl gibt Tipps und zeigt viele Möglichkeiten, wie man souverän und geschickt Informationsfragen, Situationsfragen oder Stressfragen beantwortet. Besonders praktisch: Die herausnehmbaren Lernkarten. Stefanie Krahl: Wo sehen Sie Ihre größten Schwächen? Der Jobinterview-Trainer mit den optimalen Antworten. metropolitan Bücher 2019. 19,95 Euro. 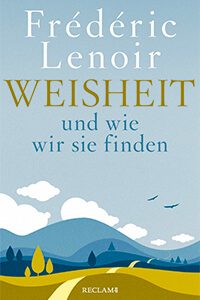 Was ist wirklich wichtig, wie können wir uns selbst besser kennenlernen und mit der Welt in Einklang sein? Der französische Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Bestseller-Autor Frédéric Lenoir hat in den Lehren der Weltreligionen und bei großen Denkern weise Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens gefunden. Inspiriert von Montaigne, Nietzsche oder Spinoza gibt er konkrete Ratschläge, wie man ein sinnerfülltes und gutes Leben führen kann. Frédéric Lenoir: Weisheit und wie wir sie finden. Reclam 2019. 14,00 Euro.
Was ist wirklich wichtig, wie können wir uns selbst besser kennenlernen und mit der Welt in Einklang sein? Der französische Philosoph, Religionswissenschaftler, Soziologe und Bestseller-Autor Frédéric Lenoir hat in den Lehren der Weltreligionen und bei großen Denkern weise Antworten auf die entscheidenden Fragen des Lebens gefunden. Inspiriert von Montaigne, Nietzsche oder Spinoza gibt er konkrete Ratschläge, wie man ein sinnerfülltes und gutes Leben führen kann. Frédéric Lenoir: Weisheit und wie wir sie finden. Reclam 2019. 14,00 Euro.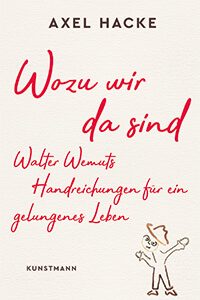 Axel Hacke widmet sich mit seinem neuen Buch einem großen Thema: Wie lebt man am besten mit sich selbst? Der Schriftsteller und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung hat einen Monolog aufgeschrieben, den Monolog von Walter Wemut: Einem Nachrufschreiber, der Tag für Tag über Tote schreibt, dabei aber das Leben zum Thema hat. Axel Hacke: Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben. Kunstmann 2019. 20 Euro.
Axel Hacke widmet sich mit seinem neuen Buch einem großen Thema: Wie lebt man am besten mit sich selbst? Der Schriftsteller und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung hat einen Monolog aufgeschrieben, den Monolog von Walter Wemut: Einem Nachrufschreiber, der Tag für Tag über Tote schreibt, dabei aber das Leben zum Thema hat. Axel Hacke: Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben. Kunstmann 2019. 20 Euro.

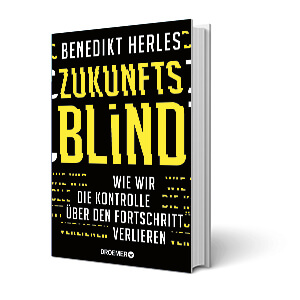 Buchtipp
Buchtipp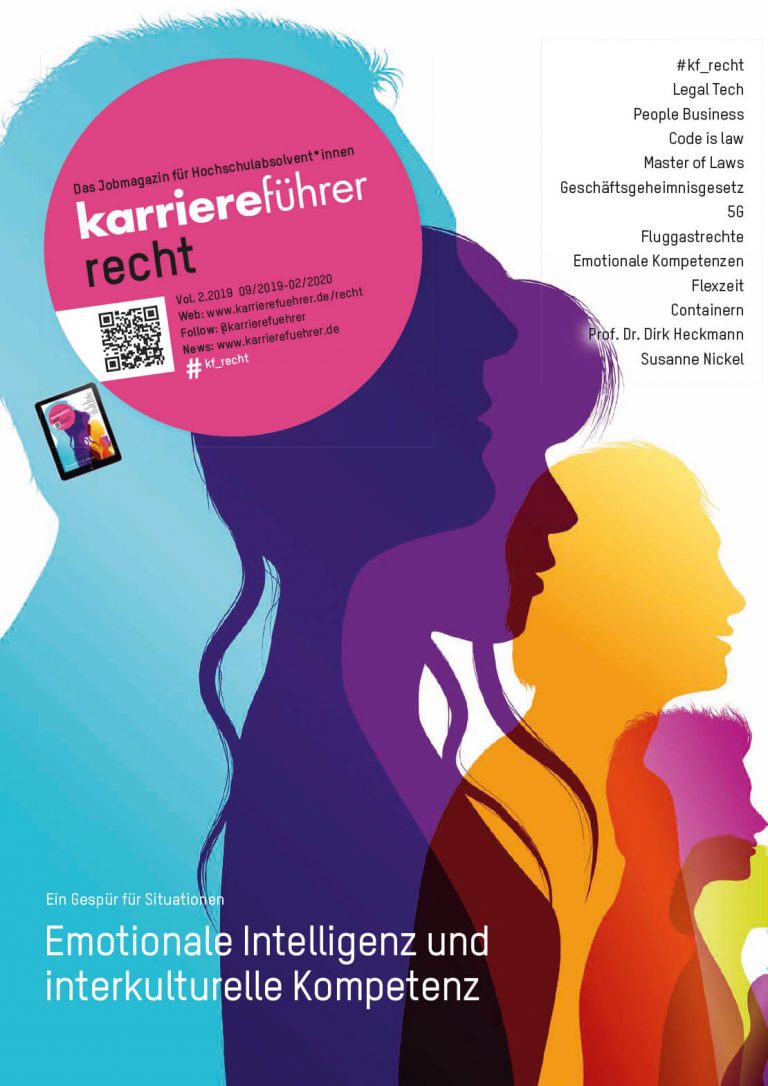
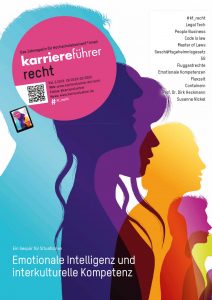 Emotionale Intelligenz und interkulturelle Kompetenz
Emotionale Intelligenz und interkulturelle Kompetenz