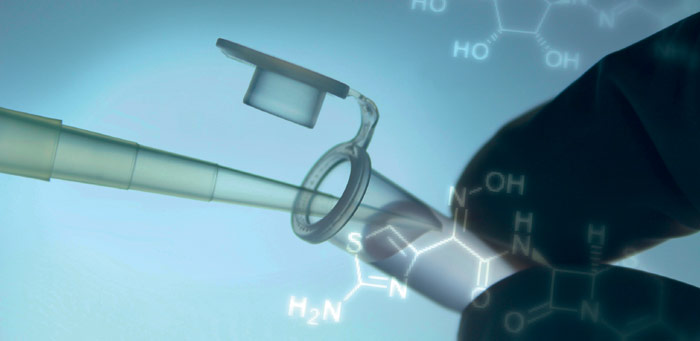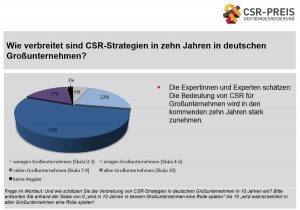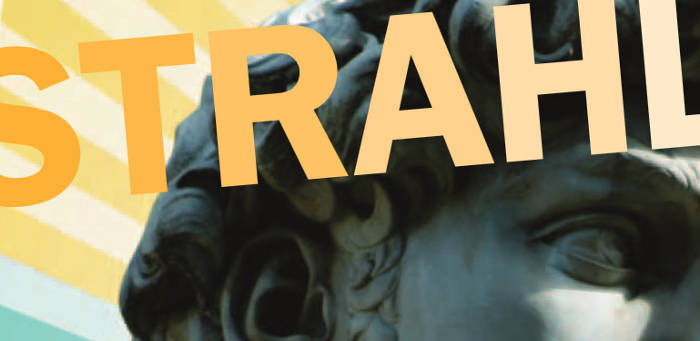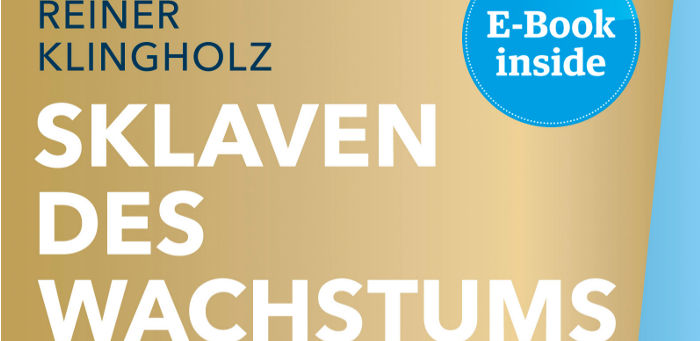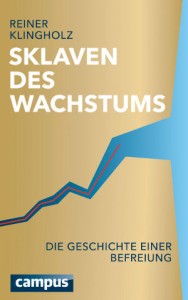Ob als Manager, im Labor oder im Vertrieb: Die Pharmaunternehmen bieten Absolventen der Naturwissenschaften vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Doch in der Branche wachsen die Ansprüche. Weil heute der Zusatznutzen eines Präparats den Preis bestimmt, legen die Unternehmen großen Wert auf Effizienz in Forschung und Vertrieb. Einsteiger, die diese Herausforderungen im Blick haben, stehen vor interessanten Karrieren – ob in Konzernen oder bei pharmazeutischen Pionieren. Von André Boße
Ist das der Durchbruch in der Krebsforschung? In den Laboren des biopharmazeutischen Unternehmens CureVac arbeiten Naturwissenschaftler an einem Stoff, der bei Krebspatienten eine individuelle Hilfe zur Selbsthilfe anregt und das Immunsystem in die Lage versetzt, sich selbst gegen die zerstörerischen Zellen zur Wehr zu setzen. Das Geheimnis hinter dem Präparat ist Ribonukleinsäure, kurz RNA. Ihre Moleküle verrichten im menschlichen Körper einen wichtigen Botendienst: Sie transportieren die genetischen Informationen aus dem „Speicherraum“ im Zellkern dorthin, wo die Proteine neue Zellen entstehen lassen. Die Idee der Tübinger Forscher: Wäre es nicht möglich, einem kranken Körper durch eine von außen verabreichte Dosis von Boten-RNA (kurz mRNA) Informationen zu geben, wie er sich gegen krankmachende Zellen wehren kann? Gegen Krebszellen, aber auch Grippeviren?
Buchtipp
Mirjam Müller: Promotion, Postdoc, Professur.
Karriereplanung in der Wissenschaft. Campus 2014.
ISBN 978-3593501727.
24,90 Euro (E-Book inklusive).
Dr. Birgit Scheel glaubt fest daran, dass das funktionieren wird. Seit Frühsommer 2014 ist die promovierte Biologin für das Projektmanagement der Weiterentwicklung der Krebstherapie auf Basis von mRNA verantwortlich. Ins Unternehmen kam die Forscherin schon kurz nach der Gründung im Jahr 2000. Sie schrieb dort ihre Doktorarbeit und fokussierte sich dann recht schnell auf eine Karriere im pharmazeutischen Management. „Das war eine bewusste Entscheidung, die ich nie bereut habe.“ Birgit Scheels Laufbahn steht exemplarisch für die guten Chancen, die Naturwissenschaftler heute auch im pharmazeutischen Management besitzen, wo man ihr fachliches Know-how schätzt, weil sie auch die komplexen Zusammenhänge der Forschung durchschauen.
Karriere im Pharmamanagement
Bei CureVac war Birgit Scheel zunächst einige Jahre lang für die Auswertung der frühen vorklinischen Studien zuständig, die notwendig sind, wenn man einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen möchte. Die Biologin bekam die Studienergebnisse auf den Tisch und zog gemeinsam mit ihren Kollegen die nötigen Schlussfolgerungen für Forschung und Entwicklung. Ein Job auf der Schnittstelle zwischen Labor und Management, wobei es, so Birgit Scheel, „sehr hilft, wenn man die Hintergründe der Forschungsarbeit kennt und die Studien schnell einordnen kann“.
Aktuell arbeiten die 120 Beschäftigten des Unternehmens daran, durch Studien zu belegen, dass die RNA-Therapie tatsächlich wirkt. Ein Job, für den man Geduld benötigt, wie Birgit Scheel bekräftigt: „Pharmazeutische Entwicklung dauert seine Zeit, schnell vergehen 15 Jahre oder mehr, bis ein Produkt endlich auf dem Markt ist.“ Ohne eine gewisse Hartnäckigkeit geht es nicht. Aber auch nicht ohne die feste Überzeugung, mit der pharmazeutischen Arbeit etwas Sinnvolles und Gutes zu leisten. Als weitere wichtige Fähigkeiten für Pharmamanager nennt die Biologin Stärken in der Kommunikation und Koordination. „Meine Aufgabe ist es, Partner mit sehr verschiedenen Hintergründen in ein Boot zu bekommen, darunter Ärzte, Klinikplaner, andere potenzielle Partner und die Kollegen innerhalb des Unternehmens.“
Filmtipp
FameLab ist ein vom British Council veranstalteter internationaler Wettbewerb für Wissenschaftskommunikation, der seit 2011 auch in Deutschland ausgetragen wird. Unter dem Motto „Talking Science“ stehen hier Wissenschaftler auf der Bühne und vermitteln einem öffentlichen Publikum von Laien möglichst unterhaltsam und verständlich – und in lediglich drei Minuten – ihr Forschungsgebiet. Videos der diesjährigen Vorträge und weitere Infos unter:
www.famelab-germany.de
Forschung mit Schnittstellen
Dieses Zusammenspiel verschiedener Akteure macht Pharma zu einer besonders komplexen Branche. Zu spüren bekommen das auch Naturwissenschaftler, die sich nicht einer Management-, sondern einer Forscherkarriere widmen. „Früher arbeiteten die Kollegen in kleineren Teams, die sich auf eine Problemstellung fokussierten. Heute sind sie zumeist in größeren Teams mit Leuten aus unterschiedlichsten Bereichen involviert“, sagt Dr. Stephan Ladenburger, Leiter der klinischen Forschung bei Novartis Pharma, der deutschen Pharmatochter des Schweizer Novartis-Konzerns.
Durch diese Entwicklung ergeben sich in der täglichen Arbeit zwangsläufig viele Schnittstellen zu anderen Disziplinen. Vorbei die Zeit, als sich die Forschung ausschließlich auf eine Kundengruppe fokussierte. Heute gilt es, die Bedürfnisse vieler Akteure im Hinterkopf zu haben, zum Beispiel die der Kostenträger im Gesundheitssystem. „Auch die gesundheitspolitischen und rechtlichen Rahmenbedingungen müssen mit einbezogen werden“, so Ladenburger.
Pharmazeutische Planung findet daher heute nicht mehr im „sterilen Raum“ statt. Patientenverbände, Ärzte, Gesundheitspolitiker – sie alle nehmen Einfluss. Kein Wunder, dass Stephan Ladenburger von Novartis drei für Einsteiger besonders wichtige Kompetenzen nennt, die mit naturwissenschaftlichen Fachkenntnissen auf den ersten Blick wenig zu tun haben: Anpassungsfähigkeit, kommunikatives Geschick und Neugierde. Zwar seien ein guter Abschluss sowie eine überzeugende Vita ebenfalls wichtig. „Jedoch spielen bei der Internationalität und der Vernetzung der pharmazeutischen Forschung auch Teamfähigkeit und Sprachkenntnisse eine entscheidende Rolle“, so Stephan Ladenburger.
Viele Pharmaunternehmen haben ihre Programme für Trainees auf diese Entwicklung ausgerichtet. So auch Novartis: Neben einem Angebot mit dem Schwerpunkt Klinische Forschung bietet der Arbeitgeber auch Einstiegsmöglichkeiten in den Bereichen Marketing, Personal, Qualitätsmanagement oder Vertrieb. Egal, wo man startet: Klug ist, wer sich schnell mit den anderen Bereichen vernetzt. Ladenburger: „Vernetzte Einsteiger wissen um die Zusammenhänge im Unternehmen. Sie kennen die einzelnen Stellschrauben und bauen sich gleichzeitig ihr eigenes Netzwerk auf. Das sind wesentliche Vorteile für den eigenen Karriereweg.“
Linktipp
Eine erste Übersicht über MBA-Angebote
im Bereich Healthcare/Life Science bietet
das Portal www.mba-lounge.de
Der Nutzen entscheidet
Was Forscher früher wie heute eint, ist die Begeisterung dafür, etwas Neues zu entdecken. Beim forschenden Arzneimittelhersteller Janssen-Cilag, einer Tochter des internationalen Konzerns Johnson & Johnson, legte der Unternehmensgründer Paul Janssen schon in den 1950er-Jahren den Grundstein für eine „Forscherkultur“: Egal, wo er morgens seine Mitarbeiter traf, ob im Aufzug, auf dem Parkplatz oder auf dem Flur, stets fragte er: „Was gibt’s Neues?“ „Nach vorne zu blicken und nicht stehenbleiben zu wollen – das treibt uns auch heute noch an. Und das erwarten wir, neben fachlichen Kompetenzen, auch von unseren Einsteigern“, sagt Dr. Frank Zils, Personalleiter des Neusser Unternehmens.
Der Blick nach vorne beinhaltet in der Pharmabranche heute aber immer auch die Frage, ob das neue Arzneimittel tatsächlich besser ist als alle bisher auf dem Markt erhältlichen. Dass Medikamente und Therapieangebote wirken und für die Patienten sicher sind, ist die eine Seite. Da jedoch die Bewertung des tatsächlichen Zusatznutzens den Preis eines neuen Produkts bestimmt, kommt es für die Forschung entscheidend darauf an, diesen Nutzwert festzustellen und nachzuweisen. „Daher gilt es für unsere Forscher, sich frühzeitig mit anderen Fachleuten im Unternehmen zu verzahnen, zum Beispiel mit den Kollegen aus den Bereichen Health Economics und Market Access“, sagt Franz Zils.
Ambitionierte Naturwissenschaftler sollten daher von Beginn an keine Berührungsängste mit anderen Abteilungen haben. „Je breiter die beruflichen Erfahrungen, desto größer die Aufstiegschancen“, sagt Frank Zils. Bei Janssen & Cilag finden sich aktuell Naturwissenschaftler in allen Führungsebenen. „Auch die meisten Mitglieder der Geschäftsleitung inklusive der Vorsitzenden haben einen naturwissenschaftlichen oder medizinischen Hintergrund.“ Daher rät Zils, bei der Gestaltung der Karriere auf Abwechslung zu achten. „Viele Kollegen haben auf dem Weg nach oben nicht nur eine Station durchlaufen, sondern verschiedene, um sich auf diese Weise entweder fachlich oder von der Führungsebene her weiterzuentwickeln.“
Chancen in Marketing und Vertrieb
Zwei Bereiche, die von Absolventen recht selten in Betracht gezogen werden, sind Marketing und Vertrieb. Jedoch bieten sich dort auch für Naturwissenschaftler gute Chancen, weil sich aktuell die Strukturen und Anforderungen verändern. „Wir suchen kontinuierlich nach neuen Wegen, um unsere Kunden zu erreichen“, sagt Wolfram Berndt, Leiter Talent Management Deutschland bei Boehringer Ingelheim. Das Marketing unterliegt heute strengen Compliance-Vorschriften, klassische Werbematerialien zum Beispiel dürfen nicht mehr in den Praxen verteilt werden. Also kommt es auf Kreativität an.
„Stark im Kommen sind Online-Fortbildungsveranstaltungen, die besonders bei Hausärzten beliebt sind“, sagt Berndt. Marketing-Spezialisten erarbeiten hier immer neue Angebote, wobei naturwissenschaftliches Knowhow dabei hilft, die Weiterbildungen interessant zu gestalten. Im Vertrieb kommt es für Einsteiger darauf an, den klaren Nutzen eines Präparats für den Arzt herauszustellen. „Und dazu gehört neben dem fachlich-inhaltlichen Verständnis auch Marketingkompetenz “, sagt Wolfram Berndt. Auch diese Karriereoption zeigt: Wenn sich Absolventen der Naturwissenschaften offen für das Wissen anderer Disziplinen zeigen, sind sie in nahezu allen Bereichen der Pharmaindustrie gefragt.
Wachstumsmarkt Schwellenländer
Die strengen Regulierungen und ein damit steigender Preis- und Kostendruck führen dazu, dass sich die Pharmaindustrie verstärkt auf den Wachstumsmarkt in Schwellenländern wie Brasilien, Indien oder auch China fokussiert. Nach einer Umfrage der Unternehmensberatung Roland Berger definieren die meisten großen Pharmakonzerne die Schwellenländer als „Investitionsfokus“: Es wird geschätzt, dass diese Länder schon im Jahr 2016 für fast 40 Prozent der gesamten Umsätze auf dem weltweiten Pharmamarkt verantwortlich sein werden. „Fast die Hälfte der befragten Konzerne ist bereit, ihre administrativen Tätigkeiten, Forschungsaktivitäten und Vertrieb in Richtung Schwellenländer zu verschieben“, heißt es in der Studie – eine Entwicklung, die Karrieren in der Branche noch internationaler gestaltet.