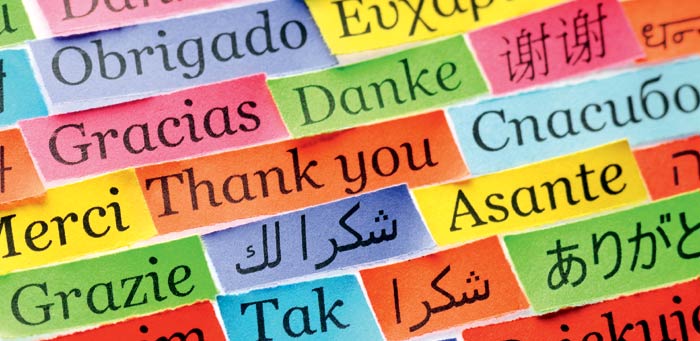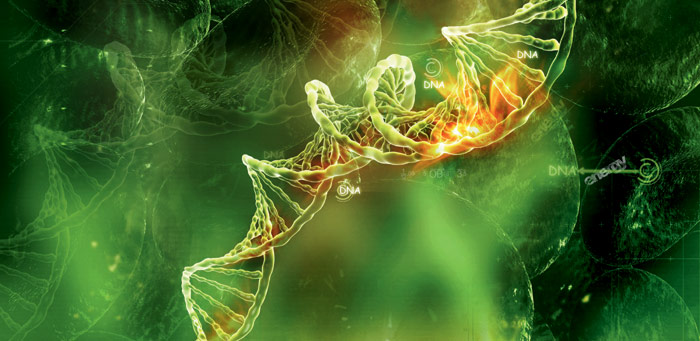Seit gut zwei Jahren arbeite ich bei der Wettbewerbszentrale, einer unabhängigen Selbstkontrollinstitution zur Durchsetzung des Rechts gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG). Der Wirtschaftsverband mit langer Tradition hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Frankfurt am Main. In den insgesamt sechs Büros in verschiedenen deutschen Großstädten arbeiten 25 Wettbewerbsjuristen. Seit Sommer 2013 bin ich im Büro München. Von Sabine Bendias, 31 Jahre, Rechtsassessorin und Wettbewerbsjuristin bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs – kurz: Wettbewerbszentrale (Münchner Büro).
Den Zugang zum Wettbewerbsrecht fand ich im Jurastudium mit Schwerpunkt „Wirtschaft und Steuer“. Das Lauterkeitsrecht, also das Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, dient im Unterschied zum Kartellrecht der Abwehr unlauterer und damit wettbewerbsverfälschender Handlungen wie zum Beispiel irreführende Werbung oder Herabsetzung eines Mitbewerbers. Die Begeisterung packte mich in der ersten Stunde der UWGVorlesung mit teils amüsanten, aber vor allem wichtigen Irreführungsfällen. Konkret wurde dort hinterfragt, ob der Verbraucher einen OP-gleichen Effekt erwartet, wenn eine Faltencreme „Lifting“ heißt. Auf die Wettbewerbszentrale aufmerksam wurde ich, als ich eine Seminararbeit schrieb und Stellungnahmen von Interessenverbänden zur UWG-Novelle 2009 an das Bundesministerium für Justiz auswertete. Daher entschied ich im Referendariat, die Wahlstation, bei der sich eine auf Wirtschaft ausgerichtete Wahlfachgruppe empfiehlt, in diesem Verband zu verbringen. Hier bot sich mir die Möglichkeit, ausschließlich im Bereich des Wettbewerbsrechts zu arbeiten.
Das deutsche Lauterkeitsrecht setzt auf Selbstregulierung durch den Markt. Es existiert also keine „Lauterkeitsbehörde“, sondern Mitbewerber, Wirtschafts- und Verbraucherverbände überwachen die Regeln selbst und setzen sie durch. Die Rechtsmaterie ist durch europäische Einflüsse mittlerweile sehr vielschichtig. Aufgrund der Bandbreite sind wir hausintern auf Branchen spezialisiert. Ich beispielsweise bin nun – neben zwei weiteren Kollegen – für die Getränkebranche zuständig, befasse mich also nicht nur mit klassischen UWG-Fragen wie Angebotsgestaltung, sondern auch mit lebensmittelrechtlichen Problematiken, die durch den Rechtsbruchtatbestand auch dem UWG unterfallen. In diesem Beruf sollte man eine hohe Flexibilität, Entscheidungsfreude und Verständnis für Marketingansätze mitbringen. Die Scheu vor Unbekanntem sollte rasch abgelegt werden, da ein schnelles Einarbeiten in unbekannte Gesetze gefragt ist. Gerade aus der Feder der Europäischen Union kommen diese häufig und in vielen Rechtsgebieten. Das Lebensmittelrecht beispielsweise beruht mittlerweile überwiegend auf europäischen Vorgaben. Dementsprechend habe ich oft mit meist englischsprachigen Richtlinien- und Verordnungstexten zu tun.
Meine Arbeit als Wettbewerbsjuristin besteht hauptsächlich darin zu überprüfen, ob Werbe- und Vertriebsmaßnahmen von Unternehmen mit dem geltenden Recht in Einklang stehen. Um bei geplanten Werbemaßnahmen Wettbewerbsverstöße im Voraus zu vermeiden, stehen Beratung und Information im Zentrum: So stehe ich Mitgliedern in rechtlichen Fragen zu Werbematerialien, seien es Plakatierungen, Werbespots, Internetauftritte oder Produktgestaltungen, zur Seite. Solche Anfragen kommen oft von Rechtsabteilungen der Unternehmen oder direkt vom Gewerbetreibenden selbst. Dabei sollte man generell in der Lage sein, Komplexes einfach darzustellen. Gelegentlich bedarf es gewisser diplomatischer Fähigkeiten, wenn zu vermitteln ist, dass das Werbekonzept nicht mit lauterkeitsrechtlichen Aspekten vereinbar ist.
Regelmäßig werden uns aber auch Beschwerden von Unternehmen, Kammern, Verbänden, Verbrauchern und Behörden angetragen. Diese werden dann dem bei uns zuständigen Juristen zur Prüfung vorgelegt. Wird ein Wettbewerbsverstoß festgestellt, schreiten wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln ein. Dies geschieht, wie im Gesetz vorgesehen, im Wege der Abmahnung, einer flexiblen Möglichkeit, Wettbewerbsstreitigkeiten rasch außergerichtlich zu klären. Im Vordergrund muss immer stehen, den Wettbewerbsverstoß nachhaltig auszuräumen, ohne den Unternehmer über Gebühr zu belasten.
Die meisten Wettbewerbsverletzungen geschehen nach meiner Erfahrung aus Unkenntnis, aus Versehen, nicht aus bewusster Missachtung der Gesetze. Die schwarzen Schafe gibt es auch, aber nicht oft. Ist die Gegenseite nicht einsichtig und ein eventuelles Einigungsstellenverfahren nicht erfolgreich, erteile ich Klageauftrag. Die Wettbewerbszentrale klagt dann im eigenen Namen einen eigenen Anspruch ein. Bei Grundsatzfragen werden gelegentlich Hauptsacheverfahren bis zum Bundesgerichtshof oder bis zum Europäischen Gerichtshof geführt.
Warum ich das mache? Ziel meiner Arbeit ist die Förderung des fairen Wettbewerbs. Man hat das Gefühl, „auf der richtigen Seite“ zu stehen. Der Beruf ist abwechslungsreich und bietet dauernd neue Herausforderungen. Das Gebiet ist durch den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt sowie Gesetzesänderungen ständig im Wandel, man arbeitet also aktiv an der Rechtsentwicklung mit.
Job-Steckbrief Wettbewerbsrechtler
Voraussetzungen:
Zwei juristische Staatsexamina, Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge, unternehmerisches Denken, gute Englischkenntnisse von VorteilEinstiegsmöglichkeiten:
Praktikum und/oder im Referendariat Anwalts- und Wahlstation im Bereich Wett bewerbsrecht/gewerblicher Rechtsschutz in einer Kanzlei, Kammer oder VerbandEinstiegsgehalt:
entspricht etwa üblichen juristischen Einstiegsgehältern in einer Kammer oder VerbandWeitere Informationen:
Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.
www.wettbewerbszentrale.de