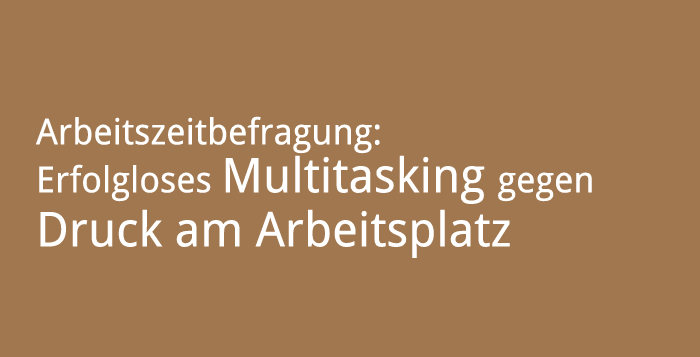Hinter freiwilligem sozialem Engagement, Corporate Social Responsibility oder Corporate Volunteering stehen Menschen, die sich engagieren – der karriereführer stellt sie vor. Aufgezeichnet von Stefan Trees
Philipp Becker, Ingenieur
Projekt: Ingenieure ohne Grenzen e.V./Biogas support for Tanzania „BiogaST“
Ort: Deutschlandweit/Afrika
Web: www.ingenieure-ohne-grenzen.org
„Ingenieure ohne Grenzen“ leistet seit 2003 internationale Entwicklungszusammenarbeit durch ingenieurwissenschaftliche Projekte in den Bereichen Wasser-, Sanitär- und Energieversorgung sowie Brückenbau. Die Entwicklung einer Kleinst-Biogasanlage auf Pflanzenbasis, die tansanischen Bauern die benötigte Energie zum Kochen liefern soll, brachte den Ingenieuren den deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt 2011.
Wie alles begann
Ich habe Umweltverfahrenstechnik an der HTW Berlin studiert. Vor fünf Jahren bin ich auf der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit im Internet auf „Ingenieure ohne Grenzen“ gestoßen. Kurz zuvor hatte unsere Partnerorganisation MAVUNO Project, eine Nichtregierungsorganisation in Tansania, eine Anfrage im Bereich Biogas gestellt – das passte sehr gut in meinen Bereich, und so habe ich dort meine Diplomarbeit angemeldet.
Ich bin dann sehr bald zum ersten Mal nach Tansania gereist. Bei „Ingenieure ohne Grenzen“ wird vor jedem Projekt eine Erkundungsreise gemacht, um mit den Partnern vor Ort Kontakte zu knüpfen und erste Eindrücke über die Strukturen und Möglichkeiten zu gewinnen.
Mit technischer Unterstützung des Leibniz-Instituts für Agrartechnik Potsdam- Bornim, das im Bereich Biogas forscht, habe ich in Tansania ein Biogas- Labor eingerichtet, das auch heute noch genutzt wird. Vor Ort habe ich Tests mit verschiedenen Substraten gemacht, Anlagen besichtigt, die schon in den 90er-Jahren gebaut worden waren, und mit den Bauern über die Probleme gesprochen, die es mit den Anlagen gegeben hatte.
Sie haben uns bestätigt, dass die Anlagentechnik nicht an die Lebenswirklichkeit der Bauern angepasst ist, die von Ackerbau leben und nur sehr wenig Viehhaltung betreiben. Mit zwei Kühen gilt man dort als wohlhabend. Die Standard-Biogasanlagen benötigen aber Kuhdung von wenigstens sechs Kühen. Viele Anlagen werden deshalb nicht so genutzt, wie sie genutzt werden sollten, um die tägliche Kochenergie bereit zu stellen. Stattdessen wurde weiterhin mit Holz gekocht.
In den letzten Jahren wurde von den Industrienationen viel in Biogas-Forschung investiert. Wir wissen nun, dass Biogas-Anlagen auch rein auf Basis nachwachsender Rohstoffe funktionieren. Diese Erkenntnisse versuchen wir nun in diesem Kleinstmaßstab umzusetzen, so dass Bauern, die Ackerbau betreiben, diese Anlagen voll nutzen können, weil sie über genügend Substrat verfügen.
Warum ich das mache
Ich wollte eine Diplomarbeit im Bereich regenerative Energien schreiben, die Sinn macht und zur Umsetzung kommt, statt in der Uni-Bibliothek zu verschwinden wie der x-te Waschmaschinenschalter, der nicht produziert wird. Außerdem schätze ich es sehr, dass ich immer die Möglichkeit hatte, mich weiterzubilden, und es allein in meiner Verantwortung lag, die Richtung einzuschlagen, in die ich möchte. In Afrika gibt es diese Möglichkeiten oft nicht. Unser Projekt gibt den Menschen vor Ort die Chance, etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Arbeit zu finden und sich in bescheidenem Maße selbst zu verwirklichen.
Außerdem bringen wir Energie dorthin, wo sie benötigt wird, wenn Menschen weiterkommen und sich entwickeln wollen. Unsere Form der Energiegewinnung durch eine Biogas-Anlage hat weitreichende Auswirkungen: Die Menschen benötigen nur noch wenig Brennholz. Die Vermeidung von Abholzung wiederum beugt der Erosion des Bodens vor. Außerdem müssen die Kinder nicht mehr stundenlange Wege zurücklegen, um Brennholz zu beschaffen, sondern können regelmäßiger die Schule besuchen. All dies macht für mich Sinn und motiviert mich.
Was es bislang gebracht hat
„Ingenieure ohne Grenzen“ ist mit seinen zehn Jahren ein noch junger Verein, der sich seit seinen Anfängen an engagierte Studierende richtet. In zahlreichen Uni-Städten haben sich mittlerweile Regionalgruppen gegründet. Auch das Team ist relativ jung. Projektumsetzung und Forschung werden häufig von Studierenden durchgeführt. Diplomierte Ingenieure stehen vielfach als Berater im Hintergrund und übernehmen die Organisation. Nicht jeder kann es in seinem Berufsleben einrichten, für drei Monate nach Afrika zu gehen.
Doch nur mit Ingenieuren ist ein Projekt nicht umzusetzen. Wir brauchen Sozialwissenschaftler, Techniker, Kommunikationsexperten und Mitarbeiter, die sich mit Erhebungen oder interkulturellen Aspekten befassen. In diesen Bereichen wächst der Verein sehr stark.
Auch wir hatten in unserem Projekt unsere Schwierigkeiten mit der interkulturellen Kommunikation und mussten viel lernen. Es war beispielsweise nicht leicht, unsere Partnerorganisation von der Notwendigkeit der Forschung zu überzeugen. Unsere Biogas-Anlagen waren ja zu Projektbeginn noch nicht serienreif. Sie zeigten sich zwar einverstanden, doch in Afrika gibt es neunzehn Jas und ein Nein – und „Ja“ bedeutet nicht immer gleich „Ja, wir haben es verstanden“. Es war für uns wichtig, die Anlage zusammen mit den Menschen vor Ort zu entwickeln. Die Bauern von MAVUNO Project haben jedoch nicht immer gleich den Nutzen für sich gesehen, denn wir haben zunächst zwei Pilotanlagen gebaut, die nicht bei den Familien standen. Es war ein langer Prozess, unsere Partner miteinzubeziehen.
Fünf Mal bin ich seit Projektbeginn nach Tansania gereist, mein längster Aufenthalt dauerte sechs Monate. Ich bin von Anfang an dabei – das Projekt ist mir ans Herz gewachsen. Ich möchte es auf eine Weise zu Ende führen, dass ich es an unsere Partnerorganisation übergeben kann, ohne dass das Projekt beeinträchtigt wird. Als Berater würde ich dann weiter zur Verfügung stehen. Doch zuvor braucht es noch eine Menge Technologietransfer sowie einheimische Biogas-Experten, Arbeiter und den Zuspruch der Community in den Dörfern, bis das Projekt auf eigenen Beinen steht und sich selbst trägt. Ich schätze, in zwei Jahren könnte es so weit sein.