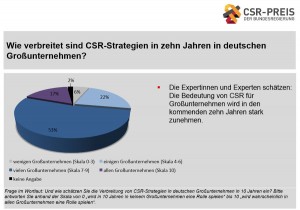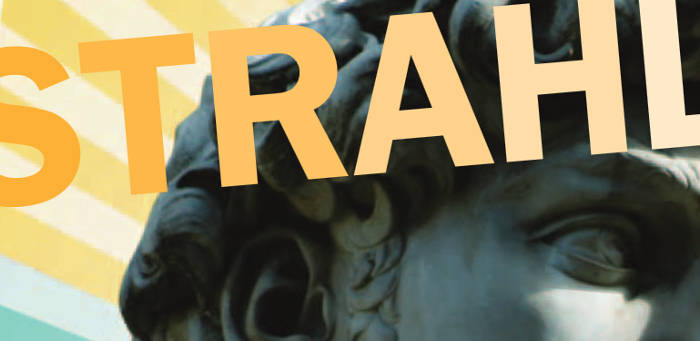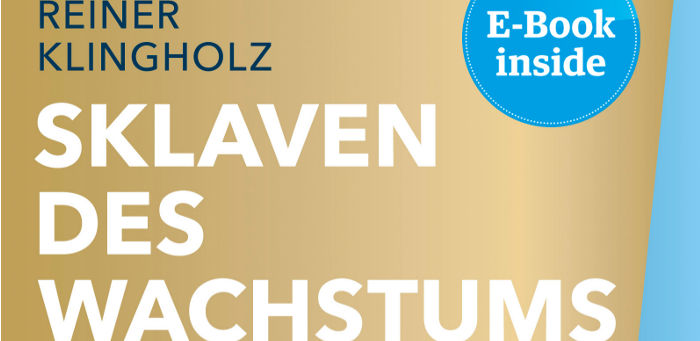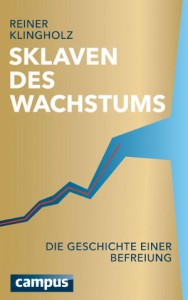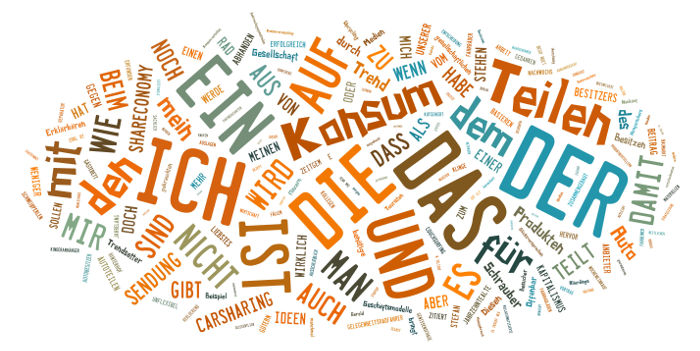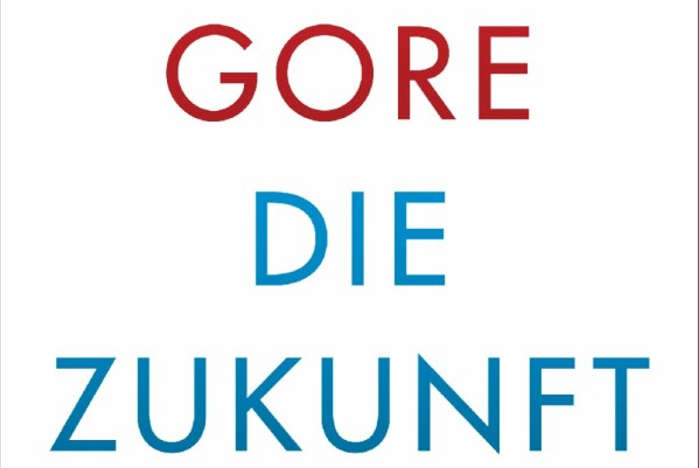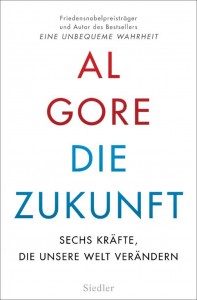(Aus BerufSZiel 1.2009) Was ist passiert mit der edlen Tugend Pünktlichkeit? Sie scheint heute überholt, vom schlampigen Alltag aufgefressen, von einer omnipräsenten „Aufschieberitis“ an den Rand gedrängt. Dabei ist die auch als „Höflichkeit der Könige“ bezeichnete Tugend so wichtig wie eh und je – besonders in der Arbeitswelt. Welche Bedeutung sie hat und wie man sie sich dauerhaft zum Freund macht, erläutert Werner Tiki Küstenmacher. Kurioserweise ist der Erfolgsautor, Karikaturist und evangelische Pfarrer zum vereinbarten Termin nicht zu Hause. Er ist unterwegs, das Auto in die Werkstatt bringen. Das Interview mit BerufSZiel-Autorin Tanja Binder findet mit zwei Stunden Verspätung statt.
Zur Person
Werner Tiki Küstenmacher, 1953 in München geboren, wurde 2001 mit dem Ratgeberbuch „Simplify your Life“ (Co-Autor ist Lothar J. Seiwert) berühmt. Das Buch war noch 2007 auf der „Spiegel“-Bestsellerliste zu finden und wurde mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt.
Sind Sie ein pünktlicher Mensch?
(verzweifelt) Leider nein. Ich gehöre zu den Menschen, die sich zu viel vornehmen und unterschätzen, wie lange die einzelnen Arbeiten dauern. Sie wollen den anderen nicht schaden, sondern helfen – weshalb sie selbst dann oft zu spät kommen. Sie versuchen, allen zu gefallen. Das ist das tiefer liegende Problem bei uns Unpünktlichen.
Notorische Zuspätkommer behaupten gerne, sie könnten nichts gegen ihre Unpünktlichkeit tun. Existiert so etwas wie ein Gendefekt?
Das würde ich nicht sagen. Ich kenne sehr genau den Anteil meiner Schuld, wenn ich mich verspäte. Ich setze mich beispielsweise gerne selber unter zeitlichen Druck, damit mein Leben nicht so langweilig ist. Eigentlich haben wir Unpünktlichen Angst vor der Leere in unserem Lebene.
Das heißt, unpünktliche Menschen sind weder Egoisten noch schlechte Teamplayer?
Ich kenne viele unpünktliche Leute, die zu wenig egoistisch sind. Vor allem Frauen sind davon betroffen.
Weil sie nicht Nein sagen können?
Genau. Das ist übrigens auch meine Schwäche. Das muss man richtig gehend üben.
Wie?
Wenn mich jemand bittet, etwas zu machen, sage ich nie direkt zu, sondern dass ich es mir erst noch überlegen muss. Das Problem beim Ja-Sagen ist, dass es sich so schön anfühlt und der andere glücklich strahlt. Doch wenn man es nicht schafft, obwohl man zugesagt hat, ist der andere doppelt unglücklich. Also kein spontanes „Ja“, sondern erst einmal ein „Vielleicht“ oder ein „Nein“.
Ist Pünktlichkeit eine altmodische Tugend, die überkommen ist in unserer schnelllebigen Zeit?
Das glaube ich nicht. Pünktlichkeit wird sogar immer wichtiger. Wenn sich bei mir die Termine sehr dicht drängeln, sage ich mir: Zeit ist nicht etwas, das auf mir lastet, sondern etwas, das mir gehört. Wir haben in unserer Sprache Bilder wie „unter Zeitdruck sein“. Damit stellt man sich als Opfer dar. Ich dagegen stelle mir vor, dass der Tag ein Garten ist, durch den ich gehe – mal schnell und mal langsam. Die Zeit steht mir zur Verfügunge; sie ist ein wunderbares Geschenk.
Ist Pünktlichkeit für die berufliche Karriere wichtig – auch als eine Form der Höflichkeit anderen gegenüber?
Ja. Andere Menschen warten zu lassen, ist respektlos. Pünktlichkeit ist eine Kunst, die manche Menschen aber erst lernen müssen. Zum Beispiel Arbeitslose: Wenn der äußere Zwang nachlässt, ist das bei vielen Menschen so, als ob aus einem Ballon die Luft entweicht. Wir haben uns daran gewöhnt, von einem äußeren Korsett zusammengehalten zu werden, und das von frühster Kindheit an – in der Krippe, im Kindergarten, in der Schule. Deshalb fürchten sich manche Menschen richtiggehend davor, selbstständig zu arbeiten, weil sie sich selbst disziplinieren müssten.
Kann man sich denn mit Terminschlamperei ins berufliche Abseits befördern?
Das allein reicht nicht aus. Wenn jemand gut ist, verzeiht man ihm ab und an seine Unpünktlichkeit. Das merke ich bei mir: Ist die Zeichnung gut, sieht man mir nach, dass ich zu spät geliefert habe. Wenn man aber immer zu spät ist und zusätzlich seine Arbeit nicht gut macht, dann befördert man sich ins Abseits. Denn Unpünktlichkeit ist etwas, das leicht messbar ist – im Gegensatz zur Qualität der Arbeit.
Muss auch der Chef pünktlich sein?
Ja, absolut. Wobei ich festgestellt habe, dass Menschen, die überkorrekt und sehr pünktlich sind, eher negativ bewertet werden. Heutzutage will man Angestellte, die sich voll fürs Unternehmen einsetzen und auch mal zu einer verrückten Nachtstunde arbeiten. Dafür dürfen sie am nächsten Morgen auch mal zu spät kommen. Die überkorrekten Malen-nach-Zahlen-Typen sind nicht mehr gefragt. Wir sollten aber nicht nur über „Pünktlichkeit von vorne“ sprechen, sondern auch über die „Pünktlichkeit nach hinten“, wie ich das nenne: Ein Vortrag soll zwanzig Minuten dauern, doch der Sprecher wird und wird nicht fertig.
Und stiehlt den Zuhörern die Zeit …
Ganz genau. Ein anderes Beispiel ist die Super-Seuche der Meetings. Ich plädiere für weniger Meetings, denn sie sind das teuerste, was man in einer Firma veranstalten kann. Ich empfehle den Firmen probehalber einfach mal die Hälfte der Meetings wegzulassen. Meine Erfahrung zeigt, dass es auch so funktioniert. Ein weiterer großer Zeitfresser sind E-Mails …
… weil sie den Arbeitstag so zerfasern?
Genau. Die Zeitmanagement-Expertin Julie Morgenstern hat ihr neustes Buch genannt: „Never check Email in the Morning“. Nicht mit dem Mikro-Management starten, sondern mit etwas Großem. Das entspricht auch der Großmann-Methode, deren Kern besagt, man soll den Tag mit etwas Unangenehmem beginnen, das man gerne vor sich herschieben würde. Wenn man das gemacht hat, kann man sich um elf oder nachmittags dem Kleinkram widmen. Das ist der effizienteste Zeitspartipp, den es gibt.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Unordnung am Arbeitsplatz und Unpünktlichkeit?
Ja. Unordnung auf dem Schreibtisch ist wie Sand im Getriebe. Die Schnelligkeit leidet ungemein, wenn man viele Stapel um sich herum hat.
Also ist es sinnvoll, erst einmal Zeit ins Aufräumen zu investieren?
Ja. Es ist falsch, erst aufzuräumen, wenn man Zeit hat. Man muss mitten im Stress aufräumen. Das ist gut investierte Zeit und ein gutes Gefühl, wenn man die Schreibtischoberfläche wieder sieht.
Aber nimmt man nicht auch oft das Aufräumen als Vorwand, um mit einer wichtigen Tätigkeit nicht zu beginnen?
Damit sind wir beim Thema Prioritätensetzen. Es heißt, man solle die wichtigsten Dinge zuerst tun. Mit dieser Weisheit habe ich meine Schwierigkeiten, denn oft wissen wir erst hinterher, was wichtiger gewesen wäre. Ich selbst bin zu einer Art Lotterie übergegangen, bei der das Los entscheidet, mit welcher Arbeit ich anfange. Ich mache das eine fertig, bevor ich etwas anderes anfange. Bloß nicht Multitasking, denn dann leiden beide Arbeiten, und man braucht länger, als wenn man die Arbeiten hintereinander macht.
Es gibt eine Art der „Aufschieberitis“, die dem Perfektionismus entspringt. Man will etwas so gut machen, dass man den Anfang scheut. Wie kann man das überwinden?
Wir wissen aus der Arbeitspsychologie, dass die drei Tage vor dem Urlaub die effizientesten Arbeitstage sind. In dieser Zeit erledigen die Menschen unglaublich viel und schnell. Denn dann wartet man nicht, bis man etwas besser machen kann, sondern macht es einfach. Der Rat müsste also lauten: Machen Sie öfter im Jahr Urlaub oder verhalten Sie sich zumindest so, als ob. Machen Sie die Sachen schlecht, erledigen Sie einfach alles, schreiben Sie nur ganz kurze, unhöfliche Antwortmails, schaffen Sie alles weg – egal wie. Kurzum: Abschied vom Perfektionismus.
Wie kann man mit wenig Aufwand seine Termintreue verbessern?
Was gut funktioniert: Mit dem Chef vereinbaren, dass E-Mails nicht am Vormittag beantwortet werden müssen. Und man sollte das Bimmelsignal abstellen und die Mails nur an ein oder zwei festgelegten Zeiten am Tag abarbeiten.
Ein weiterer Zeitfresser sind die Kollegen, die just dann auf ein Schwätzchen vorbeikommen, wenn man mitten im Arbeitsfluss ist. Wie wird man sie wieder los, ohne unhöflich zu sein?
Ein Tipp: Wenn ein Besucher reinkommt, steht man auf und geht ihm entgegen, damit dieser nicht auf die Idee kommt, sich zu setzen. Mit dem Aufstehen macht man klar, dass man an etwas arbeitet. Das hilft übrigens sogar beim Telefonieren.
Wenn man eine funktionierende Struktur gefunden und den Arbeitsplatz aufgeräumt hat, wie schafft man es, nicht in alte Muster zurückzufallen?
Suchen Sie sich Verbündete. Ob Diät oder Arbeitsvereinfachungen – es ist immer blöd, allein gegen den Strom zu schwimmen.
Wie kann man einen Kollegen, der durch seine Unpünktlichkeit immer wieder die Arbeitsabläufe stört, zu mehr Termintreue motivieren?
Auch dazu sollte man sich Mitstreiter suchen. Wenn zwei oder drei an einem Strang ziehen und unabhängig voneinander den Kollegen auf seine Unpünktlichkeit ansprechen, ist das wirkungsvoller.
Wie kann man als Chef zu mehr Pünktlichkeit motivieren?
Wenn ich jemanden hätte, der alles zu spät abliefert, würde ich größere Aufgaben aufteilen. Wenn er am Freitag einen 30-seitigen Bericht abliefern soll, würde ich am Dienstag um einen Entwurf bitten, weil ich weiß, dass er sonst erst am Freitag anfängt. Ich finde, es gehört zu den Aufgaben eines Chefs, seinen Untergebenen Struktur und Führung zu bieten, sie zu ermutigen und ihnen auch große Aufgaben zuzutrauen. Das berühmte Fördern und Fordern also – wobei „Fördern“ ganz groß und „Fordern“ ganz klein geschrieben werden sollte.