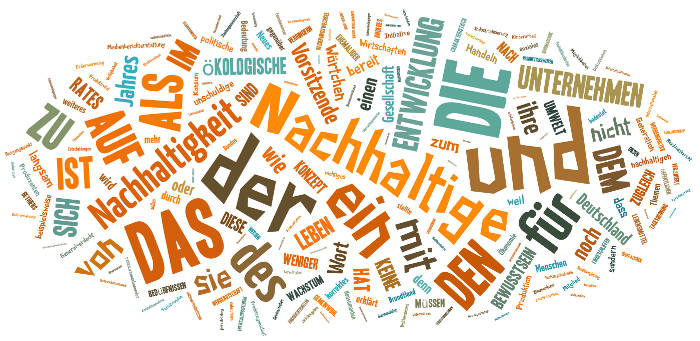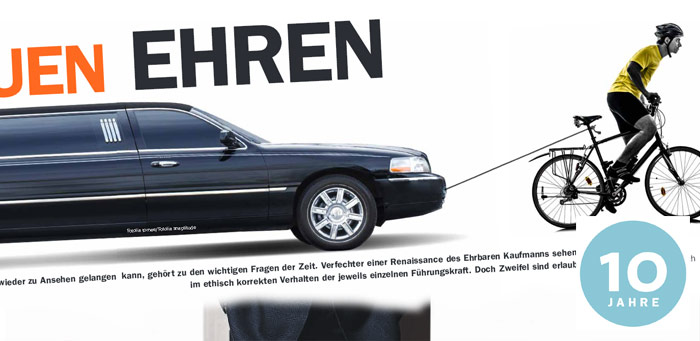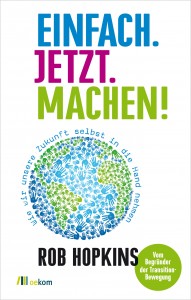Eine Bürgerbewegung will wissen, wie nachhaltiges Leben in einer Großstadt wie Köln funktionieren kann. Mit dem autofreien „Tag des guten Lebens: Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit“ wollen es die Bewohner der Rheinmetropole herausfinden. Von Stefan Trees
Tische und Sofas anstelle von Autos, sorglos herumkurvende Kinder auf Dreirädern und fröhliche Jungs beim Fußball spielen mitten auf der Straße – am „Tag des guten Lebens“ im September vergangenen Jahres gehörten die Straßen im Kölner Stadtviertel Ehrenfeld ihren Bewohnern. Hier blieb ein Gebiet, in dem mehr als 20.000 Menschen wohnen, einen ganzen Tag lang für den motorisierten Straßenverkehr gesperrt. Manche der engen Straßen des ehemaligen Industrie- und Arbeiterviertels waren komplett autofrei. Die Bewohner hatten ihre Autos auf den mehr als 1000 Ausweichparkplätzen in der Umgebung abgestellt. Nun saßen sie zum Essen und Reden zusammen, musizierten oder pflanzten Blumen unter die Bäume am Straßenrand. Viele Nachbarn lernten sich an diesem Tag erstmals kennen.
Tag des guten Lebens in Köln-Ehrenfeld:
31. August 2014
Tag des guten Lebens in Köln-Sülz:
21. September 2014
Frühjahr 2015
Im Schein der Septembersonne nahmen nach Schätzungen der Polizei zwischen 80.000 und 100.000 Menschen am Ehrenfelder „Tag des guten Lebens“ teil – ein Riesenerfolg für die Impulsgeber des Veranstalters Agora Köln und die Ehrenfelder Nachbarinnen und Nachbarn mit einer Signalwirkung für ganz Köln.
Der nicht-kommerzielle Charakter der Veranstaltung mit Essensständen auf Spendenbasis, Straßenmusik und einer entspannten Atmosphäre wurde von den Menschen begeistert aufgenommen. Auch die Resonanz in der Presse war groß. Der Kölner Stadtanzeiger kommentierte: „Kölns Stadtentwicklungspolitik braucht mehr solcher Impulse – und viele weitere Tage des guten Lebens“.
Dabei richtete sich das Nachbarschaftsfest nicht gegen Autofahrer. Autofrei ist der Tag des guten Lebens, um „einen Freiraum zu schaffen für Nachbarschaften, sich näher kennen zu lernen und einen Raum in der Straße nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten“, sagt Mitorganisator Rolf Schneidereit und fügt hinzu: „Die Straße ist nicht mehr Verkehrsweg, sondern Begegnungsstätte.“ Dass viele Nachbarinnen und Nachbarn ihr „Veedel“ bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal als Freiraum erleben und die Abwesenheit von Lärm, Abgasen und aggressivem Verkehr als Lebensqualität wahrnehmen können, ist ein durchaus gewollter Nebeneffekt.
Der „Kölner Sonntag der Nachhaltigkeit“ ist jedoch mehr als ein ökologisch-nachhaltiger Beitrag und viel mehr als ein eintägiger Event. Er ist das Ergebnis eines monatelangen nachbarschaftlichen Miteinanders. Denn die Initiatoren der Agora Köln verordnen kein Programm. Stattdessen darf jede Nachbarschaft einen Tag lang die eigene Straße „regieren“. Dazu gehören auch Aufgaben wie Absperrung und Reinigung der Straße.
Das Potential dieser nachbarschaftlichen Dynamik ist enorm. Wenn sich wenig vertraute Menschen gegenseitig in ihre Häuser einladen, einander zuhören, sich gemeinsame Aktionen ausdenken, planen und umsetzen, dann entstehen Gemeinschaften und tragfähige soziale Beziehungen unter Nachbarn. „Es ist nicht selbstverständlich, einen guten Kontakt zueinander zu haben, Konflikte zu lösen, Gemeinsames zu erkennen und so den besten Weg für alle zu finden“, erklärt die aktive Bürgerbewegerin Sophie Zingler: „Nachbarschaft ist auch etwas, das gelernt werden muss.“
Die Ideen von Bürgerbeteiligung, kultureller Vielfalt und Nachhaltigkeit hat die Nachbarschaften in Ehrenfeld nach ihren Erfahrungen im vergangenen Jahr so begeistert, dass der „Tag des guten Lebens“ hier am 31. August 2014 wiederholt wird. Das Gefühl der Selbstverantwortung ist innerhalb eines Jahres derart gewachsen, dass sie ihn weitestgehend in Eigenregie planen und durchführen werden.
Die Akteure der Agora Köln wenden sich indes einem neuen Veedel zu: In Sülz wird der „Tag des guten Lebens“ im Frühjahr 2015 stattfinden und sich dem Schwerpunktthema „Freiraum. Gemeinschaftsraum“ widmen. Die zuständige Bezirksvertretung hat sich bereits einstimmig hierfür ausgesprochen. Künftig könnte jedes Jahr ein neuer Stadtteil hinzukommen – bei 86 Veedeln kann die Bewegung der Agora Köln ihrer Stadt noch viele Signale geben.
Die Agora Köln ist eine Bürgerbewegung und basiert auf einem Bündnis aus rund 120 Kölner Institutionen, Unternehmen und Organisationen aus Zivilgesellschaft, Umweltbewegung, Kultur und regionaler Ökonomie.