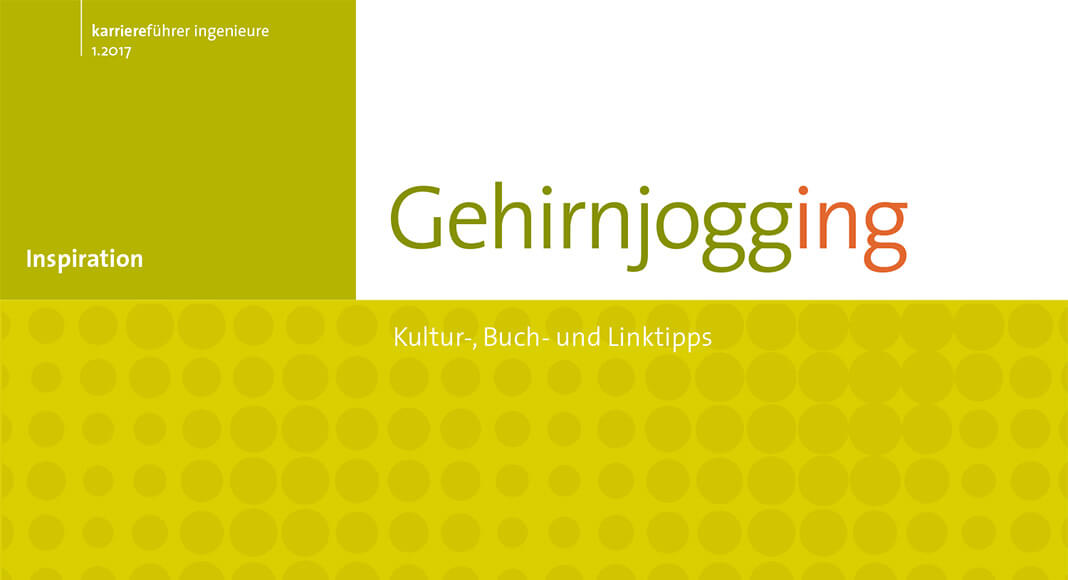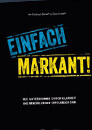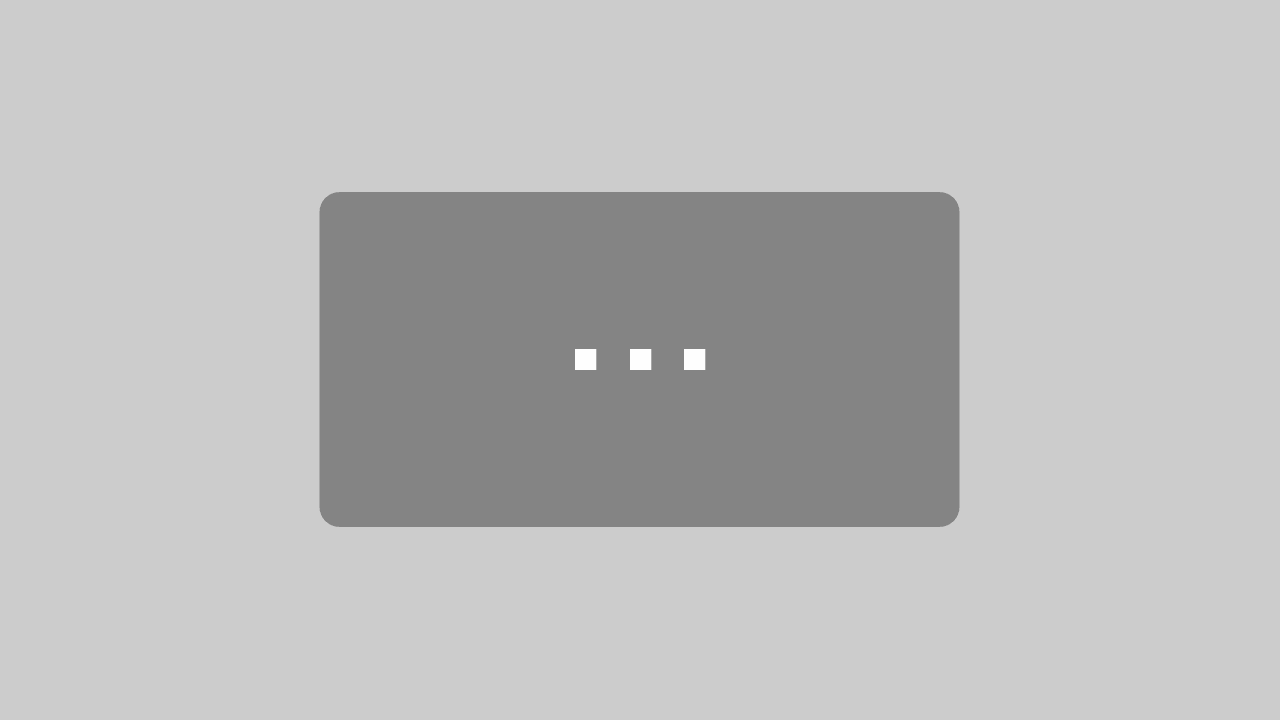3D-Drucken, auch Additive Manufacturing und früher Rapid Prototyping genannt, ist ein Fertigungsverfahren, dass es aus den Labors der Ingenieure in wenigen Jahren bis in Publikumszeitschriften, Journale und sogar ins Frühstücksfernsehen geschafft hat. Was hat der 3D-Drucker, was alle anderen Fertigungsverfahren nicht haben? Von Prof. Dr.-Ing. Andreas Gebhardt, Dekan des Fachbereichs Maschinenbau und Mechatronik an der FH Aachen.
3D-Drucker sind Allround-Talente: Zahntechniker verwenden sie zum Modellieren von Zahnersatz aller Art. Die Drucker produzieren kundenspezifische Schuhe, Brillen oder Schmuckstücke. Sie stellen Einspritzdüsen, temperierte Werkzeugeinsätze oder komplexe Strömungskanäle her. Die Einsatzgebiete reichen von Medizin, Archäologie, industrieller Produktentwicklung, Kunst, Nahrungs- und Arzneimitteln bis zu Bekleidung, Orthopädie, Spielzeug und Raumfahrtkomponenten. Für Ingenieure stellt sich daher die Frage: Wie viel muss ich über 3D-Drucken und 3D-Drucker wissen, um beruflich erfolgreich zu sein?
3D-Drucken ist ein Fertigungsverfahren, um Ideen, die man in 3D-Datensätze fassen kann, direkt und maßstabsgetreu in physische, also anfassbare, Modelle oder Produkte zu transformieren – genauso, wie man einen 2D-Briefentwurf auf dem Bildschirm zwar sehen, aber erst anfassen kann, wenn er mittels eines 2D-Druckers auf Papier transferiert wurde. Die Verfahren und Ideen zum 3D-Drucken wurden vor vielen Jahren auch als „time compressing technologies“ charakterisiert: Sie werden eingesetzt, um schneller bessere Produkte herzustellen. Damit erhöhen sie die Produktivität, unterstützen die
Individualisierung und ermöglichen eine flexible Fertigung.
Herz aus dem 3D-Drucker
Herz aus dem 3D-Drucker? Im Mai fand in Mainz die International Conference on 3D Printing in Medicine statt. Dort tauschten sich Referenten und Experten aus, unter anderem aus dem Bereich der regenerativen Medizin. So lassen sich schon heute Adern, Nerven, Brustgewebe, Knochenersatzmaterial oder Hornhaut mit dem 3D-Druckverfahren herstellen. Doch Univ.-Prof. Dr. Dr. Bilal Al-Nawas, leitender Oberarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universitätsmedizin Mainz, warnt vor allzu hohen Erwartungen an die neue Technik für den Medizinbereich: https://goo.gl/JlqVTS Und: An der TU und LMU wird daran geforscht, dass sogar ein Herz aus dem 3D-Drucker kommen kann: https://youtu.be/MscvWuAuAK0
3D-Drucker arbeiten zwar vollautomatisch, sobald sie gestartet werden, aber für ihren erfolgreichen Betrieb müssen Ingenieure das Zusammenspiel von Mechanik, Elektronik und Informationstechnologie, Werkstoffkunde und Qualitätsmanagement kennen. Universitäten und Fachhochschulen bieten zunehmend Vorlesungen und Praktika zum Umgang mit 3D-Druckern an. Webinare und Firmeninformationen sind über das Internet zugänglich.
Die Fachhochschule Schmalkalden hat einen berufsbegleitenden Studiengang „Anwendungstechniker (FH) für Additive Verfahren/Rapid Technologien“ im Angebot. Kurse mit Fokussierung auf bestimmte Aspekte, etwa Kunststoff oder Metall, stehen im Programm vieler Kammern und Verbände. Spezielle Themen sind oft an Hochschulen angesiedelt. So beschäftigt sich zum Beispiel das Aachener Institut für werkzeuglose Fertigung, ein An-Institut der FH Aachen, mit der Konstruktion für das Additive Manufacturing.
3D-Drucken verändert alle Elemente der Produktentwicklungskette. Es erschließt neue Konstruktionsmethoden, gestattet individualisierte Produkte ohne Mehrkosten, macht die Fertigung leichter und Produkte billiger. All das können die meisten anderen Fertigungsanlagen nicht bieten.