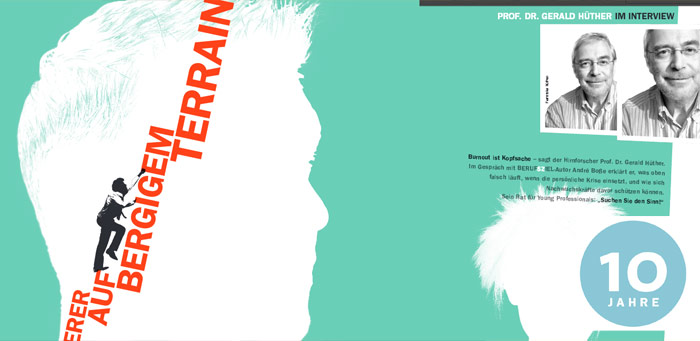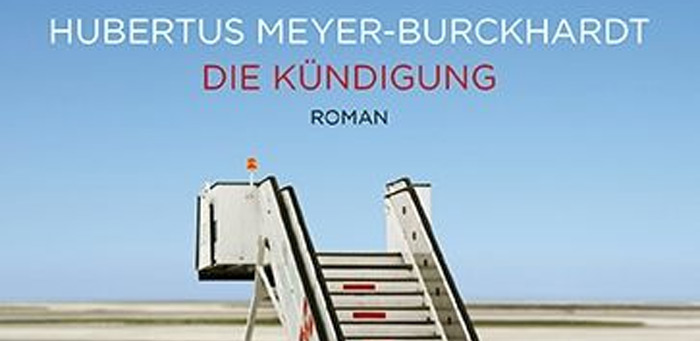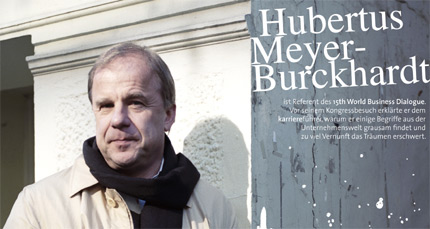Netzwerke, wohin man schaut: Forscher forschen miteinander, Einrichtungen gehen gemeinsam Projekte an, Unternehmen kooperieren mit Universitäten oder kleinen innovativen Firmen. Vorteil für den Nachwuchs: Es bieten sich mehr Möglichkeiten für spannende Forscherkarrieren denn je. Von André Boße
Wer zum ersten Mal das Gründer- und Technologiezentrum Adlershof im Südosten Berlins besucht, erlebt sofort die Vielfalt des Forschungsstandorts. Hier ist immer etwas los: Die Mitarbeiter der mehr als 900 Unternehmen, die hier ihren Sitz haben, treffen sich draußen auf den Sitzbänken in den Höfen des Campus zu spontanen Meetings, führen in einem der Cafés Fachgespräche oder tauschen sich über Mobiltelefon mit Kollegen aus aller Welt aus. Man spürt: Hier arbeitet man nicht nebeneinander her. Hier wird kooperiert. Ein Eindruck, den Ulrich Panne nur bestätigen kann. Der Chemieprofessor der Bundesanstalt für Materialprüfung ist ehrenamtlich Vorstand der Initiativgemeinschaft außeruniversitärer Forschungseinrichtungen in Adlershof (IGAFA). Der Verein fördert das Miteinander der vielen Akteure, die im Technologiezentrum forschen. „Die Kooperationen werden durch eine Vielzahl von Netzwerken geknüpft. Einige davon sind koordiniert, andere informell“, sagt er. In Adlershof gibt es nichts, was es nicht gibt: Mal stellt ein junges Start-up zusammen mit der Humboldt-Universität ein Projekt auf die Beine, mal starten kleinere Adlershof-Unternehmen eine gemeinsame Initiative, um einen industriellen Großkunden zu gewinnen. „Diese vielfältigen Kombinationen sind Grundlage dafür, dass ein besonderer Innovationszyklus von der Idee bis zum fertigen Produkt entsteht. Der Campus Adlershof erzeugt damit wertvolle Synergie-Effekte der unterschiedlichsten Akteure“, sagt Panne. Nichts geht ohne Kommunikation Von dieser Synergie profitieren auch die Nachwuchsforscher, die in einem der vielen Unternehmen und Einrichtungen einsteigen. Voraussetzung dafür: Keiner darf Forschung als Tüftelei im stillen Kämmerlein verstehen. Die Herausforderungen der Gegenwart sind viel zu komplex und kompliziert, um sie als Einzelkämpfer zu meistern. Exemplarisch rückt Ulrich Panne die Thematik „Licht, Materialien und Modelle“ in den Fokus, die derzeit die Arbeit vieler Forscher prägt. „Dahinter verbirgt sich eine Fülle von Fragestellungen aus vielen verschiedenen Bereichen: Optik und Mikrosystemtechnik, Materialforschung und Mathematik, Informatik und ihre Anwendungen.“ Um mit anderen Forschern in den Dialog treten zu können, braucht man ein Talent für Kommunikation. „Ein Forscher muss in der Lage sein, einerseits die eigene Forschung zu kommunizieren und sich andererseits in komplexe Sachverhalte anderer Fachrichtungen einzuarbeiten“, sagt der IGAFA-Vorstand. „Forschung entspricht heute eben nicht mehr nur der romantisierten Vorstellung einer individuellen intellektuellen Leistung – auch, wenn es natürlich weiterhin wichtig bleibt, dass der Einzelne in seinem Bereich über viel Know-how verfügt.“ So hoch die Anforderungen, so gut sind die Chancen auf eine erfolgreiche Forscherkarriere. „An Standorten wie Adlershof wird durch die Vielzahl der Partner eine einmalige Ausbildung in großer Breite möglich. Der Nachwuchs erwirbt Fachkenntnisse, lernt Soft Skills und erhält Einblicke in akademische und industrielle Arbeitswelten. Damit ergeben sich auf dem nationalen und globalen Arbeitsmarkt natürlich sehr gute Karrierechancen“, sagt Ulrich Panne.Die ganze Bandbreite erfahren Doch nicht nur die Technologiezentren der Metropolen bieten optimale Einstiegsmöglichkeiten. Auch viele mittelgroße Städte tun alles dafür, um sich als Forschungsstandort zu profilieren. Zum Beispiel Braunschweig. Hier hat Forschung Tradition, die Geschichte der Technischen Universität geht zurück bis ins Jahr 1745. Vor allem aber verfügt Braunschweig heute über einen herausragenden Stellenwert in der Forschungslandschaft: Laut dem „Eurostat Jahrbuch der Regionen“, einer statistischen Analyse europäischen Lebens der EU-Kommission, ist Braunschweig und Umgebung europaweit die Region mit der höchsten Dichte an Einrichtungen und Unternehmen, die forschen und entwickeln. Mehr als 15.000 Menschen arbeiten hier in der Forschung – ob an der TU oder in Hochschul-Spin-offs, in kleinen Unternehmen oder bei Konzernen wie Siemens oder Volkswagen. Für Naturwissenschaftler besonders interessant ist Europas zweitgrößter Forschungsflughafen, wo Physiker mit Spezialisten anderer Disziplinen an vollautomatischen Flugsystemen arbeiten. Diese Forschung soll sich eines Tages auszahlen, doch zunächst einmal kostet sie viel Geld. Daher suchen forschungsintensive Einrichtungen und Unternehmen Forschernachwuchs, der ihnen dabei hilft, Förderungen an Land zu ziehen. Joachim Roth, Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig, empfiehlt daher allen naturwissenschaftlichen Absolventen, die Rolle des Selbstmarketings nicht zu unterschätzen. „Schließlich wollen Förderinstitutionen, Banken oder Investoren wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie Kapital geben. Das ist Kommunikation pur, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden kann.“ Damit die verschiedenen Akteure miteinander ins Gespräch kommen, sieht sich auch die Stadt in der Pflicht. „Es ist wichtig, dass junge Forscher mit Geschäftsideen und die etablierte Wirtschaft zueinander finden, damit in einer frühen Phase Interesse entsteht und Ansatzpunkte für Kooperationen gefunden werden“, sagt Roth. Braunschweig hat dazu viele Plattformen aufgebaut – und für Nachwuchsforscher ist es wichtig, diese Angebote zu nutzen und gewinnbringende Netzwerke aufzubauen. Forscherwissen nutzen Diese Kontakte können Einsteiger dann auch als Brücke in die großen Unternehmen nutzen. Kaum ein Konzern, der nicht in eigenen F&E-Abteilungen nach Innovationen sucht und dafür exzellenten Forschernachwuchs mit naturwissenschaftlichem Hintergrund benötigt. Bei Daimler zum Beispiel steht die Materialforschung im Fokus. Stichwort Leichtbau: Die Autos sollen leichter werden, damit sie effizienter fahren. Doch die Suche nach passenden Materialien ist schwierig. Einerseits sollen sie möglichst wenig wiegen, andererseits müssen sie sich nach den Anforderungen der Autobranche verarbeiten lassen und bei Unfällen größtmögliche Sicherheit gewährleisten. Also machen sich Materialforscher bei Daimler auf die Suche nach neuen Stoffen mit teilweise komplexen und noch wenig erforschten Eigenschaften. In Labors testet man, wie sie bei Unfällen oder auf extremes Wetter und Niederschläge reagieren und ob diese Stoffe überhaupt wirtschaftlich vernünftig herstellbar sind. Dabei gilt: Jeder neue Stoff erfordert neues Fachwissen. Widmet man sich zum Beispiel dem karbonfaserverstärkten Kunststoff, ist textilchemisches Knowhow notwendig, das sich die Forscher mithilfe eigener Recherche zunächst einmal erarbeiten müssen. „Ich denke daher, man sollte sich nicht zu früh spezialisieren“, sagt Peter Berg, der bei Daimler für das Recruiting des Nachwuchses zuständig ist. Naturwissenschaftler besitzen in seinen Augen die besten Einstiegschancen, wenn sie Flexibilität beweisen. „Um sich in künftige Technologien einzuarbeiten, die heute noch gar nicht auf der Agenda stehen, ist ein breites Grundwissen wichtig. Darauf kann man aufbauen und sich während seines Berufslebens, wenn es darauf ankommt, auf neue Themengebiete spezialisieren.“ Im Fokus: Umwelt und Medizin Diese Flexibilität ist auch wichtig, weil das Forschungs- und Entwicklungstempo in den vergangenen Jahren enorm zugenommen hat. Das liegt nicht nur am technischen Fortschritt: Auch der soziale und politische Wandel spielt eine Rolle. Nicht erst seit den Ereignissen in Fukushima und der Energiewende stehen zum Beispiel Umwelttechnologien im Fokus. Deutschland ist hier weltweit Vorreiter. Das Know-how heimischer Forscher ist gefragt, was sich auch an Einrichtungen wie dem Climate Service Center in Geesthacht bei Hamburg zeigt, in dem Fachexperten die Wirtschaft beraten – und somit konkrete unternehmerische Impulse setzen. Mit Blick auf die medizinische Forschung stehen aktuell die spannendsten Entwicklungen im Zeichen der personalisierten Medizin: Neue Erkenntnisse über Krankheiten werden kombiniert mit Wissen aus der Molekularbiologie – und es entstehen individuelle Therapien und Behandlungsansätze. „Die rasante Entwicklung des Wissens in Naturwissenschaften und Technik öffnet die Türen für völlig neue Erkenntnisse“, sagt Bernd Manfred Schmitz, Leiter des Hochschulmarketings bei Bayer. Diese Chancen zu erkennen und Produkte mit ganz neuem Nutzen zu entwickeln, sei das Ziel des Unternehmens – und damit auch die Herausforderung, vor der der Forschernachwuchs steht. Offensichtlich ist, dass sich die alten Forschungsstrukturen aufgelöst haben: Hier die Experten im Labor, dort die produzierende Industrie, die deren Erkenntnisse umsetzt – dieses Bild stimmt nicht mehr. „Wir sind als Unternehmen offen für Innovationen von außen und kooperieren daher mit den besten Partnern aus den für uns wichtigen Bereichen“, sagt Schmitz. Zum Einsatz kommen schon jetzt alle denkbaren Möglichkeiten der Partnerschaften. Nun gilt es für den Forschernachwuchs, diese Chancen zu ergreifen.Forscher und Projektleiter
Neben der Expertenlaufbahn ergeben sich für Naturwissenschaftler in forschungsintensiven Unternehmen häufig Gelegenheiten, eine Karriere in der Projektleitung anzuvisieren. Hier kommt es jedoch auf weit mehr als Fachwissen an: Teams müssen zusammengesetzt und geführt, die Ergebnisse kommuniziert und Projektziele abgesteckt werden. Die Autorin Katharine Hölzle stellt in ihrem Buch „Die Projektlaufbahn“ (Gabler Verlag, 2010, ISBN 3834917729, 57,99 Euro) organisatorische Voraussetzungen und Instrumente zur Motivation von Teammitgliedern und Projektleitern vor.
BWL-Update für Naturwissenschaftler
Forschung funktioniert kaum noch ohne ausreichende Kenntnisse über betriebswirtschaftliche Zusammenhänge, denn selbst in öffentlichen Forschungseinrichtungen arbeiten heute Controller, und es entstehen wirtschaftliche Leistungsbilanzen. Die Academy der International School of Management bietet regelmäßig BWL-Updates auch für Naturwissenschaftler an. Das zweitägige Seminar vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Methoden und Verfahren, um kaufmännisch sowie unternehmerisch handeln zu können, und führt in wichtige Themen wie Cash-Flow oder Return-of-Investment ein. Termine für das Seminar „Betriebswirtschaft für Nichtkaufleute“ auf www.ism-academy.de






 Der Roman „Die Kündigung“ von Hubertus Meyer-Burckhardt ist auch als Taschenbuch erhältlich.
Inhalt: Simon Kannstatt, Investmentbanker, gelernter Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn.
Der Roman „Die Kündigung“ von Hubertus Meyer-Burckhardt ist auch als Taschenbuch erhältlich.
Inhalt: Simon Kannstatt, Investmentbanker, gelernter Jurist und Volkswirt, führt als Top-Manager ein Leben in der „Formel 1 der Geschäftswelt“. Die Arbeit ist sein einziger Lebenssinn.